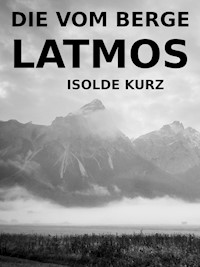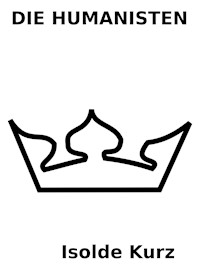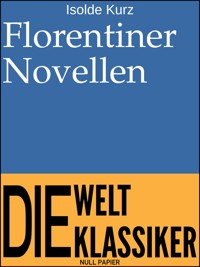
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Florentiner Novellen
Isolde Kurz
Florentiner Novellen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-21-8
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Die Humanisten
Die Vermählung der Toten
Der heilige Sebastian
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Humanisten
Ganz Florenz war in Bewegung, als an einem lachenden Apriltag des Jahres 1482 Graf Eberhard von Württemberg, genannt der Bärtige, mit einer stattlichen Zahl von Räten, Edlen und Knechten seinen Einzug hielt.
Zwar war es den Florentinern nicht ungewohnt, fremde Gäste in ihren Mauern zu beherbergen, wurde ja der glänzende Hofhalt des Mediceers fast nie von Besuchern leer, und dieser Reiterzug erregte die Aufmerksamkeit des schaulustigen Völkchens nur deshalb so stark, weil man wusste, dass er weit von jenseits der Alpen aus einem kalten, finstern Barbarenland komme, dessen Lage und Beschaffenheit sich tief im Nebel der geografischen Begriffe verlor. Die Menge stand viele Reihen tief in den geschmückten Straßen, durch welche die Reiter kommen mussten, denn es war denselben ein mächtiger Ruf vorangegangen, dass sie Zyklopen von ungeheuerlichem Ansehen seien, mit langen, feuerroten Haaren und lodernden Augen, deren Blick man nicht ertragen könne. Von dem Führer aber ging die Rede, er habe einen Bart, der zu beiden Seiten über den Bug des Pferdes niederwalle und das Tier wie mit einem Mantel verhülle.
Jetzt erschien der Zug in einer engen, von hohen Palästen gebildeten Gasse, die sich in halber Länge zu einer dreieckigen Piazzetta erweiterte.
Vorüber zogen die wallenden städtischen Gonfalonen, die Bläser mit ihren langen silbernen Trompeten, woran unter weißem Federbüschel das Wappen der Republik schwankte, und die lustigen Pfeifer mit der roten Lilie auf der Brust – doch als nun an der Spitze der Reiter die kleine, hagere Gestalt des Grafen Eberhard in Sicht kam, dessen Bartwuchs zwar von stattlicher, doch nicht von unerhörter Länge war, da malte sich Enttäuschung auf den meisten Gesichtern.
»Das ist der Anführer der Barbaren – er ist ja kleiner als der Magnifico! – Und wie einfach er sich trägt!« hieß es im Volke, denn der erlauchte Lorenzo war mit den Herren vom Magistrat und vielen Edlen, alle reich in damaszierten Samt gekleidet und mit den Insignien ihrer Würde geschmückt, dem fürstlichen Gaste vor das Stadttor entgegengeritten und führte ihn jetzt auf einem großen Umweg nach seiner Wohnung.
Nun drängten sich die weiter hinten Stehenden auch vor. – »Und nach Rom ziehen sie? Zum Heiligen Vater? Sind sie denn Christen?« murmelte es durcheinander. – »Nein, die hätte ich mir viel merkwürdiger vorgestellt.«
Das gleiche mochte das schöne Mädchen auf der rosenumrankten, mit Teppichen behängten Loggia denken, das zwischen zwei älteren Herren stand und den Zug aufmerksam musterte. Sie hatte dazu den allergünstigsten Standpunkt, da die langgestreckte Säulenhalle mit der schmalen Seite nach der Straße ging und mit der Längsseite die Piazzetta, auf welcher sich der Zug zu stauen begann, einfasste.
»Nun siehst du, Kind«, sagte der betagtere von den beiden Herren, ein bartloser Mann mit regelmäßigen Zügen und dichten, noch schwarzen Augenbrauen, dem die Kapuze, welche zu seinem roten Lucco gehörte, vom Kopf geglitten war, dass das wallende Silberhaar frei floss – »siehst du, dass es Menschen sind wie wir, ohne Hörner und Klauen.«
»Puh, was sie für Bärte haben«, sagte das schöne Kind naserümpfend.
»Unseren Schönheitsbegriffen entspricht das allerdings nicht«, antwortete der Vater mit gelassener Würde. Er sprach langsam und bewegte sich so schön, dass sein Lucco bei jeder Wendung des Körpers malerische Falten warf. – »Aber es sind sehr brave Leute. Betrachte dir den jungen Mann da vorn im schwarzen Habit – das scheint mein Freund, der gelehrte Kapnion zu sein, mit dem ich schon seit Jahren im Briefwechsel stehe, wenn ihn auch die Augen meines Leibes noch nie zuvor erblickt haben. Eine Leuchte der Wissenschaft und würde es wahrlich verdienen, die Sonne Virgils seine Amme zu nennen.«
»Er wird Euch wohl die Handschrift bringen, nach der Ihr so lange suchen ließt, Vater?«
»Wenn der kostbare Kodex noch vorhanden ist, so möchte er leichthin einen andern Liebhaber gefunden haben«, mischte sich der dritte, ein hagerer Mann mit schmalem, vergilbtem Gesichte, ein, der den enthaarten Schädel durch ein flachanliegendes schwarzseidenes Mützchen geschützt hielt.
»Ich dürfte ihn darum nicht einmal schelten, Marcantonio«, entgegnete der schöne Greis mit Sanftmut. »Ist es doch ein Wettkampf, in dem alle Waffen gelten.«
»Die armen Leute!« rief das Mädchen in jugendlichem Mitgefühl, »es mag ihnen wohltun, sich an unserer freundlichen Sonne zu wärmen. Darum zogen sie auch immer so gerne von ihren schneebedeckten Alpen zu uns herunter. Es muss kalt sein, sehr kalt in diesem Germanien.«
»Ja, es ist ein kaltes, unwirtliches Land«, antwortete der Alte. »Und wenn ich denke, wie viele unserer glorreichen Väter noch dort gefangen liegen und in ihren dunkeln Burgen und feuchten Klöstern der Befreiung entgegenschmachten!« setzte er mit einem Seufzer hinzu.
Zum Verständnis unserer Leser sei es gesagt, dass der alte Herr mit diesen Vätern die römischen Autoren meinte, welche die Nacht des Mittelalters hindurch in sauberen Abschriften von den deutschen Mönchen erhalten und gehütet worden waren und jetzt, seit dem Wiederaufblühen der klassischen Studien, scharenweise in ihr Geburtsland zurückwanderten.
Aber während der Vater sich nach der Straße hinabbeugte und mit sehnsüchtigen Augen dem gelehrten Kapnion, vulgo Johann Reuchlin, folgte, hing der Blick des Töchterleins an einem jugendlichen Reiter, der hinter dem Zuge zurückgeblieben war, um sein ungestümes Pferd zu bändigen, das sich stellte und auf dem Pflaster der Piazzetta Funken schlug. Er regierte das heftige Tier nur mit der Linken, während er mit der freien rechten Hand einen starken Lorbeerzweig, den er unterwegs gepflückt hatte, über das Gesicht hielt, um sich vor der ungewohnten Sonne zu schützen, die blitzend auf seinem blanken Stahlgehenke und den Metallplatten seines ledernen Kollers spielte.
Als sein Auge das an eine Säule gelehnte, mit Rosenranken spielende Mädchen traf, senkte er langsam wie zum Gruße den Lorbeerzweig und ließ ein gebräuntes, angenehmes Gesicht, von blondem Kraushaar umrahmt, sehen. Da überkam das Mädchen der Mutwille, dass sie ein Rosenzweiglein brach und dem hübschen Barbaren zuwarf. Dieser erhob sich in den Bügeln, ließ den Lorbeer fallen und haschte geschickt das Röslein, worauf er sich dankend verneigte. Noch ein rascher Blick aus den blauen, leuchtenden Augen, und gleich darauf war der Reiter fast unter der Mähne des Rappen verschwunden, der unter seinem Schenkeldruck hoch aufstieg und ihn dann mit wenigen Sätzen dem Zuge nachtrug.
»Gar nicht übel für einen Barbaren«, lächelte der alte Herr, der sich eben umgewandt hatte, wohlwollend, »was meinst du, Kind?«
Das Mädchen schwieg, sie hätte um alles in der Welt nicht gestehen mögen, wie sehr ihr der Reiter gefallen hatte, aber während sie alle drei von der Loggia zurücktraten, legte sie sich im stillen die Gewissensfrage vor, ob es wohl möglich sei, einen Barbaren zu lieben.
Das Volk hatte sich schon verlaufen, denn alles drängte jubelnd und lärmend dem Zug zum Palaste des Medici nach, in dessen kühlem Hofraum zwischen antiken Marmorstatuen, plätschernden Brunnen und lebendigem Grün der Imbiss für die fremden Gäste bereitet war.
Doch als nach einer Viertelstunde das Mädchen noch einmal flüchtig auf der Loggia erschien, wie um auf dem Pflaster, das schon wieder seine Alltagsmiene trug, nach den Spuren des jungen Reiters zu suchen, da sah sie an der Straßenecke den ungestümen Rappen des Weges zurückkommen, von einem Reitknecht am Zügel geführt, und gewahrte nicht ohne geheimes Wohlgefallen, dass ein Diener des Medici den fremden Knecht nach der Herberge zu den »Drei Mohren« wies, die auf der Piazzetta ihrer Loggia schräg gegenüber lag.
Der Wirt trat heraus, half das Tier zum Stalle bringen und führte dann den fremden Knecht in seine Schenke zu ebener Erde.
Dort schob der Schwabe die Mütze zurück, trocknete seine schweißbedeckte Stirne und öffnete das Wams ein wenig, dann ließ er einen Blick über die anwesenden Gäste gleiten und setzte sich schwer auf die alte Holzbank vor eines der kleinen Marmortischchen. Der Wirt machte sich gleich an ihn heran.
»Caldo, eh!« begann er zutraulich. »Was, kalt!« rief der Kriegsknecht entrüstet. »Esel, sieht Er nicht, wie ich schwitze? Bring mir Wein!«
Alsbald stand ein mächtiger, mit Stroh umbundener Fiasco vor ihm. Er schenkte sich das rote Nass von Chianti ein und stürzte ein Glas auf einen Zug hinunter. Dann bestellte er in seiner Muttersprache zu essen, und auch dieser Befehl fand augenblicklich Folge. Er freute sich, dass ihm die Sprache so wenig Schwierigkeit bereite. Als er aber mit dem Essen fertig war und sich, durch den Wein zur Geselligkeit angeregt, mit dem Wirt in ein längeres Gespräch einlassen wollte, da erkannte er zu seinem Verdruss, dass dieser der schwäbischen Laute nicht Meister war.
Doch winkte der gefällige Florentiner ihm verheißungsvoll zu und entfernte sich eilig, um in Bälde mit einem wunderlichen Menschengebilde zurückzukommen, lang und schwank wie ein Haselrohr, aber so gebrechlich, dass man fürchten musste, es zerknicke bei der ersten Berührung in der Mitte, wo es am schwächsten schien. Dünnes rotes Haar, mit Weiß gemischt, hing schlaff um ein fahles bartloses Gesicht, eines jener Gesichter, die nie zur Mannheit ausreifen, sondern in die späteren Jahre eine welke Jugendlichkeit hinübernehmen. Jede seiner Bewegungen war unnatürlich, von den schmachtenden Wendungen des mageren Halses zu dem gezierten Gang, der im Tanzschritt ansetzte und den Boden unter den Füßen zu verschmähen schien. Nur ein paar blaue Augen, die ehrlich und wohlwollend aus fast unbewimperten Lidern hervorsahen, versöhnten ein wenig mit der dürftig-anspruchsvollen Erscheinung.
Dieses seltsame Wesen kam unter Verbeugungen heran und fragte den Schwaben in schlechtem Deutsch, was des Herrn Landsmanns Begehr sei, und es war possierlich anzusehen, wie sich beim Sprechen seine Ellbogen zu einer flügelschlagenden Bewegung erhoben und das Gewand wedelte, als wollte die ganze luftige Gestalt zum Himmel entflattern.
Der Kriegsknecht sah den Roten verdutzt an, denn er wusste nicht, was er aus ihm machen sollte, und fuhr mit der Hand nach der Mütze, besann sich aber auf halbem Wege anders und kratzte sich nur am Kopf.
Er sei kein Herr, stotterte er verlegen, sondern nur der Peter von Lorch, im Dienst des Edlen Veit von Rechberg-Stauffeneck, eines der besten Ritter im Schwabenland. Die Erwähnung seines Herrn stärkte sein Selbstgefühl, denn er gewann nun die Kühnheit, auch den Roten nach Stamm und Namen zu fragen, wobei er jedoch geflissentlich die direkte Anrede vermied, um ihm weder zu viel noch zu wenig Ehre zu geben.
Er heiße Lucius Rufus, antwortete der andere mit seiner hohen und dünnen Stimme, die die ganze Erscheinung wunderbar vollendete, und sei Majordomus in dem schönen Palaste gegenüber. Auch er dürfe sich eines Gebieters rühmen, der hinter keinem Mann der Erde zurückstehe, denn ganz Florenz kenne den edlen Herrn Bernardo Rucellai als Urbild aller Bürgertugend und als den wahren Vater der Weisheit.
»So«, entgegnete Peter mit breitem Lachen. »Ich habe wohl zuweilen unseren Pfarrer sagen hören, Vorsicht sei die Mutter der Weisheit, aber dass der Herr Rutschel ihr Vater ist, war mir nicht bekannt.«
Der Rote belächelte herablassend diesen Witz und setzte sich neben dem Landsmann nieder, während der Wirt eilig auch ihm ein Glas vollschenkte. Bald kamen noch andere von den schwäbischen Kriegsknechten nach, die ihre Pferde gleichfalls im Stall der »Drei Mohren« unterstellten und vom Wirt dienstbeflissen zu dem Paar am Marmortisch geführt wurden. Doch sie wussten sich schlecht in die Unterhaltung zu finden und sprachen in ihrer Verlegenheit um so mehr dem Weine zu, denn der Rote, dem es ein Vergnügen machte, seine barbarischen Landsleute zu verblüffen, flößte ihnen durch geschraubte fremdländische Redensarten eine gewisse Scheu ein.
Soeben erzählte er, dass er aus Augsburg gebürtig sei – Augusta Vindelicorum – wie er erläuternd hinzusetzte, und wenn sein Stammbaum nicht verloren wäre, so ließe sich leichtlich nachweisen, dass er von einem gewissen Lucius Rufus abstamme, der Unterbefehlshaber im Heere des Kaisers Augustus gewesen und der die Stadt habe gründen helfen. Er selbst habe vormals den Beruf eines Haar- und Bartkünstlers in seiner Vaterstadt geübt und sei den Mitbürgern nur als der rote Lutz bekannt gewesen, denn die Nacht der Unwissenheit habe noch schwer auf ihm gelastet. Erst in Florenz habe er den Namen seines Ahnherrn wieder angenommen und sei »antik« geworden.
»Was ist das?« fragten alle wie aus einem Mund.
Der Rote leuchtete auf, denn er war jetzt ganz in seinem Fahrwasser, und er bemühte sich, seinen Zuhörern eine fassliche Erklärung des Wortes zu geben.
Das Antike, bedeutete er sie, sei die schöne Manier in Sprache und Gebärden, die von den Alten stamme und in Florenz zur Bildung und guten Sitte unentbehrlich sei. Dazu gehöre vor allem auch eine Hauseinrichtung im Stile der alten Römer, und nun beschrieb er den sprachlos dasitzenden Kriegsknechten die Gastmähler seines Herrn, wobei die Geladenen mit bekränztem Haupt sich nicht zu Tische setzten, sondern legten, während er nach dem Takt der Musik das Essen auftrage und das Fleisch zerschneide; denn so verlange es der römische Brauch. Ehe das Mahl beginne, sprenge sein Herr eine Schale vom besten Wein auf den Boden, als Weiheguss für die alten Götter, die in Marmor herumstünden, und spreche einen lateinischen Vers dazu, und das alles, wenn es mit der schönen Art gemacht sei, nenne man antik.
Die Knechte stießen sich heimlich mit den Ellbogen an, und Peter sagte, sich bekreuzend: »Straf mich Gott! Das ist ja heidnisch; seid ihr denn keine Christen?«
Lucius entgegnete mit nachsichtigem Lächeln: »Freilich; aber die heilige Jungfrau und den Bambino in Ehren, diese Gebete an die alten Götter gehören zum Ganzen, zum Stil und zur Einrichtung, mit einem Wort zum Antiken, und selbst der Heilige Vater hält es nicht anders.«
Nun fuhr er in seiner Lebensgeschichte fort und erzählte, wie in seine Barbierstube häufig ein fahrender Schüler gekommen sei, der unter dem Seifenschaum lateinische Verse zu deklamieren pflegte, und wie er auf diese Weise ein schön Stück Latein und viele Verse aus einem Gedicht kennengelernt habe, das von den Irrfahrten des Trojerhelden Äneas handle. Da sei die Wanderlust so mächtig in ihm geworden, dass er sein Handwerk an den Nagel hängte und in Diensten eines Kaufmanns nach der Levante zog. Dort geriet er aber durch den Tod seines Herrn in großes Elend, sodass er wieder zu seinem früheren Handwerk greifen und viele Türkenbärte scheren musste, bis ihm eines Tages ein welscher Bart unter die Hände kam, der einem edlen Florentiner angehörte. Dieser erkannte aus der blumenreichen, von Zitaten wimmelnden Sprache seines Barbiers, dass solch ein Mann zu etwas Höherem geboren sei, und nahm ihn von der Baderstube weg in seine Dienste. Der Florentiner war nach dem Fall von Konstantinopel in die Levante gekommen, um in kleinasiatischen und griechischen Klöstern auf alte Manuskripte zu fahnden, und da sich Lucius ebensowohl auf die türkische wie auf die fränkische Sprache verstand, musste er bei diesen Unterhandlungen den Dolmetsch machen. Sein Herr richtete ihn mit der Zeit auf alte Klassiker ab, wie einen Falken auf den Reiherfang.
Als sie nun schon einige hundert Bände gesammelt hatten und mit der kostbaren Fracht die Rückreise nach dem Abendland antreten wollten, litten sie im Ägäischen Meere Schiffbruch und mussten es ansehen, dass all die kostbaren Bücher, die ein ganzes Vermögen verschlungen hatten, in den Wellen versanken.
Bettelarm kehrte der Florentiner in seine Heimat zurück und starb da an gebrochenem Herzen, hatte aber zuvor noch den getreuen Lucius bei Bernardo Rucellai, seinem besten Freunde, untergebracht.
Dies alles berichtete der Rothaarige seinen Zechgenossen mit manchen Ausschmückungen und großem Schwulst, zuweilen seine Rede mit einem lateinischen Spruch durchflechtend. Auch machte er viel Rühmens von dem Ansehen und Reichtum seines Herrn und vor allem von den unermesslichen Bücherschätzen, um deretwillen aus der ganzen Welt viel vornehme und gelehrte Männer im Hause Rucellai zusammenströmten, und er suchte dem stumpfsinnig dreinblickenden Peter den Wert solcher Sammlungen begreiflich zu machen.
Dem aber war der ungewohnte welsche Wein zu Kopf gestiegen, und die Ruhmredigkeit des Roten begann ihn zu verdrießen. Er schlug auf den Tisch und rief herausfordernd: »Und mein Herr ist doch noch ein viel größerer Herr, das sag ich. Der schlägt mit der gepanzerten Faust einen Ochsen nieder, und den stärksten Ritter hebt er aus dem Sattel, als ob es ein Strohmann wäre. Acht Wölfe hat er einmal an einem Tag erlegt, und die Dienste, die er dem Hause Württemberg bei der Mühlhäuser Fehde geleistet, wird ihm der Graf gewiss zeitlebens nicht vergessen. Und was den Reichtum betrifft, so brauche ich nur die Burg Stauffeneck zu nennen, mit Dörfern, Wäldern und Äckern, und die Herrschaften im Oberland, gar nicht zu reden von den kleineren Höfen und Weilern zwischen Staufen und Rechberg, die ihm zinspflichtig sind. Es lebt kein besserer Ritter im ganzen römischen Reich, und wer’s nicht glaubt, der hat mit mir zu tun.«
Die anderen Kriegsknechte ließen ein beistimmendes Murmeln vernehmen.
»Ich glaube es ja gern, ihr Herren«, begütigte Lucius. »Aber seht: Andere Völker, andere Sitten! wie der Lateiner sagt. Bei uns gilt der Mann mehr nach dem Kopf als nach der Faust, und eine schöne Bücherei hat größeren Wert als Schlösser und Burgen. Da ist zum Beispiel Herr Marcantonio, das alter ego meines Gebieters; nun, wer ihn sieht, der muss bekennen, dass die Göttin der Liebe nicht an seiner Wiege gestanden hat, und dennoch darf er um das schönste Mädchen von Florenz, um unsere Lucrezia, werben, und meine alten Augen werden es noch erleben, dass Hymens Fackel ihnen den Brautgesang tönt. Das kommt daher, dass er vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben hat, ein lateinisches Buch« – Lucius dämpfte seine Stimme zum Flüstern, als ob er sich in der Nähe des Allerheiligsten befände – »seit den großen Alten sei nichts Schöneres geschrieben, sagt Seine Magnifizenz, der erlauchte Lorenzo, der nicht nur ein Kenner ist, sondern auch selber den Pelikan besteigt.«
Er sah sich im Kreise nach Beifall um, fand aber nur gleichgültige Gesichter.
»Bücher«, sagte Peter wegwerfend, »die wachsen bei uns wie Unkraut, aber wir fragen nichts danach, denn das ist für die Klerisei, nicht für Kriegsleute. Mein eigener Herr hat eine großmächtige Truhe voll von dem Zeug in seinem Keller stehen und hat sich in seinem Leben noch nicht nach ihr gebückt.«
Der Rothaarige stieß einen Laut der Überraschung oder des Zweifels aus.
»Ich weiß, was ich sage!« rief Peter, sich erhitzend, »ich habe sie selbst gesehen, denn ich bin einmal, es ist schon lange her, in unseren Burgkeller auf Schloss Stauffeneck heimlich eingestiegen. Ich hatte einen störrischen Hengst im Burghof getummelt, dass er und ich von Schweiß troffen, denn es war ein heißer Sommertag. Da bemerkte ich nicht weit von dem großen runden Turm ein Loch im Boden, durch das man in den Keller hinabsehen konnte, und der Quaderstein an dieser Stelle war losgebröckelt, denn es ist ein gar altes Gemäuer. Ich, nicht faul, hebe den Stein aus und drücke mich durch die Öffnung hinunter. Es war ein übler Weg, wie ihr euch denken könnt, und ich kam halb geschunden auf dem feuchten Boden an, aber ich hoffte einen tüchtigen Schluck zu tun, denn mir schien’s, als sei hier der Weg zum großen Fass. Aber ich befand mich in einem engen Bretterverschlag und konnte nur durch die Latten nach den schönen Wein- und Mostfässern hinüberschielen. Durch einen engen Gang aber kam ich in ein anderes ausgemauertes Gelass und stieß dort auf eine große eiserne Truhe. Da fiel mir ein, was ich einmal gehört hatte, dass in diesem Gewölbe der Klosterschatz von Sankt Blasien vergraben sei, und ich sah mich um, ob nicht auch in einer Ecke der Hund mit den feurigen Augen sitze, der die Truhe hüten soll. Aber da war nichts Lebendiges außer mir. Also, ich gehe hin und hebe den Deckel auf, und was glaubt ihr, dass ich drinnen fand? Vergoldete Altarleuchter und silberne Becher? – Ja, wisch dir den Mund ab! Lauter verschimmeltes Schweinsleder mit Krackelfüßen darauf und mit farbigen Bildchen am Rand. Ich, wieder zugeklappt und nicht gemuckst von dem Fund, denn wer hätte auch etwas davon gehabt? Ja, wären es harte Taler gewesen! Dort muss die Bescherung noch liegen, und es hat kein Hahn danach gekräht bis auf den heutigen Tag. Was das Ungeziefer übrig lässt, das frisst der Schimmel. Unser Junker weiß gar nichts davon, der Unrat stammt noch aus des Herren selig Zeit, der hatte es mit den Mönchen.«
Hier aber ward Peter unterbrochen durch eine Stimme, scharf und schneidend wie ein Peitschenhieb, die seinen Namen rief. Er stolperte eilig die Treppe hinauf in das Zimmer seines jungen Herrn, der eben vom Gastmahl des Mediceers zurückkam, denn er wusste, dass es nicht rätlich war, den Gestrengen auch nur eine Minute warten zu lassen. Als er dessen Befehl entgegengenommen hatte und zu dem neuen Freund zurückkehren wollte, war dieser schon davongeeilt, um seinem Gebieter von dem merkwürdigen Bücherfund des neuen Gegenüber zu berichten.
Der junge Ritter stand am Fenster und blickte unruhig nach der säulengetragenen, ganz von kleinen schwefelgelben Schlingröschen umrankten Halle hinüber, wo ihm beim Eintritt jene flüchtige reizende Erscheinung aufgetaucht war. Er gedachte eines Auftrags, den ihm seine jugendliche Landesmutter auf die Reise mitgegeben hatte. Wenn ihr Herr Veit eine rechte Freude machen wolle, hatte sie gesagt, so möge er von Italien, wo es der schönen Mädchen viele gebe, die schönste, die er finde, nach Hause bringen als seine eheliche Wirtin, damit Frau Barbara auch in ihrem Residenzschloss zu Stuttgart die Laute der geliebten Muttersprache vernehme.
*
Veit, der in Gräfin Barbara das Muster der Frauen verehrte, hatte seit dem ersten Schritt auf italienischem Boden keinen anderen Gedanken mehr, als ein Weib zu finden, das der anmutigen Gebieterin gleiche. Aber je länger er suchte, desto schwieriger fand er die Wahl. Von einer stolzen Visconti, die ihm beim Einzug in Verona mit ihrem fürstlichen Brautgeleite wie die Königin von Saba begegnet war, bis herab zu der anmutigen Spinnerin in Holzschuhen, die es ihm auf den Apenninen angetan hatte, wollte sein Herz gar nicht mehr zur Ruhe kommen, und er bekannte seinen Reisegefährten, dass er Muselmann werden und einen ganzen Harem nach Hause bringen müsste, um den Auftrag seiner Herrin richtig zu vollziehen.
Doch in Florenz ereilte ihn sein Geschick, denn seit ihm Bernardo Rucellais Tochter jenes Röslein zugeworfen hatte, war ihm alles weitere Schauen leid und widrig geworden, er hätte am liebsten die Augen schließen mögen, um dieses Bild durch keine anderen Bilder mehr verwischen zu lassen. Er fand, dass sie der Gräfin gleiche, nur war ihr Wuchs höher und schlanker, und ein Liebreiz ging von ihr aus, der in des Junkers Augen alles übertraf, was er bis jetzt gesehen hatte. Er brauchte sich nicht zu fragen, ob Lucrezia Rucellai auch wirklich die Schönste sei, denn sie war gleich bei dem ersten Blick für ihn die Einzige geworden. Ihren Namen hatte er durch einen der Florentiner Herren, die den Zug geleiteten, erfahren, aber mehr wusste er nicht von ihr, und jetzt fühlte er sich zum ersten Male etwas verzagt, wenn er bedachte, dass die Besitzer dieses Kleinods doch wohl schwerlich auf einen wildfremden Landfahrer gewartet hatten, um es loszuschlagen.
Die kleine Entfernung von seinem Fenster zu ihrem Hause bedeutete also wohl eine unüberschreitbare Kluft, und dennoch lächelte der junge Mann leise vor sich hin, während seine Fantasie eine bunte Brücke in den Farben des Regenbogens hinüberbaute.
Da ging drüben am Hause, das mit der Loggia verbunden war, die Türe auf, und heraus trat zu Veits froher Überraschung Johann Reuchlin, Graf Eberhards jugendlicher Geheimschreiber, geleitet von jenem schönen würdevollen Greis im Silberhaar, den Junker Veit neben dem Mädchen erblickt hatte, und er sah, dass die beiden sich auf der Schwelle herzlich wie alte Freunde verabschiedeten.
Veit sprang mit klirrenden Sporen ungestüm die Treppe hinab, um den Geheimschreiber an der Straßenecke zu stellen und über die Bewohner jenes Hauses zu befragen. Da erfuhr er, dass der würdevolle alte Herr Bernardo Rucellai heiße, ein Stern des Humanismus sei, durch Familienbande dem Herrscherhaus verknüpft und zugleich naher Anverwandter jenes berühmten Marcantonio Rucellai, den die gelehrte Welt als den glänzendsten neulateinischen Autor verehre.
»Leider musste ich dem alten Herrn eine schmerzliche Enttäuschung bereiten«, fuhr der Geheimschreiber fort. »Er hatte gehofft, ich würde ihm ein einzig vorhandenes Manuskript zur Stelle schaffen, einen uralten Cicero, auf den die Rucellai seit dreißig Jahren fahnden. Doch meine Bemühungen waren vergeblich, und nun schmerzt es mich, dass der alte Herr wohl im stillen denken mag, ich habe den kostbaren Kodex auf die Seite gebracht, denn leider, Junker, gibt es unter Gelehrten weder Treu noch Glauben, sobald ein alter Autor auf dem Spiele steht.«
Der Junker hörte diesen Erklärungen nur mit halbem Ohre zu, denn ganz anderes lag ihm am Herzen als der alte Herr mit seinen literarischen Nöten.
»Habt Ihr auch seine Familie kennengelernt, Herr Geheimschreiber?« fragte er zögernd.
»Herrn Marcantonios Bekanntschaft ist mir auf morgen versprochen«, entgegnete Reuchlin nicht ohne eine kleine Bosheit, fuhr aber, als er die unbefriedigte Miene seines Reisegenossen sah, gleich gutmütig fort: »Für euch hat wohl der Autor der ›Facetien‹ mindere Anziehungskraft als Herrn Bernardos schwarzäugiges Töchterlein. Nun, diese werdet Ihr morgen bei dem Lanzenrennen sehen, das Seine Magnifizenz zu Ehren unseres Herrn veranstaltet. Ich höre soeben, dass Fräulein Lucrezia den Sieger krönen soll. Wenn also Euer bewährter Ruhm Euch treu bleibt, so werdet Ihr meine Wenigkeit morgen nicht mehr zu beneiden brauchen. Und nun, verzeiht, ich muss noch zu unserem Herrn, der mich hier schlecht entbehren kann. Gute Nacht, Herr Ritter, und mögen Euch die Sterne günstig sein.«
Mit diesen Worten ging der Geheimschreiber eiligst von dannen.
Das glänzende Kampfspiel war zu Ende, und Herr Bernardo hatte sein bewundertes Töchterlein zu Pferd durch die gaffende Menge nach Hause begleitet. Ihr reiches Festkleid lag schon wieder im Schrein, und Lucrezia war in die einfache Haustracht geschlüpft, die ihr nicht minder lieblich stand. Der Tag war nicht erschöpfend gewesen, denn die Sonne hatte sich wie aus Mitleid mit den eisenbeschwerten Reitern während des Turniers verborgen gehalten, dennoch brannten Lucrezias Wangen, und ihre Augen strahlten einen Glanz aus, vor dem sie im Spiegel selber erschrak. Eine Stimme lag ihr in den Ohren, die sie heute zum ersten Male gehört hatte, aber nie wieder vergessen zu können glaubte, deren Klang sie noch in der Einsamkeit wie mit körperlicher Gegenwart umschwebte.
»Möchte es nicht das letzte Mal sein, dass meine Augen Euch erblicken!« murmelte sie vor sich hin, und suchte den fremdartigen Ton der Stimme nachzuahmen, die diese Worte gesprochen hatte. Sie musste sich dabei ein bräunliches, wohlgeformtes Gesicht vorstellen, das unter dem hohen Helm mit Rehgeweih zuversichtlich zu ihr aufblickte. Sie hörte wieder das Stampfen und Wiehern der Pferde, sah das funkelnde Waffengewühl und den Staub der Arena und folgte unverwandt jenem Helme mit Rehgeweih, der blitzartig da und dort auftauchte, alle anderen Helmzeichen weit überragend. Es waren schlankere, schönere Gestalten auf dem Kampfplatz als dieser Fremdling und Halbbarbar, dessen herkulischer Kraft auch von den eigenen Landsleuten keiner ganz gewachsen war, aber die Menge schien den blonden Deutschen vor allen anderen zu bevorzugen, denn sie grüßte sein Erscheinen immer mit hellem Jubel. Lucrezia wusste selber nicht, warum ihre Augen suchend umherliefen, sobald das Rehgeweih verschwand, und wie es kam, dass sie keinem Gang mit rechter Aufmerksamkeit folgen konnte, an dem der Träger dieses Zeichens nicht beteiligt war. Wenn er als Sieger vor ihr erschien und seine Augen fest auf die ihrigen heftend leise sagte: »Nicht zum letzten Male, Madonna!« so wünschte sie ihn beklemmt und unruhig weit hinweg, sobald er sich aber vom Kampfplatz entfernte, hatte das ganze Schauspiel seinen Reiz verloren. Für die Artigkeiten ihrer Landsleute, die wie immer mit übertriebenen Huldigungen nicht kargten, hatte sie heute nur eine Regung der Ungeduld, weil ihr dadurch der Magnet ihrer Augen entzogen ward.
Als nun endlich der letzte Gang, das große und nicht gefahrlose Lanzenrennen begann und sie auch den Rechberger wieder in die Schranken reiten sah, siegesgewiss den Hals seines starken Tieres klopfend, da wartete sie mit solcher Unruhe auf die Entscheidung, als wäre sie selbst als letzter und höchster Kampfpreis gesetzt. Sie hatte keinen Sinn für all den Aufwand von Waffenkunst, der vor ihren Augen entfaltet wurde, sie nahm keinen Teil an der brennenden Frage, ob die Barbaren ihren Landsleuten an Stärke überlegen seien, und ob die Florentiner wiederum jene an Gewandtheit überträfen, es beschäftigte sie nicht einmal, dass der fremde Graf mit der dunklen Kleidung und dem ernsten Gesicht sich diesmal selbst mit einem der Florentiner Herren maß; sie verfolgte immer das Rehgeweih und den Schild mit den züngelnden Rechbergischen Löwen. Sie meinte noch in der Erinnerung die Gewalt der Stöße, das Splittern der Schäfte, das grausame Aufeinanderprallen der Pferde zu vernehmen und das ängstliche Klopfen ihres eigenen Herzens, bis der Herold als Sieger den blonden Deutschen mit dem unaussprechlichen Namen verkündete und die Bühne von dem Jauchzen, Stampfen und Tücherschwenken der Menge wankte. Ihre Blicke hatten sich umflort und ihre Hände gezittert, als sie ein Kränzlein lebendiger Rosen mit goldenen Blättern an der Lanzenspitze des Junkers befestigte, und es war ihr, als habe sie mit diesem Kränzlein das eigene Ich hinweggegeben. Er aber lächelte siegesfroh, blickte ihr mit den guten blauen Augen fest ins Gesicht und sagte mit seinem fremden Akzent: »Madonna, ich hoffe, Euch wiederzusehen.«
Ein Florentiner hätte sich schwungvoller und zierlicher ausgedrückt, aber die stete Wiederholung der schlichten Worte, als ob der Sprecher nichts zu denken noch zu sagen vermöge als nur das eine, den Wunsch, sie wiederzusehen, hatte sie erschüttert und erschreckte sie zugleich mit der Ahnung, dass diese unwiderstehlich starken Arme nun auch sie ergreifen und nicht wieder freigeben würden. Doch während sie sich gegen diesen Zwang zu wehren suchte, freute sie sich selbst im stillen, dass heute Abend der unaussprechliche Name des Fremdlings in aller Munde war, als ob sie selber an seinem Triumph einen Teil hätte.
Gleichzeitig ereignete sich der seltsame Fall, dass des Vaters Gedanken nicht minder lebhaft mit dem anziehenden Fremdling beschäftigt waren als die der Tochter; freilich aus sehr verschiedenem Grund. Seit er die Nachricht von jenen vergrabenen Bücherschätzen auf Schloss Stauffeneck erhalten hatte, war in Bernardos Seele die fast abenteuerlich kühne Hoffnung aufgekeimt, dass der verschwundene Kodex vielleicht mit in jener Truhe liege. Es war zuerst nur eine Eingebung des roten Lutz gewesen, die der Gebieter selbst belächelte; aber in langer Nacht hatte er die Ortsnamen, die fest in seinem Gedächtnis hafteten, mit den Angaben über den letzten Verbleib des Manuskriptes verglichen, und zu seiner eigenen Überraschung stimmten sie wunderbar. In seinen schlaflosen Grübeleien hatte er noch dem Zweifel Raum gegönnt, aber am Morgen, als die freudigen Lichtfluten durch das Fenster strömten, öffnete er sein Herz der frohen Überzeugung, dass es der Schatten des großen Römers selber sei, der aus dem Munde eines barbarischen Kriegsknechts um Erlösung flehe.
Herr Bernardo war vor allen Dingen Humanist, und die Leidenschaft für das klassische Altertum erstickte in ihm jede andere menschliche Empfindung. Darum konnte auch Lucrezia kein Herz zu ihrem Vater fassen, obwohl sie nie ein ungütiges Wort von ihm zu hören bekam, aber er schien ihr glatt und kühl wie ein Aal, und wenn er einmal zärtlich wurde, so hatte sie den Eindruck, als sei es ihm nur um die wohltönenden Reden zu tun, die leicht und elegant von seinen Lippen strömten.
*
In seinem Studierzimmer saßen an den Winterabenden die Mitglieder der Platonischen Akademie unter einer Marmorbüste Ciceros beisammen, der Herr Bernardos stärkster Heiliger war und dem er ein ewiges Lämpchen unterhielt, wie sein Freund Marsilio Ficino dem Plato. Jahraus jahrein arbeiteten die besten Meister der Goldschmiedekunst an seinem berühmten, den antiken Mustern nachgebildeten Tafelgeschirr; er selbst trug im Hause statt des Florentiner Lucco eine römische Toga und bewegte sich mit dem Anstand, der diesem Gewande entsprach. Er redete niemals mit Heftigkeit, noch ließ er je eine Erregung des Gemütes blicken, sodass er zu jeder Stunde an jene römischen Senatoren gemahnte, die in ihren kurulischen Stühlen sitzend das Herannahen des Galliers erwarteten. Sein Sprechen war so gewählt, dass er nie einen Satz unvollendet ließ, und dass jede seiner abgerundeten Perioden für eine vollkommene Stilübung gelten konnte. Im Latein, das dazumal die höhere Umgangssprache war, legte er sich lieber den Zwang auf, seinen Gesprächsstoff zu beschränken, als ein Wort zu gebrauchen, welches nicht durch die Autorität Ciceros gedeckt war. Und diesem Manne, der so hoch und sicher im Leben stand, dessen Söhne die ersten Ehrenposten des Staates bekleideten, fehlte nur eines zur Zufriedenheit, dieses eine aber fehlte ihm so sehr, dass es ihm fast die anderen Güter entwertete, nämlich jener uralte, ciceronianische Kodex, dessen Trugbild ihm soeben aufs neue zwischen den Händen zerronnen war.
Dieser Kodex hatte im Haus der Rucellai schon eine schicksalsschwere Rolle gespielt. Zuerst war es Donato Rucellai, Bernardos älterer Bruder, gewesen, der vor mehr als dreißig Jahren bei einem Besuch auf der Insel Reichenau den kostbaren Fund getan. Der damalige Abt befand sich häufig in Geldverlegenheiten und wäre gerne bereit gewesen, das Buch zu verkaufen, aber er tat, als er das Entzücken des Entdeckers sah, eine so ungeheure Forderung, dass der Italiener mit leeren Händen abziehen musste, denn eine Abschrift zu nehmen wurde ihm nicht gestattet.
Doch sein Verzicht ließ Herrn Donato keine Ruhe. Er verkaufte ein Landgut, legte die Summe bei einem deutschen Barkhaus nieder und begab sich wieder auf die Fahrt. Unterdessen hatte aber das Manuskript den Besitzer gewechselt, da es pfandweise in ein württembergisches Kloster übergegangen war. Landfremd, der Sprache nur zur Not kundig, und im ärmlichsten Aufzug, um keinem Wegelagerer zur Beute zu fallen, verfolgte der weichliche Humanist unter schweren Mühen und Entbehrungen die Spuren eines Schatzes, die ihn bis tief in den Schwarzwald führten.
Dort stand unter endlosen finstern Tannenwäldern, die dem lichtgewohnten Sohne des Südens wie die Pfade der Unterwelt erschienen, das ehrwürdige Kloster Hirsau – in italienischem Munde Irsava gesprochen. In dieser Abtei war Donato zum letzten Male gesehen worden, denn ein anderer italienischer Manuskriptensammler hatte ihn dort getroffen, als der Unermüdliche eben im Begriffe stand, nach einem Klösterlein des heiligen Blasius im Osten des Landes, nicht gar weit von der alten Staufenfeste, aufzubrechen, wohin ein Hirsauer Bruder den kostbaren Kodex verschleppt haben sollte.
Dies war die letzte Kunde, die von Donato Rucellai nach Florenz drang, und der edle Gelehrte war nie in seine Heimat zurückgekehrt. Nachfragen wurden angestellt, aber sie brachten nur zutage, dass jenes Klösterlein, welches Donatos letztes Reiseziel gewesen, durch eine Feuersbrunst vom Boden verschwunden sei. Es war damals viel Krieg und Fehde in schwäbischen Landen, wobei man es mit Menschenleben nicht sehr genau nahm, und von dem Tiefbetrauerten wurde niemals wieder eine Spur gefunden.
Jahrelang war nun auch der Kodex verschollen, und die Familie der Rucellai hatte vor Ciceros irrem Geist Ruhe. Da kam vor nunmehr sieben Jahren ein reisender Kaufmann nach Florenz und berichtete, im suevischen Lande habe man eine uralte Handschrift aus dem neunten oder zehnten Jahrhundert entdeckt, welche allem Anschein nach der von den Rucellai gesuchte Cicero sei. Ein Kleriker sei sein jetziger Besitzer; derselbe verlange einen so hohen Preis für das einzig vorhandene Manuskript, dass er es im Lande nicht losschlagen könne und dass er deshalb in Italien einen Käufer suche.
Wie der Keim einer Seuche, der jahrelang verschlossen gelegen, plötzlich wieder an die Luft treten und aufs neue eine Ansteckung bewirken kann, so ging es hier. Das Gift der Bibliomanie kroch in Herrn Bernardos Adern und entzündete jetzt in ihm jenes fieberhafte Verlangen nach Ciceros liber jocularis, dem sein unglücklicher Bruder zum Opfer gefallen war. Sein Anverwandter, Marcantonio Rucellai, der damals noch ein unberühmtes Dasein führte, erbot sich, das Buch durch einen tüchtigen Agenten, den er für den Ankauf und das Kopieren alter Manuskripte in den alemannischen Landen geworben hatte, zur Stelle zu schaffen. Doch nach Jahresfrist kehrte der Agent mit dürftiger Ausbeute nach Florenz zurück, denn die Zeit der großen Bücherfunde war vorüber, und die Nachricht jenes Reisenden hatte sich, wie Marcantonio seinem Blutsfreund berichten musste, einfach als Fopperei erwiesen.
Aber der ciceronianische Kodex umspann den edlen Bernardo bereits mit einem dämonischen Zauber, und auch die ungesühnten Manen seines Bruders, dessen Gebeine vielleicht unbestattet auf fremder Erde lagen, drängten sich wieder klagend vor seinen Geist.
Auf Reuchlin stützten sich nunmehr seine Hoffnungen, aber ach, seit Donatos Verschwinden waren dreißig Jahre verflossen, und der weise Kapnion gehörte einer anderen Generation an als die deutschen Gelehrten, die einst dem edlen Florentiner auf seiner Reise mit Rat und Tat beigestanden hatten. Wie sollte man nach so langer Zeit noch von einem verschollenen fremden Wanderer und von einem längst niedergebrannten Klösterlein, dessen Lage ungewiss und dessen Name kein seltener war, Nachricht erlangen? Bernardo begriff es wohl, aber dennoch konnte seine Fantasie von dem liebgewordenen Gegenstand nicht mehr lassen, und erregt durch die wieder aufgerührten Erinnerungen knüpfte er an die Prahlereien des alemannischen Knechtes alsbald den neuen Hoffnungsfaden an.
Die folgenschwere Mitteilung war ihm gestern erst nach Weggang seines Besuches gemacht worden, und so lag es ihm sehr am Herzen, den neuen Freund so rasch wie möglich ins Vertrauen zu ziehen und für die Förderung seiner Absichten zu gewinnen. Doch Reuchlin war während des Kampfspiels durch seine Dolmetscherpflichten so sehr in Anspruch genommen, dass er für die sehnsüchtigen Blicke Bernardos kein Verständnis hatte, und erst als die Herrschaften sich zum Aufbruch rüsteten, war es dem alten Herrn noch rasch gelungen, sich mit seinem Anliegen an den Geheimschreiber heranzudrängen.
Zu Hause trat er gleich an sein Fenster und starrte mit den brünstigen Augen eines Liebhabers nach den geschlossenen Läden gegenüber. Die niedergehende Sonne setzte den ganzen Himmel in Flammen, und Bernardo Rucellai erblickte eine selige Vision, schön wie der Ruhm und die Unsterblichkeit; die farbendurchglühten Abendwolken zeigten ihm in purpurnen, dunkelvioletten und goldenen Lettern die Schrift: M. T. Ciceronis liber jocularis nunc primum repertus et in lucem editus.
Aus seiner Verzückung schreckte ihn Hufschlag auf dem Pflaster, und das Herz begann ihm zu klopfen wie einem Mägdelein beim Herannahen des Geliebten. Es war aber nicht Junker Veit von Rechberg, der sein Pferd um die Ecke lenkte, sondern der erlauchte Lorenzo selbst, und in der muntersten Laune, wie es schien, denn er winkte schon von weitem herauf mit einem feinen Lächeln, das ein schalkhaftes Geheimnis barg. Die ganze Dienerschaft steckte die Köpfe zusammen, als gleich darauf der alte Herr mit der Miene würdig verhaltener Neugier seinen erhabenen Besucher, der nicht aufhörte zu lächeln, die Treppe herauf nach seinem Studierzimmer führte. Auch Lucrezia sah den Herrscher eintreten, der ihr Pate war, denn sie stand gleichfalls am Fenster und blickte in den brennenden Abendhimmel, aber für sie hatte das magische Farbenspiel eine andere Bedeutung als für ihren Vater: in den Umrissen der segelnden Goldwölkchen meinte sie ein blondes germanisches Haupt zu erkennen. Ahnung sagte ihr, dass etwas Außergewöhnliches im Anzug war, und etwas, das sie selbst betraf. Sie wollte sich zur Ruhe zwingen und zur gewohnten Beschäftigung, aber keine Arbeit glückte, sie war unfähig selbst zu der geringsten Verrichtung und musste sich, von Zimmer zu Zimmer irrend, dem qualvollen Zustand dieser rastlosen Muße ergeben.
Endlich brach Lorenzo auf, und der Vater geleitete ihn bis vor die Schwelle des Hauses. In sein Arbeitszimmer zurückgekehrt, schloss sich Bernardo ein und schritt lange gegen seine Gewohnheit aufgeregt hin und her. Nach geraumer Zeit kam er endlich heraus, ging in den Büchersaal, und Lucrezia sah von der halboffenen Türe aus, wie er in der Dämmerung ein in karmesinrotes Leder gebundenes Buch vom Schranke nahm. Er schlug auf gut Glück auf und trat dann an das Fenster, um bei dem schwindenden Tageslicht die Stelle zu entziffern, die sein Finger bezeichnete. Jetzt wusste Lucrezia, dass der Vater eine schwere Entscheidung seinem Virgil anheimgestellt hatte.
Bei Tisch jedoch zeigte Bernardo sein gewöhnliches undurchdringliches Gesicht und die olympische Ruhe, die ihm stets ein so großes Übergewicht über die Umgebung verlieh. Er scherzte mit Lucius, der die Bedienung der Tafel überwachte, und sprach so schön und gewählt wie immer, während seine Tochter keinen Bissen genoss. Endlich nach einer qualvoll langen Stunde wurde unter den üblichen Förmlichkeiten die Tafel aufgehoben, und nachdem der Vater noch langsam und wohlbedacht die zu der Gesundheitspflege nötigen tausend Schritte abgeschritten hatte, ließ er die Tochter in sein Studierzimmer rufen, das die schwebende Ampel jetzt freundlich erleuchtete, während die Fenster und Innenläden gegen Nachtluft und Zanzaren1 verschlossen waren.
Dort empfing sie die Mitteilung, dass der fremde Graf ihr die Ehre angetan habe, durch Seine Magnifizenz um ihre Hand für jenen jungen Ritter zu werben, der bei den Kampfspielen so große Ehren gewonnen habe.
Lucrezia saß auf einem kleinen Schemel zu Füßen des Vaters und rang nach Atem, während er ruhig fortfuhr, ihr die Vorteile dieser Heirat und die ehrenvolle Stellung, der sie am Hofe der Gräfin Barbara entgegenging, zu erklären.
»Ich will dir nicht verhehlen, dass mich die Werbung erschüttert hat«, sprach er, langsam die Worte wägend, »denn ich hatte anderes mit dir im Sinne. Aber es gibt höhere Pflichten als die des Blutes. Wenn nicht alle Zeichen trügen, so ist dieser junge Barbar der jetzige Besitzer der Handschrift, nach der wir seit dreißig Jahren suchen. Ich will nicht davon reden, was dieser Fund für mich bedeutet, noch dass dein Oheim sein Leben dafür gelassen hat. Aber denke an die Wissenschaft und die ganze Gesittung unserer Tage. Ein Cicero! Sein liber jocularis! Denke, was es heißen will, diesen Genius, den wir in der Ruhe, im Zorn, in der Begeisterung bewundert haben, jetzt auch im feinen attischen Scherz, in der munteren Weinlaune kennenzulernen! Nicht mehr als feurigen Redner oder als Philosophen, nein, als geselligen Tischnachbarn, mit Cajus und Titius über Alltagsgegenstände plaudernd, doch voll köstlichen Salzes, voll feiner Worte und Wörtchen!« Herr Bernardo schloss die Augen und machte ein Gesicht, als ob er Kaviar auf der Zunge zergehen lasse.
»Ich brauche nichts weiter zu sagen, du bist unterrichtet genug, um zu wissen, was auf dem Spiele steht. Der Schatz ist reif, wenn wir ihn nicht heben, so versinkt er vielleicht auf ewig in den Schoß der Erde. Ein Cicero!«
Längst war sein etwas gekünsteltes Sprechen in den Ton wahrer Empfindung übergegangen. Jetzt riss ihm der Faden entzwei, er schlug die Augen zum Himmel und wiederholte mit inniger Andacht: »Liber jocularis! Liber jocularis!« indes zwei Tränen langsam über das ehrwürdige Gesicht niederrannen.
Lucrezia schwieg noch immer. Die Entscheidung war so jählings über sie gekommen, dass sie völlig überwältigt war. Erst nach einer langen Pause sagte sie stockend: »Habt Ihr Eure Zusage gegeben?«
»Er wird sie sich morgen holen. Sie ist an eine Bedingung geknüpft, die du errätst. Er kläre das dunkle Ende deines Oheims auf und bringe mir den Kodex. Am Tage, wo Ciceros liber jocularis unversehrt vor meinen Augen liegt, wird er dein Gatte, es sei ihm geschworen.«
Jetzt erst bemerkte er, dass seine Tochter sich in die Fensternische geflüchtet hatte und heftig schluchzend ihren Kopf an den geschlossenen Laden drückte.
Er trat zu ihr, streichelte ihren schwarzen Scheitel und suchte sie zu trösten, indem er ihr wiederholt erzählte, welch warme Fürsprache der erlauchte Lorenzo für den Junker eingelegt habe, und dass der deutsche Graf ihr ein zweiter Vater sein wolle. Auch legte er kein geringes Gewicht auf die Herkunft des Jünglings, der, wie er der Tochter erzählte, eines Stammes sei mit jenem gewaltigen Schwabengeschlecht, das Italien seine großen Kaiser gegeben habe.
»Soll ich dir noch mehr vertrauen?« fuhr er flüsternd fort. »Du weißt, ich verachte den Aberglauben, aber es gibt ein Orakel, das mich nie getäuscht, das mich immer recht beraten hat. Und siehe, wunderbar! Derselbe Götterspruch, der in Latium an den König Latinus erging, hat heute auch mir geboten, den Fremdling zum Eidam zu nehmen.«