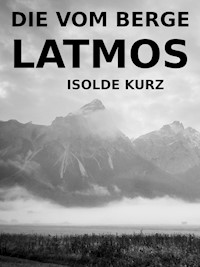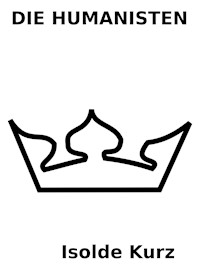Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Florentinische Erinnerungen
Isolde Kurz
Florentinische Erinnerungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-24-9
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die stille Königin
Agli Allori
Edgar Kurz – Ein Lebensbild
Alfred Kurz – Nachruf
Adolf Hildebrand – Zu seinem sechzigsten Geburtstage
In den Marmorbergen – I. Carrara
In den Marmorbergen – II. Serravezza.
Eine Tochter Octavio Piccolomini’s
Erdbebenerinnerungen
Blütentage in Florenz
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Dem brüderlichsten FreundeCarlo Vanzetti in Dankbarkeit zugeeignet
Die stille Königin
Sie sitzt auf ihrem Blumenthron im Lorbeerschatten, das Zepter mit der Lilie in der Hand, und spiegelt ihr schicksalsvolles, aber unverwelkliches Angesicht in dem träumenden Arno, Fiorenza, die stille Königin. Wer kann sie sehen, ohne ihr zu huldigen? Sie nimmt lächelnd deinen Tribut entgegen, aber sie lächelt an dir vorüber, denn sie sieht dich nicht, sie sieht nur die Schattenbilder des Vergangenen. Die stille Königin denkt ewig nur sich selbst. Sie träumt, als ob Gestriges Heute wäre. Sie weiss nicht, dass sie längst ihre Krone verloren hat und nur noch Rosen auf dem Haupte trägt, dass jetzt andre Throne aufgerichtet stehen und andre Königinnen mit lauterem Pompe verehrt werden. Niemand wagt ihr das zu sagen, denn alle, die zu ihr kommen, ehren ihren Traum. Die Etikette verbietet, an ihrem Hofe von anderm als von den Zeiten ihres Glanzes zu reden. Alle italienischen Städte haben ja grosse, überwältigende Erinnerungen, aber Florenz war die Hauptstadt von Genieland, die Wiege der wiedergeborenen Menschlichkeit; nur einmal, im Lauf der Weltgeschichte, dort an den Ufern des Ilyssos, sah die Sonne eine, die schöner war. Darum macht kein Ruhm von heute ihre Pulse schlagen. Man sagt ihr: »Fiorenza, heute Nacht ist Arnold Böcklin in deinen Mauern gestorben.« – Sie antwortet: »Ich habe ihn nicht gekannt.« – »Aber er war ein grosser Maler, Fiorenza!« – »Auch Leonardo ist tot und war ein grösserer.« – Fast ebenso unbewegt steht sie unter ihren italienischen Schwestern. Was soll Fiorenza erschüttern nach allem, was über sie selber hingegangen ist? In ihrem Herzen gibt es keinen Raum mehr für andrer Freuden und Schmerzen. Nicht einmal das Risorgimento hat sie bis in die Wurzeln ihres Seins durchrüttelt. Von Aspromonte rief es herüber: »Garibaldi hat für die Freiheit geblutet!« Sie antwortete aus dem Traum: »Ihr wolltet sagen: Ferruccio.«
Fiorenza hat ein Recht, so stille zu sein, denn ihre Seele ist müde. In ihrer Jugend ist es anders gewesen. Es gab eine Zeit, wo Dante sie mit einer Schwerkranken verglich, die durch Herumwälzen ihre Pein zu lindern sucht. Damals war sie unbeständig wie eine Dirne und eifersüchtig wie eine Rasende. Rings um die schöne Fiorenza her durfte nichts andres schön sein. Die Nachbarstädte wurden zerdrückt und zertreten, je näher, desto grösser der Hass; die Mutterstadt Fiesole musste zuerst dran glauben. Am ärgsten aber trieb sie’s im eigenen Hause. Gefährlich war sie und grausam, sie wusste selbst nicht, was sie tat, wenn der Dämon sie beherrschte. Ihre Edelsten zerfleischte sie, um ihnen heisse Tränen nachzuweinen. Sie schöpfte alle Lüste aus und wand sich dann verzückt unter den Geisselhieben des Busspredigers; doch als die Neuheit ihren Reiz verlor, sprang sie auf und rief die Henker über ihn! Aber alle ihre Sünden hat sie sich verziehen, alle Verbrechen hat sie durch Werke und Taten gesühnt, nur eines nicht. Ihr grösster Ruhm ist ihre ewige Schmach geblieben. Mit einem immer nagenden Wurm im Herzen blickt sie nach jenem Grabe in Ravenna, das ihr nie gehören soll.
Dante! Man kann nicht von Fiorenza sprechen, ohne dass sein Schatten herantritt. Der blosse Klang ihres Namens zieht ihn her. Keiner von allen hat mit so maassloser Leidenschaft an ihr gehangen wie dieser. Dafür ist sie ihm auch auf ewig verfallen und mit ihr die ganze italienische Kultur. Wo ist je ein andrer Dichter so zum Despoten seines Volkes geworden? Für die Sprache, die er seinen Stammesgenossen schenkte, müssen sie seit Jahrhunderten die Montur seines Geistes tragen. Jedes neue Geschlecht findet ihn an der Schwelle des Daseins und empfängt von ihm Form und Richte. Seit dem Trecento zergliedern und erklären sie ihn unermüdlich und kommen doch nie mit ihm zu Ende. Je tiefer man eindringt in italienisches Wesen, desto mehr empfindet man seine Allgegenwart. Gar nicht zu reden von dem offenen Dienste, den ihm die grosse italienische Kunst geweiht hat – auch noch aus den verborgensten Winkeln wie dem symbolischen Schmuckwerk der Mediceerkapellen entziffert jetzt die Forschung versteckte steinerne Dante-Zitate heraus. Wäre der Alighieri ein deutscher Dichter, so hätte man wahrscheinlich längst die schönsten Teile aus seinem Werke zu Nutz und Frommen der Lesebücher und Anthologien herausgebrochen und den Rest der Literaturgeschichte überantwortet. Anders der zeitlose Italiener. Nicht nur, dass ihm die literarischen Umsturzgelüste der germanischen Völker völlig fremd sind (ein Anrennen gegen die Riesengestalt Dantes, wie es so oft gegen Goethe und Shakespeare versucht wurde, gälte der Nation schlechtweg als Sakrilegium, das nie verziehen würde) – auch die abgestorbenen Teile seines Heros will die fanatische Liebe des Italieners nicht opfern. Es mag ein Fehler sein, denn es hindert am Fortschreiten; aber liebt man einen Dichter, wenn man ihn nicht fanatisch liebt? Der Ausländer ahnt gar nicht, bis zu welchem Masse die ganze italienische Kultur mit Dante durchsetzt ist. Kein Provinzblättchen schreibt seinen Leitartikel, kein Schuljunge seinen Aufsatz ohne Dante; selbst ein Kochbuch, das auf sich hält, will einen Dante-Vers an der Stirne tragen. An den Wortklötzen der Divina Commedia beissen sich schon die Kinder ihre Milchzähne aus, und dennoch – das ist das Unerhörte – wird Dante niemals abgedroschen. Die Zeitferne vermehrt nur sein Gewicht: Dante ist den Italienern das Absolute geworden. Der Dante-Kult entbindet sie in ihren Augen von jeder Verpflichtung gegen die andern Grossen. Sie lesen keinen Homer, keinen Shakespeare, keinen Goethe. »Wir haben ja den Alighieri.« Soll man sie für dieses Übermass vergötternder Pietät loben oder tadeln? Müssige Frage. Der grosse Hypnotiseur hält sie in seinen Höllentrichtern fest, weil er der Stärkere ist. Was tut’s, dass seine Weltanschauung tot ist, dass unsre Kultur sich nicht mehr in ihr spiegelt, und dass unser Empfinden sich vor ihr entsetzt? Die Reiche, die er geschaffen hat, bestehen. Sie sind mit so wütender Gewalt ins Dasein gerissen, dass alle Wellen der Zeit sich an ihnen brechen. Er war vielleicht die zwingendste Seele, die je gelebt hat. Das Weltall schuf er sich neu nach seinem Bedarf. So wie er hat nie ein Mensch über den Tod hinaus gehasst und geliebt. Er weidet sich wie seine höllischen Folterknechte an den Martern, in die er seine längst verstorbenen Feinde gebannt hat, und erschauert mit allen Liebesschauern seiner ersten Jugend beim Anblick der verklärten Beatrice. So kann auch ihm der Tod nichts anhaben. Er lebt, weil die Schwingungen seiner Seele immer weiter zittern. Aber am unmittelbarsten, am gegenwärtigsten lebt er in Florenz.
Mancher glaubt diese Stadt zu kennen, weil er von den Uffizien nach dem Bargello und den Mediceergräbern gerannt oder auch ein paar Wochen lang trunken zwischen Fiesole und der Certosa umhergeschwärmt ist. Aber er hat nur sich selbst und sein Ferienglück genossen; der stillen Königin hat er noch nicht den Saum des Mantels berührt. Fiorenza will gesucht sein. Ihre Seele kann der Uneingeweihte nicht einmal ahnen, und auch ihre äussere Schönheit enthüllt sich nicht auf den ersten Blick. Sie siegt langsam durch ihre göttliche Harmonie und wird dem Auge mit den Jahren immer schöner. Durch Licht und Luft nimmt sie dem Stofflichen seine Schwere. Durch ihre wundervollen Verhältnisse gibt sie uns das beruhigende Gefühl, dass die Welt vollkommen sei. Wer sie kennt, dem wird sie das Mass der Dinge.
Welch geistigen Ausdruck hat die hohe Kultur der Jahrhunderte dieser Landschaft aufgeprägt! Menschenhand hat hier die Natur nicht um-, nur ausgestaltet, und die Natur ihrerseits arbeitet am Werke der Menschenhand weiter. Die Villa dort oben scheint nicht auf den Hügel gebaut, sondern als letzte Bekrönung von ihm selbst heraufgeschoben, so vollkommen entsprechen ihre Maasse den seinigen, so eins ist sie mit ihm in der Farbe des Gesteins, und die Zypressen steigen so schrittweise zu ihr hinauf, als habe das alles von jeher zusammengehört. Die lichten Olivenkronen, die wie silberne Schleier hinter dem grauen Gemäuer hervorragen, die rankenden Rosenbüschel, die daran niederfallen, das alles lässt sich nicht umdenken, es sieht aus, als könnte es nicht anders sein. Wundersam ist hier der Stiltrieb der Natur: auch das misslungene Neue, wenn es sich nur nicht allzu aufdringlich gebärdet, ist in kurzem eingereiht und so getönt, dass es nicht mehr störend herausfällt. – Keine Waldung schliesst das reizende Landschaftsbild mit einem dicken Schattenstreifen ab; die Pinien und Steineichen treten nur zu kleinen, gefälligen Gruppen und Hainen zusammen, um sie übersichtlich zu gliedern, und darüber hinaus wandert das Auge weiter und weiter. Die verstreuten Ortschaften in Tal und Hügelland, die Kirchen, die Klöster und Kastelle, die massiven Bauerngehöfte, wie nimmt das alles teil an dem einzigen Bild. Und erst die Stadt selber, so gross in ihrer geringen Ausdehnung, so lächelnd in ihrem Ernst, und bei aller Monumentalität luftig wie eine Fata Morgana. Die ausdrucksvollen Strassenzüge, die lichtumflossenen Türme und Kuppeln, die schönen Brücken, unter denen der Arno sich so gerne vergisst, haben etwas Persönliches, wie ein von Geist durchleuchtetes Angesicht. Sanfte Hügel, edelgeschwungene Berge umstehen sie in weitem Bogen; hier kauert der Monte Ceceri wie eine Sphinx, die Flanken von Steinbrüchen durchfurcht, und trägt die alte Etruskerstadt Fiesole wie eine Krone auf der Stirne, der Monte Senario erhebt seine bewaldeten Kuppen, deren Vierzahl so nachdrücklich wirkte, bevor sie der Entholzungswut zum Opfer fiel, und in edler Nacktheit steht, alle überragend, der König des Arnotals, der Monte Morello, der sich bei Sonnenuntergang in einen durchsichtigen, zwischen Amethyst und Rosenrot spielenden Riesenopal verwandelt. An ihn schliesst sich die blaue Apenninenkette, die in der Ferne verdämmert. Nichts Titanisches in diesen Gebilden, sie scheinen wie durch einen Künstlergeist hindurchgegangen und vom Zufall gereinigt. Als der Schöpfer schon ganz fertig war mit seiner Erde und der erste Rausch der Fantasie vertobt, da mischte er noch einmal die Farben, und mit seiner reifsten und reinsten Kunst schuf er sein letztes und liebstes Werk: Florenz. Man begreift den wütenden Schmerz der Verbannten, die ein Richterspruch auf ewig von diesem Anblick schied. Und zur Zeit, wo solche Sprüche gefällt wurden, war Florenz noch die Stadt des Lebens, die erste Rennbahn der Talente. Dafür konnte weder das charaktervolle Verona noch das fantastische Venedig entschädigen. Florenz verlassen hiess die Welt verlassen; manchem war das Sterben lieber.
*
Nie werde ich meinen ersten Abend auf florentinischem Boden vergessen. Es war Spätsommer, die weiche Luft glühte. Ein eigener, kränklich süsser Duft, an dem ich das sommerliche Florenz auch mit geschlossenen Augen erkennen würde – denn nirgends riecht es so wie dort – stieg aus allen Strassen auf. Dunkle Baukolosse, die ruhmreichen Zeugen der Vorzeit, warfen tiefe Schatten über den Weg und kündigten sich der Seele an, bevor das Auge sie erfassen konnte. Kindliche Petroleumlampen, die einzige Strassenbeleuchtung im damaligen Florenz, gaben eine dämmernde Helle, zu der noch die roten Lichter der Melonenverkäufer und der am Boden irrende Flackerschein der ciccajuoli (Sammler von Zigarrenstummeln) einen fantastischen Beitrag gaben. Aus der Via della Scala kamen uns mit qualmenden Fackeln die schwarzverlarvten Brüder der Misericordia entgegen, die eine Bahre trugen und von den Vorübergehenden durch Hutabnehmen gegrüsst wurden. Gleich darauf kreuzte ein eilender Trupp Mandolinisten unsern Weg und verscheuchte mit den Tönen der Lebenslust das Bild des Todes; die jungen Leute zupften ihre Saiten, marschierten und sangen dazu – alles so leicht, so klanghell und mit so stürmendem Schwung, dass es die Seelen und die Füsse mitriss. Die florentinische Sommernacht überschüttete uns gleich mit ihrem ganzen Stimmungszauber. Auch die Sterne über unsern Häuptern glichen nicht den Sternen der Heimat; sie standen so wundergross und so unbeschreiblich hoch an dem völlig blauen Nachthimmel.
Am Tage aber ging das Staunen erst recht an. Die Strassen mit der breiten, fussbodenartigen Pflasterung erschienen mir gar nicht wie Strassen, sondern wie Gänge eines Hauses. Den Insassen musste es auch so vorkommen, denn sie fühlten sich im Freien ganz und gar unter sich. Säugende Mütter auf der Schwelle der Häuser, spuckende, rauchende Männer daneben im losen Hemde, das sich über einer schlotternden Hose bauscht – man begriff nicht, wie das zusammenhielt – Stühle auf dem winzig schmalen Gehsteig, die den Platz versperrten. Der stehende Gruss der Begegnenden war: »Fa caldo«, und die resignierte Antwort: »Si suda«. Die Hitze hatte alles in Paradieseseinfalt zurückversetzt, auch jenen Fuhrmann, der, hinter seinen Pferden herschreitend, mit gelassenem Anstand unterwegs das Hemd wechselte.
Die glattgepflasterten Plätze, auf denen nach Sonnenuntergang die elegante Menschheit ziellos durcheinander wogte oder an kleinen Tischchen gelato und granita ass, kamen mir mit ihren Marmor- und Bronzewerken wie statuengeschmückte Säle vor, und wenn ein plötzlicher Regenguss darüber hinging, so war es wie ein häuslicher Scheuertag, denn gleich darauf lag alles wieder blank und trocken.
Noch gab es kein Hasten und Drängen auf den Strassen, obwohl die ganze Einwohnerschaft sich immer draussen befand! Wohlgesittet fluteten die Menschenwogen aneinander vorüber. Ein jeder hatte Zeit im Überfluss – nie werde ich wieder solche Unsummen von Zeit beisammen sehen wie damals in Florenz. Noch wusste man nichts von einem »tranvai«, nicht einmal von der allerbescheidensten Pferdebahn; es gab nur die berühmten Droschken, die den sparsameren Fremden zum Hohne strassenweit verfolgten unter dem hartnäckigen Zuruf des Kutschers: »vuole, Signore?« – und den guten, alten »onibusse«, der mich so oft für zehn Centesimi mit einer dem allgemeinen Tempo angepassten Geschwindigkeit von einem Stadttor zum andern getragen hat. Dazwischendurch rasten, ohne die Ordnung zu stören, die flinken zweiräderigen calessini, von den kleinen Maremmenpferdchen gezogen, die wie Spielzeug aussahen, und die ländlichen Eselsfuhrwerke trotteten friedlich vorüber. Auch in den engsten Gassen war noch Raum zum Stehenbleiben und zum Staunen. Und wo ich stehen blieb, da sammelte sich gleich ein Menschenhaufe an, um mir staunen zu helfen und nebenher ganz mühelos ein bisschen überflüssige Zeit loszuwerden. Man fühlte noch so deutlich das alte Florenz hindurch: die Traulichkeit in der Grösse, eine Welt, wo die Fürsten Bürger und die Bürger Fürsten waren. – Die Zeitungsverkäufer brüllten, aber in musikalischem Tonfall, um die Wette die beiden sich immer bekriegenden Tagesblätter aus. Der Schirmflicker kreischte sein ombrellajo - sprangajo-o. Der Schuhhändler liess in seinem Arr scarparr, Siorri! (Al scarpajo, Signori) das imposante Zungen-R, das ich nie ohne Neid hören konnte, samt dem zischenden S nur so über die Menge hinschnurren und sausen. Jeder dieser Schreihälse hatte seine eigenen, durch das Herkommen geheiligten Kadenzen, die nur seiner Gilde angehörten, und der Eifer, mit dem sie sich gegenseitig zu überschreien suchten, war weit mehr musikalischer als industrieller Art. Die gute Laune lag in der Luft und wurde von allen verstanden. Ein giornalajo, der es den Mitbewerbern zuvortun wollte, schrie statt des »Secolo di Milano«, den er unter dem Arme trug, »Mailänder Lügen« aus; ein Obsthändler schob einen Karren voll herrlicher Früchte vor sich her, indem er aus vollem Halse schrie: »Pere marciei Pere marciei« (Faule Birnen), und auf die erstaunte Frage, warum er seine schöne Ware so herabsetze, meinte er lachend, wenn er sie anpriese, würde niemand auf ihn hören.
Aber was war aller Lärm der Lebendigen gegen die lautlose Übermacht der Toten! Mit ihnen vor allem hiess es sich jetzt einrichten, denn sie waren die eigentlichen Herren des Pflasters. Das erste, was mir am Ponte vecchio gezeigt wurde, war der Ort, wo in der Vorzeit die verhängnisvolle Marsstatue gestanden hatte, das gefürchtete Idol der Stadt, zu dessen Füssen der Ritter Buondelmonte für den an der Tochter des Amidei begangenen Eidbruch verblutete, mit seinem Tode den unauslöschlichen Bruderkrieg entzündend. So lange der Ponte vecchio steht, wird der schattenhafte Hochzeitszug des Buondelmonte darüber hinziehen, wird Mosca Lamberti im Rate der Rächer sein folgenschweres Cosa fatta capo ha! sprechen, das er seit sechs Jahrhunderten im Inferno büsst. Wer mit solcher Inbrunst gelebt hat wie diese alten Florentiner, dessen Sein ist nicht an die kurze Erdenspanne gebunden, er behauptet durch die Jahrhunderte den Ort seiner Taten. Aber der Raum ist eng und der Taten sind viele. Gleich wird aus einer der Goldschmiedebuden der tolle Benvenuto Cellini brechen, den kunstvoll geschmiedeten Dolch in der Hand, der nach Menschenblut dürstet. Die Toten müssen sehen, wie sie miteinander zurecht kommen, denn für sie gibt es keine Zeitfolge; sie sind alle auf einmal da. Während Dante in die Verbannung zieht, flammt schon auf der Piazza della Signoria der Scheiterhaufen Savonarolas, und Michelangelo rüstet auf den Wällen von San Miniato seine Vaterstadt zum letzten Freiheitskampf. Jeder mag sich hier die Geister wählen, mit denen er am liebsten verkehren will; es ist für alle Bedürfnisse gesorgt. Ich wählte mir den Lorenzo de’ Medici mit seinen Gesellen. Sie bezeichnen so recht den Mittagsstand des florentinischen Genius, der dann schnell gen Abend sinken sollte. Brünstiger, jugendlicher, geistreicher ist das Leben niemals gelebt worden als von ihnen, vielleicht die Tage des Alkibiades ausgenommen. Wie eine Magnolienblüte, die nach langsamer Vorbereitung plötzlich aufbricht und Düfte von überwältigender Süssigkeit und Stärke ausströmt, aber durch das Übermass des Lebenstriebes rasch den eigenen Kelch zersprengt, so war die florentinische Kultur in ihren Händen. Dass die Gefahr alle ihre Feste umlauerte und dass sie auch mit dem Wonnebecher am Munde immer den Tod im Auge hielten, das hat ihren kurzen Augenblick so reich und so dauernd gemacht, denn nur am Rande des Abgrunds schwelgt sich’s mit Adel. Auf dem Domplatz von Florenz, der in den frühen achtziger Jahren noch dieselbe Gestalt hatte wie im Quattrocento und nur den flatternden Tauben, keinen Strassenbahnwagen, zur Herberge diente, liessen sich leicht die Geister jenes Himmelfahrtsfestes von 1478 heraufbeschwören, wo das mediceische Brüderpaar unter den Dolchen des Pazzi und seiner Mitverschworenen blutete. Jeder Pflasterstein wusste noch davon, und die schweigenden Monumente erzählten sich’s, wie damals der Platz von der flüchtenden, schreienden Menge gedröhnt hatte, durch deren Mitte der gerettete Lorenzo nach Hause geführt wurde, und wie man am Abend, als das Volk verlaufen war, aus einer Seitentür des entweihten Gotteshauses den toten Giuliano mit seinen neunzehn Wunden in die Taufkirche hinübertrug, wo sie ihn aufbahrten, »schön und blass wie eine Perle«, wie es in einem zeitgenössischen lamento heisst. – Solch ein Finden und Selbsterleben wie in meinen ersten florentiner Jahren, wo ich in meiner Unschuld meinen konnte, das alte Florenz zuerst entdeckt zu haben, ist in der heutigen, mit Geschichte und Kunstgeschichte durchsättigten Luft gar nicht mehr möglich.
Wie ausdrucksvoll war der Domplatz noch zu jener Zeit! Die schmucklose Vorderseite von Santa Maria del Fiore dachte noch gar nicht daran, mit dem schlanken Campanile an Reichtum zu wetteifern; er herrschte in seiner zierlichen Pracht, und die wunderköstliche Loggia del Bigallo gegenüber wirkte in der Schlichtheit und Geschlossenheit des Platzes wie ein geschmückter Juwelenschrein. Das Arcisvescovato stand noch mit seinem alten Vorderpalast nahe an das schöne Achteck des Täufers angedrängt und schloss mit einer langgestreckten Linie den ganzen Hintergrund, nur durch einen niedrigen Torbogen, den Arco de’ Pecori, Durchlass gewährend. Wenn Dante aus der Ferne seines »bei San Giovanni« gedachte, sah er ihn so von Bauten eng umrahmt und eingeschlossen. In dieser Gedrängtheit hatte der Platz etwas Anheimelndes, und wenn er mit Teppichen und Gobelins behängt war, bekam er das Ansehen eines festlichen Innenraumes, wie ein altes Bild ihn zeigt.
Der jetzt verschwundene Arco de’ Pecori führte in das Herz der Stadt, das geheimnisvolle, von wenigen gekannte Zentro. Das kleine Viereck, das die Strassen Calzajuoli, Cerretani, Tornabuoni und Porta rossa umschlossen, war die Altstadt, einst der Sitz der grossen Geschlechter, aber damals nur noch die unheimliche und trostlose Herberge des Elends und des Verbrechens, mit ihren Diebshöhlen und ihren Pestgerüchen zum grossen Teil für die Bewohner der glücklicheren Stadtviertel unzugänglich. Nur der alte Mercato mit seinen nächsten Zugängen war, wenigstens bei Tage, ohne Gefahr zu betreten. Am Viale Margherita wohnend, führte mich der Weg dorthin durch die Via Strozzi, die heute in nichts mehr an ihre frühere Gestalt erinnert, als in der geraden Linie, mit der sie sich der Via del Corso zu vereinigen strebt. Damals war sie eine lange, enge, unendlich schmutzige, von Verkaufsständen und Tischen umsäumte Gasse, auf der ein immerwährendes Gekreisch und Gedränge wie auf einem Jahrmarkt herrschte. Düfte, wie sie sich dort zu einer atemraubenden Stickluft mischten, habe ich niemals wieder gerochen. Es ist nicht zu sagen, was da alles auf offenem Feuer durcheinander protzelte und schmorte und seine Gerüche mit denen des modrigen Trödelkrams auf den Verkaufstischen mengte. Hatte man sich durch die leidenschaftlich feilschende und gestikulierende Menge durchgewunden, so gelangte man auf den Mercato vecchio mit der unvergesslichen Loggia del pesce; seine Paläste mit den noch übrigen Türmen, die den Platz umgaben wie invalide Veteranen, und die schlanke freistehende Säule, die die Stadtmitte bezeichnete, dämmern mir noch in der Erinnerung. Wie wenig Raum doch diese Alten gebraucht hatten. In diesem kleinen Platz, in dem Gewinkel enger Gässlein, die sich anschlossen, hatte das glühende Herz des mittelalterlichen Florenz geschlagen. Aus namenlosem Schmutz, aus entstellenden Bauflicken und Verkleisterungen blickten jammervoll die Spuren einstiger Schönheit. Hier ein köstlicher Zierat an zerbröckelnder Fassade, dort die reizenden Formen einer Loggia, die jetzt dem stinkenden Elend als Unterschlupf diente, anderswo ein Steinbogen aus der Römerzeit, in ein späteres Bauwerk verwendet. Kleine, uralte Kirchlein, über frühchristlichen oder römischen Anlagen errichtet, winzige, unregelmässige Plätze, enge Palasthöfe, von Türmen überragt, die drückend waren wie ein Alptraum; hier das bescheidene Stammhaus der Mediceer mit dem stolzen Kugelwappen, dort der festungsartige Palazzo Amieri – das war noch der Schauplatz aller jener Begebenheiten, von denen die Chroniken erzählen. Dort ist mir das alte Florenz im Geiste aufgegangen. Man musste diese Enge gesehen haben, um den Dämon der Zwietracht zu begreifen, der ein Volk von solchen Gaben und Leidenschaften zu jahrhundertelanger Selbstzerfleischung zwang. Kein Tapferer konnte sich vor der Parteiung retten, wenn hier der Alarmruf erscholl, wenn die schweren Eisenketten zwischen Haus und Haus den Weg versperrten und von den Fenstern, den rasch herausgeschobenen Verteidigungsbrücken Steine und Geschosse auf die Angreifer prasselten. Hier verstand man auch ganz die Fülle der Verachtung, mit der Dante die Lauen, die Neutralen im Vorhof des Inferno stehen lässt: guarda e passa! Man konnte es nachfühlen, wie der gefährliche Boden jedes Mal gezittert haben muss, wenn seine Bewohner sich zu Spiel und Freude darauf zusammenfanden oder die Jugend gemeinsam zum wonnigen Maienfeste hinauszog, das so oft in Blut und Schrecken geendet hat.
Doch nicht nur die eiserne Zeit der Guelfen- und Ghibellinenkämpfe war dort in Stein verkörpert, auch an die Anfänge des siegreichen Bürgertums gemahnte diese Enge, an die Tage, wo unsterbliche Künstler als Handwerker in ihrer bottega sassen und die frühen Mediceer sich noch hüten mussten, ihre Mitbürger in der Lebensführung zu überbieten. Hier konnte man sich einen Donatello vorstellen, der des Abends in Schlappschuhen auf den Mercato läuft, um rasch noch in der Schürze Obst und Eier heimzutragen, die er mit seinem Brunneleschi verspeisen will.
Mir ist es wie ein verblassender Traum, dass ich diese Welt noch mit eigenen leiblichen Augen gekannt habe! Ich atmete aber jedes Mal auf, wenn ich mich glücklich durch die zwiebelduftende, von Rosticcerien dampfende Via Calimala, die in ihrer Fortsetzung Via de’ Succhiellinai hiess, und den Arco de’ Pecori bis auf den Platz des Täufers durchgewunden hatte ohne eine allzu unliebsame Begegnung mit den lebenden Bewohnern des Mercato.
Einen Ort jedoch gab es im Zentro, den kein Angehöriger der gesetzlichen Welt jemals betrat, ausgenommen die Polizei, und auch die nur in genügender Stärke. Das war der ehemalige Ghetto, der gleich hinter dem Arcivescovato, wenige Schritte von der belebten, eleganten Via Cerretani begann. Er bildete in dem Reiche der Verdammnis, zu dem die Altstadt geworden war, die unterste Höllenstufe. Wer sich dorthin verirrte, konnte für immer verschwinden, denn vor dem unerforschten Gewirre von Gängen, Treppen, Terrassen, die die Häuser des Ghetto unter und über der Erde verbanden, machte auch der Spürsinn der Gesetzesboten halt. Dort, wo die Menschen wie Tiere beisammen hausten, war die Pflanzschule aller Verbrechen und die Brutstätte der Seuchen. Dennoch sperrten sich die Insassen – darunter auch eine wohlhabende Judenfamilie, die seit vielen Generationen dort ansässig war! – zum Teil ganz verzweifelt, als in den achtziger Jahren diese Pesthöhlen ausgeleert und sie selber zwangsweise in neue, gesunde Stadtteile versetzt wurden. Noch einmal feierte der Ghetto eine kurze und verklärte Auferstehung, als im Karneval 1886 seine ausgenisteten und gelüfteten Räume in eine märchenhafte, von Kamelen durchzogene Stadt Bagdad mit Bazaren, Kaffeehäusern, Karawansereien und entzückenden Blumenhöfen verwandelt wurden, worüber der Duft von Tausendundeiner Nacht schwebte. Gleich darauf verschwand der Ghetto mit dem grössten Teil des alten Zentro hinter dichten Bretterwänden. Und als nach Jahr und Tag die Gerüste fielen, war das alte Florenz nicht mehr, und an seine Stelle trat ein neues, bei dessen Anblick mir das Wort des Donatello einfiel, als der Maler Paolo Uccello im Kirchlein San Tommaso auf eben diesem verschwundenen Mercato hier ein Bild, woran er lange geheimnisvoll hinter Bretterverschlag geschafft hatte, den Augen des Volkes enthüllte: »Ora che sarebbe tempo di coprire e tu scopri« (jetzt deckst du auf, wo das Zudecken am Platze wäre). An der Stelle, wo sich der Mercato Vecchio in seiner Bettlermajestät erhoben hatte, gähnt jetzt in öder Langeweile wie ein aufgesperrtes Riesenmaul die Piazza Vittorio Emmanuele, und dass sie den ganzen Mercato zusamt den anstossenden Gassen und Plätzen verschlungen hat, macht sie dem Auge doch nicht gebietend. Die grausame Zerreissung und Erweiterung des Platzes um San Giovanni, der jetzt nach drei Seiten offensteht und die Taufkirche inmitten des wilden Getriebes wie einen einsamen Felsen in der Brandung erscheinen lässt, hat den Stimmungsreiz des alten Stadtbildes noch mehr verwischt.
Wie aber auch Florenz im Äussern sich verändert, der genius loci widersteht den Neuerungen. An langem Faden reicht die Tradition ununterbrochen bis auf unsre Tage herab. Die Brüderschaft der Misericordia z. B., der die ersten Familien der Stadt und der Landesherr selber angehören, ist über sechshundert Jahre alt. Gewohnheiten, Feste, Spiele, Redensarten der Florentiner sind die gleichen wie vor Jahrhunderten. Seit unvordenklichen Zeiten wird am Epiphaniatag die Hexe Befana gefeiert, die in einem Strumpf Geschenke ins Kamin hängt, und deren Ankunft die Gassenjugend schon Tage vorher durch das ohrenzerreissende Tuten der langen Glastrompeten ankündigt. Noch heute will der Florentiner an jedem Karsamstag den geschmückten carro vor der Domtür in die Luft fliegen sehen, so kindlich die Mechanik der künstlichen Taube ist, die ihn entzünden muss. Dass an jedem 24. Juni für den Täufer, den Schutzpatron der Stadt, die alten fuochi abgebrannt werden, versteht sich von selbst. Aber ebenso zähe ist der närrische Brauch, dass an Mittfasten jedem Vorübergehenden von den Kindern, diesen besten Hütern der Vergangenheit, das papierene Leiterchen auf den Rücken geheftet wird, obwohl niemand mehr weiss, was der Unfug bedeutet, und dass am Tage von Maria Himmelfahrt der Liebhaber seiner Schönen eine schwarze Singgrille im Käfig verehren muss. Ein Liedchen, mit dem die Kleinen in den Frühsommernächten das Erscheinen der Leuchtkäfer begrüssen, habe ich wörtlich so in den Gesängen des Poliziano gefunden, und ich frage mich, ob nicht hinter ihrem Popanz Maramao vielleicht eine Erinnerung an den Verräter Maramaldo sich versteckt! Einen Schmerbauch hörte ich einen Giangastone nennen von Leuten, die in ihrem Leben nichts von dem schlemmerischen letzten Mediceer gehört hatten, und wenn einer mit seiner Hilfe zu spät anrückt, so sagt der Florentiner: »É l’ajuto di Pisa«, obgleich heute nur noch die Historiker wissen, wann und weshalb die pisanischen Bundesgenossen in solchen Verruf geraten sind.
Auch ein Gespenst würde sich in Florenz schämen, nicht mindestens seine vierhundert Jahre alt zu sein, wie die schöne Luisa Strozzi, die unter dem Herzog Alessandro geheimnisvoll starb und sich noch immer ab und zu erzeigen soll. Die Umwohner des Bargello schliessen selbst in den glühenden Hochsommernächten ängstlich alle Fenster, weil aus dem alten Säulenhof, an dem das Blut der Staatsverbrecher klebt, so seltsame Töne und Schatten heraufsteigen.
Die Zeit hält über der Arnostadt ihre raschen Flügel an. Die alte Uhr auf dem Palazzo Vecchio regelt das Leben von Florenz, und ihr Schlag ruft: Eile mit Weile! Nichts hat hier seine feste Stunde. Der Nobile, der mit der Zigarre im Munde an der Tür des Circolo steht, die gepuderte Bürgerstochter, die vom Fenster seufzend den herrschaftlichen Equipagen nachsieht, der Facchino, der sich an der Strassenecke in der Sonne räkelt, sie gehören alle zur grossen Familie der Lilien auf dem Felde. Nur ein loser Sommerfaden hält das ganze Getriebe zusammen; will man ihn spannen, reisst er.
Fast rührend mutet es im zwanzigsten Jahrhundert an, wenn man in einer der belebtesten Strassen auf einen Laden stösst, an dem ein geschriebenes Täfelchen aushängt mit der vertraulichen Aufschrift: »Torno subito« (ich komme gleich wieder). Der Inhaber ist nur ein bisschen weggegangen, um anderswo zu plaudern; aber der Kunde müsste viel Zeit übrig haben, der auf seine Zurückkunft warten wollte. Wer frisch von aussen kommt und noch das Tempo des modernen Lebens in den Gliedern hat, der fühlt sich in Florenz wie eine Kugel, die in einen Wollsack fällt. Seine Tatkraft nützt ihm nicht das geringste gegen den weichen, passiven Widerstand, der ihn umgibt. Und der Ankömmling wundert sich über seine Landsleute, die vor ihm da waren und schon das zeitlose Leben der Eingeborenen teilen. Sie erinnern ihn vielleicht an die verzauberten Lotophagen, die mit stillen Gesichtern wunschlos umhergehen und nimmer heimverlangen nach dem Lande der Väter. Doch bald wird ihm so seltsam wohl in der blauen Unendlichkeit; die Geister der Zeit, die ihn jagten, fallen ab, und am Ende wird er selbst wie jene und begehrt nichts weiter als nur immer dazubleiben und von den Früchten des Lotos zu essen. Aber wehe ihm, wenn er nicht gefeit ist gegen das süsse Gift, denn diese Früchte bekommen nicht jedem. Eine wonnige Mattigkeit schleicht durch die Adern, die manchem die Spannkraft auf immer lähmt. Nichts spornt ihn mehr zum Tun auf einem Boden, wo seit Jahrhunderten alles getan ist. Langsam verfeinert sich das Stilgefühl bis zur Unduldsamkeit und schafft beim Anblick jedes Erzeugnisses einer unreiferen Kultur Qualen, von denen der Aussenstehende keine Ahnung hat. Nur in Gesellschaft der Toten scheint das Leben noch lebenswert. Aber die Toten sind grausam, besonders gegen den schaffenden Künstler. So mancher legt sich als demütiger Schüler zu ihren Füssen, der daheim Gewinn und Ehren erringen könnte oder schon errungen hat, und wird von ihnen ausgesogen und weggeworfen. Erst reissen sie ihn an sich mit dämonischer Gewalt; sie werfen Hülle um Hülle vor ihm ab, dass er sie erkennt in ihrer übermenschlichen Schönheit, dann beginnt der kalte Hohn, die eisige Zurückweisung: Versuch es und sei wie wir! Er hält es zuerst für möglich. Aber hat er eine Leinwand auf der Staffelei, die ihm Freude macht, so blicken sie ihm über die Schulter, kalt und unerbittlich. Im Pitti gibt es bei seinem Eintritt eine wahre Verschwörung. Leo X. mit dem Kardinal Bibbiena lächelt infam, die stolzen Tizians sehen so über ihn hin, und sogar die schwermütigen Madonnen des Botticelli verziehen ihre Mündchen, bis ihn die Verzweiflung packt, dass er seine Leinwand zerschneidet und ein paar Tage wie ein Toller durch die Campagna rennt. Er hadert mit sich und mit den Toten; er sagt ihnen die schnödesten Worte: Ihr habt nicht nötig, euch aufzublasen, was wärt ihr, wenn nicht die Wogen eurer Zeit euch getragen hätten! Es ist ein Unterschied, ob man für die Stanzen des Vatikans schafft oder für einen Berliner Protzensalon. Ich möchte sehen, wie ihr euch heutigentages anstellen würdet, um unsterblich zu werden! – Er hat gut reden, die lächeln weiter und geben keine Antwort; nichts Niederschlagenderes als mit Leuten hadern, die den Mund nicht zur Erwiderung auftun. Endlich ruft er in heller Wut: Was wollt ihr? Neben den Griechen seid auch ihr nur Krämer! Dann schlagen sie die Augen nieder; das ist seine Rache. Aber der Anblick eines einzigen modernen Bildes genügt, ihn reuevoll zu den Füssen seiner Peiniger zurückzuführen. Ja, die Toten sind eine tückische Nation. – Wer aus den Armen der stillen Königin kommt, der steht als Fremdling unter den Menschen, wie wenn er aus dem Venusberg stiege, und ist er dann noch imstande, der Mitwelt zu dienen, so hat er die stärkste Probe auf seine Lebenskraft abgelegt.
*
Florenz ist die vornehmste aller Städte. Da auf diesem Boden kein Geld zu machen ist und die gröberen Vergnügungen fehlen, gibt es keine protzigen Banausen, keine das Leben geniessenden Handlungsreisenden dort, und von den internationalen Abenteurern andrer Weltstädte nur der Vollständigkeit halber einige wenige Muster. Kein Wald von Fabrikschlöten verdickt die Luft mit Qualm und mit sozialen Fragen; was den Bauern betrifft, so ist er in Toskana durch die Einrichtung der mezzadrìa besser gestellt als irgendwo sonst; der Kleinbürger aber lebt in einem Geflechte höchst verwickelter, doch friedlicher Auskunftsmittel, in die wir keinen Einblick haben. Freilich fallen mit dem wirtschaftlichen Kampfe auch die Leidenschaften weg, die die Gesellschaft verjüngen. Das heisse Blut der Florentiner ist schon nach den letzten grossen Aderlässen beim Untergang der Republik zahm und stille geworden. Das gesellschaftliche Leben ist abgeklärt, ruhig und rein gestimmt wie die Landschaft um Florenz. Die hochgebildete Sprache trägt einen Hauch von Vornehmheit bis in die niedersten Schichten hinunter. Dagegen ist der Blick auch unbegrenzt. Alle Nationen treffen in Florenz zusammen. Jede Welle des modernen Lebens, gleichviel von wo sie ausgegangen, dort kommt sie angerauscht; man kann ihren Weg verfolgen, nur dass ihr Schlag am Arnoufer seine elementare Kraft verliert. Einen Barrikadenkampf z. B. kann man sich auf dem Boden, der so viel Bürgerblut getrunken hat, in unsern Tagen gar nicht mehr vorstellen. Auch ihr 27. April ist ja so gesittet verlaufen wie eine Revolution im Lustspiel. Man musste unsern alten Tapezierer, der die Zeit noch miterlebt hat, von dieser menschenfreundlichsten aller Staatsumwälzungen erzählen hören; schade, dass ich nur den Sinn seiner Rede, nicht auch den Wortlaut wiedergeben kann. Schon tags zuvor hatte es gegoren, drohende Gruppen standen auf den Strassen, und als General Ferrari, eine sehr verhasste Persönlichkeit, sich mit seinem Adjutanten auf der Piazza zeigte, schnitten die toskanischen Gendarmen, die ihm folgten, Fratzen hinter ihm her, bis ein Herr hinzutrat und ihn bat, sich aus Rücksicht auf die Stimmung des Volkes zurückzuziehen. Am 27. wurde es ernst. Da machten die Häupter der Bewegung dem Grossherzog eine Aufwartung, nach der ihm nichts übrig blieb als zu gehen. Als er mit seiner Familie in grosser Staatskarosse zum Boboli hinausfuhr, begleiteten sie ihn nebst Militär als Sicherheitswache und führten ihn mit allem schuldigen Respekt nach Bologna, wo sie ihn in die Arme der Österreicher legten. Und wo der Zug vorüberkam, da stand das Volk schweigend und höflich auf der Strasse und liess sogar den General Ferrari, den einzigen, dem man ans Leben wollte, ungehindert passieren, weil er hinten auf der grossherzoglichen Equipage stand, wo sonst der Platz der Lakaien war. Erst als der »Papa« die Stadt verlassen hatte, brach der tobende Jubel aus, und man sang den Anhängern des alten Regimes den Spottvers nach:
Oh cosa speri tu? II babbo non torna più.
Freilich als dann mitten in das Evvivarufen und Fahnenschwenken hinein die Steuereinnehmer kamen und die Soldaten ausgehoben wurden, da kühlte sich die trikolore Begeisterung bald ab – man spürt es ordentlich der Mimik des Erzählers an, wie die piemontesische Schraube das weich gewohnte Volk von allen Seiten zwickte. Denn die Toskana mit ihren humanen Einrichtungen hat mit dem Anschluss an das grosse Vaterland ein Opfer gebracht wie keiner der andern Stämme. Darum fühlt sich so ein alter Florentiner bis auf den heutigen Tag noch nicht ganz als Italiener. Immer denkt er mit stiller Wehmut an das milde lothringische Regiment, wo sich’s so bequem lebte, wo alle öffentlichen Geschäfte über Hintertreppen gingen, wo der sigaro toscano zwei Centesimi kostete und wo sogar das Wetter schöner war als heute. Immer ist er ein bisschen »codino«, ein bisschen »paolotto« geblieben, das heisst, dass ihm ein Zöpfchen hinten hängt, und dass er nach Kirchenluft riecht. Und der Piemontese ist ihm so lieb wie dem Altbayern der Preusse.
Überhaupt kommt dem Florentiner der Fremde schwerlich recht nahe, und als Fremder wird von ihm jeder Nicht-Toskaner angesehen, daher er dem Römer und Lombarden ebenso gut ein Buch mit sieben Siegeln bleibt wie dem Deutschen oder Engländer. Er lebt in seiner alten Kultur wie hinter einer chinesischen Mauer. Nie vergisst er, dass sein kleines Gemeinwesen einmal die Wiege der modernen Zivilisation und ein Inbegriff der ganzen Menschheit gewesen ist, der keiner Ergänzung von aussen bedurfte. Darum stellt er sich vor, dass noch heute jedes andre Volk von ihm, er von keinem andern Volk zu lernen hätte. Seine Geografie ist so einfach wie möglich und wird auch durch das wütige Zeitungslesen nicht beeinflusst: Florenz und um Florenz her Italien, um Italien her eine nebelhafte Welt, das Ausland, das die seltsame Menschenrasse der Fremden, der »forestieri« hervorbringt. Von diesen weiss er nur so viel, dass der Brite von einer kleinen Insel kommt und der Amerikaner von einer grossen, und dass der Deutsche nicht allemal ein Österreicher ist, obgleich er das letztere immer gerne wieder vergisst. Damit ist so ziemlich sein Interesse für ausserflorentinische Dinge umschlossen. Selbst der Literat ist stolz darauf, keine fremde Sprache zu verstehen, weil er so die eigene reiner zu erhalten glaubt.
Im gesellschaftlichen Verkehr kommt man über den Anfang nicht hinaus, und wenn man bei der ersten Begegnung wegen der Leichtigkeit und Freundlichkeit der Sitten den Eindruck gewonnen hat, als ob man mit alten Bekannten zusammen sei, so bewegt sich das Gespräch nach jahrelanger Bekanntschaft immer wieder in denselben Gemeinplätzen, als sehe man sich heute zum ersten Mal. Fiorenza ist weder gastfrei noch warmherzig. Die Sitte verbietet dem Fremden sogar, den ersten Besuch zu machen; er muss warten, ob man ihm entgegenkommen will. Es gibt keine freundnachbarliche Teilnahme, auch zwischen den Einheimischen selber nicht, obgleich ein Kaffeehausbekannter den andern amico nennt.
Dafür duldet die stille Königin auch keinen Klatsch an ihrem Hofe. In den modernen Millionenstädten gibt es immer wieder ein Krähwinkel, wo der eine das Tun und Lassen des andern bemängelt, in der kleinen Weltstadt am Arno nicht. Höchstens wenn der Principe Strozzi stirbt und niemand sich findet, der seinen Palast mit den wundergrossen Erinnerungen und den wundergrossen Hypotheken übernehmen will, bewegt sie das ein wenig, denn der Palazzo Strozzi ist ein Stück von ihrem Herzen; aber den Kleinkram des Tages lässt sie nicht an sich heran. Wird eine Skandalaffäre laut, die anderwärts ein Jahr lang alle Zungen beschäftigen würde, so zuckt Fiorenza die Achseln und lässt in einer Nacht das Gras der Vergessenheit darüber wachsen. Und an »Affären« fehlt es nicht in einer Stadt, die der Liebesromantik aller Nationen als Zuflucht dienen muss. Auch der Fremde artet sich bald nach dem einheimischen Stil: ein Geheimnis der Kolonie wird nur von den feinen Luftschwingungen, nicht von Menschenstimmen weitergetragen. Am Ende wissen’s alle, und niemand spricht davon.
Was den Umgang mit dem Florentiner erschwert, ist seine Abneigung gegen die geraden Wege. Wie alle sehr alten Kulturvölker hat er das Bedürfnis des Umgehens und Verhüllens. Das Gegenteil von dem sagen, was man denkt, heisst in Florenz educazione. Dabei zieht der eine von den Versicherungen des andern mit klarer Schätzung ein bestimmtes Quantum ab, sodass doch noch eine Art von Wahrheit herauskommt. Es dauert lange, bis der Fremde sich diese Übung aneignet. Vor allem muss er lernen, dass sein Gewährsmann selber gar nicht ernst genommen sein will, sondern nur den Anstand wahrt, wie er ihn empfindet. Man könnte, ein berühmtes Wort parodierend, sagen: »Allgemeine Verstellung, gemildert durch allgemeinen Unglauben.« Dass dieses System für den modernen Menschen zu zeitraubend ist, kommt nicht in Betracht, denn der Florentiner ist kein moderner Mensch. Ihm ist die ererbte schöne Form Zweck und Inhalt des Daseins. Die Begeisterung für die Sache, die ihn einst so gross machte, hat er mit der Wildheit seiner Jugend hinter sich gelassen.
Auch äusserlich trägt er die Merkmale der Überfeinerung. Er ist schmächtiger gebaut und hat schwächere Nerven als der Norditaliener; es kann vorkommen, dass er an den Folgen eines plötzlichen Schrecks hinsiecht und stirbt – »ha avuto una paura« heisst es dann. Rhachitis und Skrophulose wühlen im Volk, und der allzu spärliche Salzverbrauch leistet diesen Feinden noch Vorschub. Daran ist nicht allein die hohe Salzsteuer schuld, sondern auch alte Gewohnheit. Alle Bitternis der Fremde symbolisiert sich für Dante in dem Salzgeschmack ihres Brotes, und noch heute isst der Toskaner kein gesalzenes Brot. Dass die Kinder schon so gewitzt sind wie die Erwachsenen, scheint auch ein Altersmerkmal der Rasse zu sein. Wunderbar leicht und schnell arbeitet die geistige Maschine des Volkes. Es versteht die Rede des Fremden augenblicklich, auch durch die abenteuerlichsten Sprachschnitzer hindurch; ja, es erhascht seine unausgesprochenen Gedanken, vorausgesetzt, dass sie sich im florentinischen Gesichtskreis bewegen. Was aber darüber hinausliegt, das trifft auf um so tiefere Verständnislosigkeit. In eine fremde Gedankenwelt einzudringen, gibt sich kein Florentiner die Mühe, er will in seiner eigenen aufgesucht sein.
Der gemeine Mann ist taktvoll, verständig und gutmütig, mit einem leichten Stich ins Maliziöse. Seine Höflichkeit gegen den Höherstehenden hat nie etwas Unterwürfiges, er gibt stets zu verstehen, dass er durch die feine Form sich selber ehren will. Dem Florentiner liegt seine republikanische Vergangenheit im Blute. Er lacht über Titel und Orden. Eine Livree zu tragen bequemt er sich nur mit dem äussersten Widerwillen. Die Droschkenkutscher wehrten sich noch gegen jedes Abzeichen, das der Magistrat ihnen aufnötigen wollte, um nur ja nicht mit Herrschaftskutschern verwechselt zu werden, und bemühen sich unter ihrem Panamahut oder dem festgeschraubten Regenschirm so nachlässig und bürgerlich wie möglich dreinzuschauen. Spricht der Fattore mit seinem Gutsherrn, so lässt er den Grafen- oder Marchesetitel beiseite und redet ihn vertraulich »Sor Giuseppe«, »Sor Cosimo« an. Das ist das letzte Überbleibsel jenes Geistes der Freiheit, der einst die »Ordinamenti della giustizia