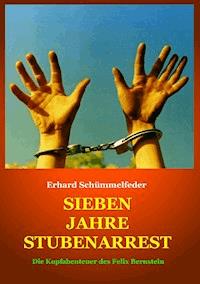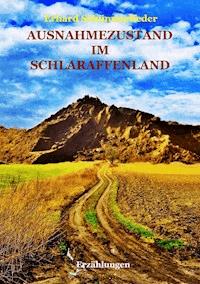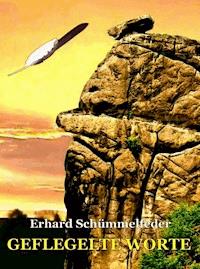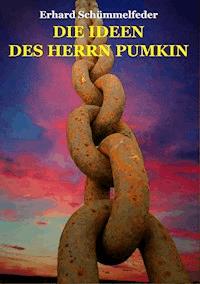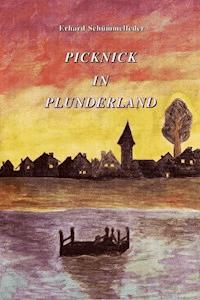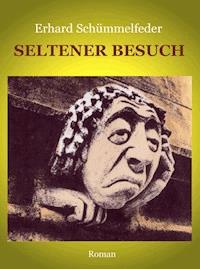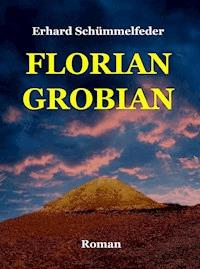
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der aus bitterarmen Verhältnissen stammende Florian lernt in den Sommerferien seinen steinreichen Cousin Berthold kennen. Berthold besitzt einen eigenen Swimmingpool; er bewohnt in der Villa seiner Eltern zwei luxuriöse Zimmer mit teuren Spielzeugen; ihm gehören ein eigener Fernseher, ein Computer, eine elektrische Gitarre und tausend andere schöne Dinge. Florian hat kein eigenes Zimmer, keinen Swimmingpool und keinen eigenen Computer, denn seine alleinerziehende Mutter verdient nicht genug Geld. Verständlicherweise begegnet Florian seinem Cousin mit einer gewissen Reserviertheit. Obwohl Bernward sich oft hochnäsig und herablassend verhält, bemüht Florian sich, ein gutes Verhältnis zu Berthold zu bekommen. Ob ihm dies gelingen wird? Eine Antwort auf diese Frage gibt der unterhaltsame Familien-Roman "Florian Grobian", der als Sozialstudie mit satirischen Untertönen angelegt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erhard Schümmelfeder
FLORIAN GROBIAN
Eine Sommergeschichte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Autors
FLORIAN GROBIAN
Impressum neobooks
Vorwort des Autors
Eine Erinnerung aus der Schulzeit
Als ich neunzehn Jahre alt war, führte ich ein Gespräch mit Wieland, einem Deutschlehrer. Er fragte mich nach dem Unterricht, als wir allein in der Klasse waren: »Sie schreiben?«
»Ich versuche es«, antwortete ich.
Er fuhr fort: »Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was das Wichtigste für einen Schriftsteller ist?«
»Nein«, gab ich zu.
Er redete viel von der Magie der Sprache, von der Gefahr der Missdeutungen und vielem mehr. Der Satz aber, den ich nie vergessen werde, lautete: »Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist - « Er unterbrach sich, dachte einen Moment nach und begann den angefangenen Satz von neuem: »Das Wichtigste für einen Schriftsteller ist, dass er Armut kennt.«
Aus: Denkzettel eines Zweiflers
FLORIAN GROBIAN
Das erste Telegramm meines Lebens erhielt ich mit dreizehn Jahren an einem Mittwoch im Sommer 1996 von meinem Cousin Berthold. Sooft ich an diesen sonnig-heißen Tag denke, höre ich immer zuerst das helle Klimpern der Münzen, die ich lose in meiner rechten Hosentasche bei mir trug: Es waren drei Fünfmarkstücke, selbst verdient an den Nachmittagen der ersten Ferienwoche in der Wohnung von Herrn Lindner durch das Vorlesen der Tageszeitung. Fünf Mark zahlte Herr Lindner, bei dem Mama einmal in der Woche den Hausputz erledigte, für meine täglichen Dienste.
Obwohl ich eigentlich ein wenig unglücklich darüber war, in diesem Jahr nicht in die Ferien fahren zu dürfen, gaben die lustig kichernden Münzen mir ein zuversichtliches und tröstliches Gefühl, als ich in den Dunklen Weg einbog und auf das Mietshaus mit der Nummer 38 zusteuerte. Hinter der verglasten Holztür des Hauses nahm ich den sich verflüchtigenden Bratkartoffelduft wahr, der sich mischte mit den Gerüchen von Bohnerwachs, Kaffee und Zigarettenqualm. Ich ging durch den gefliesten Flur, in dem meine Schritte leise nachhallten, zu unserer Wohnungstür. Die gedämpften Geräusche im Haus erinnerten mich an zurückliegende Sonntage, die begleitet waren von einer feierlich anmutenden Stille. Ganz plötzlich verflog dieser Eindruck, als ich eine Wasserspülung aus dem Obergeschoss rauschen hörte. Irgendwo in einer der drei Mietwohnungen wurde die Musik aus einem Radio lauter gestellt. Eine Waschmaschine summte. Im Haus räumte jemand Geschirr klappernd in einen Schrank. Ich nahm meinen Schlüssel, öffnete unsere Korridortür und ging über den Flur in die Küche.
»Mama!«, rief ich. »Bist du zu Hause?«
Ein kaum spürbarer Windzug strich durch die Wohnung. Als ich ins Wohnzimmer kam, sah ich die offene Balkontür. Mama trug draußen den Wäschekorb ans Ende der kleinen Gartenwiese, wo die Leinen zwischen den eisernen Pfählen gespannt waren.
»Suchst du mich?«, hörte ich sie rufen, als sie gerade eine rote Bluse meiner Schwester Barbara mit zwei Klammern aufhängte.
»Fünfzehn Piepen habe ich jetzt beisammen«, sagte ich und kletterte über die Balkonbrüstung hinunter in den Garten.
»Wie schön«, sagte Mama, zupfte einen dünnen Faden von dem Wäschehaufen und blies ihn fort in die Richtung des nahen Bahnhofs. »Aber sag nicht immer Piepen, hörst du? Es klingt so ordinär.«
»Ja«, sagte ich gleichgültig.
»Hast du Herrn Lindner von mir gegrüßt?«
»Türlich«, sagte ich, obwohl ich es in Wahrheit vergessen hatte.
»Gehts ihm wieder besser?«, wollte Mama wissen.
»Etwas«, sagte ich. »Er hat noch immer Probleme mit den Augen und den Beinen.«
»Schrecklich«, sagte Mama. »Der arme Mann.«
»Wann fahren wir in Urlaub?«, fragte ich, als mich ein Gefühl von beginnender Langeweile beschlich.
Mama seufzte. Ohne mich anzublicken sagte sie monoton jene Worte, die schon oft über ihre Lippen gehuscht waren: »Wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, wenn die Schulden bezahlt und wir aus dem Gröbsten heraus sind.«
»Soll ich dir helfen?«, fragte ich.
»Wie spät ist es denn jetzt?«
»Halb vier oder so«, antwortete ich.
»Dann muss ich gleich Moritz aus dem Kindergarten holen.«
Ich nahm die saharagelbe Decke aus dem Korb, warf sie über die straffe Leine und klammerte sie an einer Seite fest.
»Nicht so«, sagte Mama.
»Wie denn?«
»Das macht man anders«, erklärte sie. »Man faltet die Decke zu einem Dreieck und hängt sie mit der Spitze nach unten auf. Siehst du?«
»Wozu soll das gut sein?«
»Das Wasser sammelt sich in der Spitze und läuft rasch aus der Decke. Auf diese Weise trocknet sie schneller.«
Ich ließ mich rückwärts ins Gras purzeln und beobachtete gespannt die Spitze der Decke. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis sich der erste dicke Wassertropfen zeigte und herunterfiel. Ich legte meinen Kopf ins Gras. Eine Wäscheklammer plumpste zu Boden und blieb beinahe aufrecht, gestützt von den grünen Halmen, im Gras stehen. Aus diesem Blickwinkel mochte eine Heuschrecke die Welt betrachten.
»Ich werde ein wenig zeichnen«, sagte ich. »Eine Wäscheklammer - so groß wie das Empire State Building oder so.«
»Du hast übrigens Post bekommen«, sagte Mama.
»Heute Nachmittag?«
»Ja. Eben kam ein Telegramm für dich.«
»Ein Telegramm?« Augenblicklich stand ich wieder auf den Beinen. »Wo ist es?«
Mama lächelte. »In deinem Zimmer.«
Ich lief über den Rasen, stolperte den kleinen Schräghang hinauf und überkletterte erneut die Balkonbrüstung. Ich hatte nie zuvor im Leben ein Telegramm bekommen, wusste nicht einmal, wie ein solches aussah. Ich meinte, ein Telegramm müsse ein schmaler Papierstreifen sein, ähnlich wie die Kassenbons, die Mama jeden Tag an der Kasse höflich den Kunden des Supermarktes reichte.
Auf der Fensterbank, die mir als Schreibtisch diente, fand ich zwischen unfertigen Zeichnungen einen blauen Briefumschlag, auf dem ich als erstes ein schwarzes Posthorn und den Aufdruck Telegramm erkannte.
Herrn
Florian Grob
Am dunklen Wege 38
stand in maschinengeschriebener Schrift rechts auf dem Papier.
Ich nahm einen angespitzten Bleistift aus der Blechdose und schlitzte das Kuvert an der Oberkante auf. Dann zog ich ein weißes Blatt hervor und las in einem umrandeten Feld die Worte:
Danke für die Einladung. Ich freue mich,
dich morgen kennenzulernen.
Dein Cousin Berthold.
Ich hörte, wie Mama den Plastikwäschekorb im Bad an die Wand hängte.
»Mama«, sagte ich aufgeregt, »mein Cousin will mich besuchen. Was soll ich denn jetzt machen?«
»Dich über den Besuch freuen«, sagte sie, ohne einen Blick auf das Telegramm zu werfen. »Florian, ich hole schnell deinen Bruder aus dem Kindergarten. Du könntest inzwischen für mich eine schöne Tasse Kaffee kochen, ja?«
»Hast du Berthold eingeladen?«, fragte ich.
»Ich war so frei«, sagte Mama, als sie ihre Schuhe aus dem Schrank hervorholte.
Ich fand, sie hätte mich vorher fragen müssen. »Kommt er allein?«
»Mit seiner Mutter, Tante Martina, die du ja schon kennengelernt hast.«
»Wie - wie alt ist er denn?«, fragte ich.
»Ungefähr so alt wie du«, sagte Mama und öffnete die Korridortür. Für einen Moment erschien das Gesicht von Frau Krawinkel in der Türöffnung. Grußlos, mit verkniffenem Mund, stieg sie die Flurtreppe hinauf in die obere Etage.
»Mama, was - wie ...«
»Bis gleich! Denk an den Kaffee. Zwei gehäufte Löffel kommen in die Kanne.«
»Was ist er denn für einer?«, fragte ich hastig.
»Das musst du schon selber herausfinden«, sagte Mama davoneilend, während sich die grauweiße Tür langsam zwischen uns schloss.
Die Tatsache, einen Cousin zu haben, war mir vertraut. Obwohl Bertholds Eltern seit einigen Monaten in ihrer Villa am Stadtrand wohnten, war ich meinem Cousin bislang nie begegnet. Er besuchte ein Internat im Norden Deutschlands und kam nur einmal im Monat zu seinen Eltern nach Hause.
Ich ging in die Küche, ließ Wasser in den Kessel laufen, nahm zwei gehäufte Löffel Kaffee aus dem Glas und gab das Pulver in die Warmhaltekanne. Es interessierte mich, ob Berthold meiner Schwester Barbara auch ein Telegramm geschickt hatte. Die Tür zu Barbaras Zimmer war offen. Ich war ein Unbefugter in diesem Raum. Barbara, die schon fast fünfzehn war, besaß ein Zimmer für sich allein, während ich mit Moritz den winzigkleinen Raum neben dem Wohnzimmer teilen musste. Barbaras Zimmer hatte schöne Möbel aus hellem Kiefernholz - ein Geschenk von Tante Judith, ihrer Patentante -, einen flauschigen Teppich und einen richtigen Schreibtisch mit verschließbaren Fächern. Barbaras Zimmer war nicht aufgeräumt. Ein Schlüpfer und verknäulte Strümpfe lagen vorm Bett. Schulbücher, Hefte, grellbunte Zeitschriften und silbriges Kaugummipapier häuften sich auf ihrem Schreibtisch. Ein Telegramm konnte ich nirgends entdecken.
In der Küche pfiff der Wasserkessel auf dem Herd. Ich schaltete den Regler auf O und goss das dampfende heiße Wasser in die Kanne, die ich mit einem Deckel verschloss. Dann ging ich in mein Zimmer und setzte mich ans Fenster. Herr Lindner, der früher Kunstlehrer gewesen war, hatte mir vor einiger Zeit einen farbigen Bildband geschenkt: es waren hundert Gemälde berühmter Meister darin abgedruckt. Ich zog den Band aus dem Regal und blätterte darin. Bald fand ich, wonach ich suchte. Das Bild hieß Der blaue Knabe. In einer bewegten herbstlichen Landschaft stand ein schöner Jüngling mit einem blauen, seidig schimmernden Anzug. Der schlanke Knabe mochte vielleicht dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein. Er hatte mittellange braungelockte Haare. Ein letzter kindlicher Ausdruck war in dem schmalen Gesicht über dem weißen Spitzenkragen erkennbar. Die dunklen Augen hatten einen bescheidwissenden Blick. Der geschlossene Mund schien ein geheimgehaltenes Wissen zu verbergen. Der Junge wirkte überlegen, etwas spöttisch, dabei vornehm und elegant. In der rechten Hand, die lässig herunter hing, trug er einen dunklen Hut mit einer buschigen Feder. Die andere Hand hatte er in die Hüfte gestützt, während er über dem linken Arm einen leichten blauen Umhang bei sich trug. Ich betrachtete aufmerksam das Gemälde. In meinen Gedanken hatte ich das Bildnis des blauen Knaben immer in Zusammenhang mit meinem Cousin Berthold gebracht. Da ich ihm bislang nie begegnet war, stellte ich mir vor, er könne vielleicht so aussehen wie der zarte und stolze Jüngling in dem Buch. Aus den wenigen Andeutungen, die ich von Barbara über ihn gehört hatte, entnahm ich, er sei etwas Besonderes. Ich zog ein loses Blatt aus dem Buch, auf dem ich einmal versucht hatte, die Gestalt aus dem Bildband nachzuzeichnen. Immer wieder hatte ich auf dem Papier radiert, bis mir annähernd der lässige, überlegene und würdevollen Ausdruck, den die ganze Gestalt ausstrahlte, gelungen war. »Jedes Ding hat seine Schattenseite«, hörte ich in Gedanken Herrn Lindner zu mir sagen. »Vergiss das nie.«
Vor dem Abendbrot ging ich wieder über den Flur und drückte die Klinke von Barbaras Tür hinunter.
»He«, sagte ich und trat ins Zimmer. »Ich wollte dich was fragen.«
Barbara saß auf dem Bett und blickte erschrocken auf. Mit einer raschen Bewegung schob sie etwas unter ihre Bettdecke. »Ich habe nicht herein gesagt. Außerdem hast du nicht geklopft.«
»Doch«, sagte ich, »geklopft habe ich.«
»Du lügst.«
»Hier«, sagte ich schnell und zeigte den blauen Umschlag. »Ich habe ein Telegramm bekommen.«
»Ein Telegramm?« Barbaras Verstimmung gegen mich war sofort verflogen. Soweit mir bekannt war, hatte sie auch noch nie ein Telegramm bekommen.
»Aber wenn es dich nicht interessiert«, sagte ich gleichgültig und wandte mich leicht zur Seite.
»Doch«, sagte sie. Ihr Gesicht war etwas gerötet, weil sie, wie schon so oft, zu lange in der prallen Sonne gelegen hatte. »Zeig mal her! Von wem ist es?«
»Von Berthold.«
»Was hat er denn geschrieben?« Sie streckte mir ihren linken Arm entgegen.
»Er will mich besuchen. Morgen.«
»Nur dich?«
»Weiß ich nicht.«
»Gib doch mal her, das Ding!«
Ich reichte Barbara den Umschlag und sah, wie sie das Telegramm mit ihren spitzen Fingernägeln herausfischte. Ihre Unterlippe schob sich ein wenig vor, als sie den Text überflog. Ihr plötzliches Interesse wich einer gewissen Enttäuschung – ich sah es ihr an - , denn ihr Name wurde auf dem Blatt nicht erwähnt.
»Schön«, sagte sie und schnippte das Telegramm auf den Nachttisch neben dem Bett. Ich faltete es und schob es zurück in den Umschlag. Barbara legte sich zurück auf ihr Kissen und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Wortlos blickte sie zur Decke. Für sie war unser Gespräch beendet.
»Mama sagt, du hättest ihn schon kennengelernt«, sagte ich.
»Er ist ja auch mein Cousin«, sagte Barbara. Sie winkelte das rechte Bein an. Unter der Bettdecke erkannte ich einen Fuß mit rot lackierten Nägeln.
»Was ist er für einer?«, fragte ich.
Barbara blickte mich unwillig von der Seite an. Plötzlich sagte sie gutgelaunt: »Ich habe ihn schon zweimal getroffen. Einmal auf dem Geburtstag seiner Mutter. Und einmal zu Ostern.«
»Ist er in Ordnung?«
»Natürlich ist er in Ordnung.«
»Er ist dreizehn - wie ich«, sagte ich.
»Er ist ein paar Monate älter als du«, sagte Barbara mit übertriebener Begeisterung. »Ich finde, er ist ein ganz toller Typ.« Etwas in ihrer Stimme schien andeuten zu wollen, ich sei kein toller Typ.
»Wie meinst du das?«, fragte ich.
»Man kann ihn nicht mit dir vergleichen.«
»Warum nicht?« Ich war bemüht, meinen Verdruss nicht preiszugeben.
»Er ist ganzanders. Und überhaupt!«
»Wie anders?«
»Viel reifer - und ...«
»Und was?«
»Warte es doch ab«, sagte sie. »Morgen wirst du ihn kennenlernen.«
»Was ist denn so toll an ihm?«
»Einfach alles. Er hat drei Zimmer. Tausend Sachen. Einen Computer. Er hat auch einen eigenen Swimmingpool und was weiß ich ...«
Es war nicht einzusehen, dass einer toll sein sollte, nur weil er drei Zimmer und einen Swimmingpool besaß. »Verstehe ich nicht«, sagte ich.
»Du verstehst so vieles noch nicht.« Am meisten störte mich das überhebliche noch aus ihrem Munde. »Wenn du rausgehst, mach bitte die Tür hinter dir zu. Ich möchte nicht gestört werden.«
Es ärgerte mich, denn sie spielte die große Schwester, die ihren jüngeren Bruder aus dem Zimmer schicken durfte. Als ich die Tür öffnete, wandte ich mich noch einmal um. »Was sagt Mama eigentlich dazu, wenn du deine Fußnägel rot anmalst?«, fragte ich verstimmt.
»Verschwinde!« Sie suchte nach einem Gegenstand, den sie nach mir werfen könnte. Aber ich schlüpfte schnell durch den Türspalt nach draußen.
»Habt ihr schon wieder Streit?«, ließ Mama sich aus dem Flur vernehmen.
»Was gibts zu essen?«
»Brot, Wurst, Käse«, sagte Mama.
»Sonst nichts?«
»Bin ich Krösus? Du kannst schon den Tisch decken, Florian.«
»Barbara hat heute Tischdienst«, sagte ich.
»Nein«, bestimmte Mama, »heute bist du an der Reihe!«.
»Ich helfe dir auch mit«, sagte Moritz und zog an der Schublade, die mit einem klirrenden Knall auf den Küchenfußboden polterte.
Am Donnerstag brachte der Postbote eine Karte von Saskia, meiner Klassenkameradin, die mit ihren Eltern in Irland seit einer Woche Urlaub machte. Die Vorderseite der Karte war pechschwarz lackiert. Dublin bei Nacht stand in gelber Schrift unten rechts auf dem Bild. Leider regnet es die ganze Zeit, schrieb sie. Ich freue mich schon wieder auf zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüs bis bald - DeineSaskia. Ich legte die Karte in meinen Schuhkarton mit der Aufschrift I d e e n . Meinen letzten Einfall hatte ich noch nicht notiert. Auf einen Zettel schrieb ich: Eine Wäscheklammer im Gras. Ich setzte den Deckel auf den Karton und schob ihn zurück auf seinen Platz auf dem Kleiderschrank.
Schon mittags duftete es in unserer Wohnung nach Bienenstichkuchen, den Mama, sofort nachdem sie aus dem Markt heimgekehrt war, gebacken hatte. Nachmittags begann Mama, im Wohnzimmer Staub zu wischen.
»Ich helfe dir«, sagte Moritz eifrig. Er nahm einen trockenen Lappen und kreiste damit auf der Mattscheibe des Fernsehers. Hinterher saugte Mama den Teppich. »Ich zugucke dir«, sagte Moritz.
»Das heißt: Ich gucke dir zu«, verbesserte Mama ihn.
Ich stand im Türrahmen und überlegte, was ich machen könnte.
»Florian«, sagte Mama, die meine Unentschlossenheit bemerkte. »Du könntest dein Zimmer einmal aufräumen.«
»Es ist aufgeräumt«, sagte ich.
»Vorhin sah es nicht so aus«, fiel ihr ein. »Also denk bitte an den Besuch, den du erwartest.«
Widerwillig schlenderte ich in mein Zimmer. Es war nicht einzusehen, warum ich für meinen Cousin besondere Anstrengungen unternehmen sollte. Hatte irgendwer meinetwegen je sein Zimmer aufgeräumt? Dennoch faltete ich die Bettdecke, zupfte das Laken zurecht, ordnete meine Schreibplatte in der Fensterbank und entstaubte das kleine Lämpchen darauf. Die Cassetten sortierte ich in die Plastikhüllen und legte sie zu den Büchern in den Bollerwagen, in dem auch mein kleiner Recorder stand. Das Regal neben dem Fenster hing ein wenig schräg an der Wand. Ich bog es gerade und verrückte die Bücher, um sie vorn mit den Brettkanten bündig abschließen zu lassen. Auf dem blauen Teppichläufer lag eine wollene Fluse, die ich aufhob und in den Papierkorb schweben ließ. Mehr mache ich nicht, dachte ich.
Ich hörte plärrende Radiomusik aus Barbaras Zimmer. Es interessierte mich, wie weit sie mit dem Aufräumen war. Durch das Schlüsselloch konnte ich nichts erkennen. Offensichtlich hing ein Putzlappen innen auf der Klinke. Nachmittags wurde Barbara von ihrer Freundin Ivon in die Badeanstalt abgeholt. Fast wünschte ich, sie wäre für den Besuch meines Cousins zu Hause geblieben. Es widerstrebte mir, in diese unterschwellige Aufgeregtheit zu Hause einzustimmen. Ich nahm mir vor, mich betont gelassen zu geben.
Endlich fuhr am späten Nachmittag ein Wagen vor. Nacheinander fielen zwei Türen zu. Es klingelte an unserer Haustür. Mama öffnete und führte den Besuch durch den Flur ins Wohnzimmer.
»Das also ist dein Vetter Florian«, sagte Mamas Schwester, Tante Martina, zu ihrem Sohn.
Mit zwei Krücken humpelte Berthold heran und reichte mir seine rechte Hand. »Tag«, sagte er. »Wie gehts?«
»Gut«, sagte ich.
»Wer ist der Knirps?«, fragte Berthold mich.
Bevor ich antworten konnte, sagte Mama: »Das ist Moritz, dein kleiner Cousin.«
»Bin kein Knirps«, sagte Moritz schmollend.
»Nein, bist du auch nicht«, sagte Tante Martina. »Berthold, du benimmst dich unmöglich!«
»Kann ja wieder gehen.«
Ich sah, wie Tante Martina gereizt die Lippen aufeinanderpresste und durch die Nase einatmete.
»Warum setzt ihr euch denn nicht?«, sagte Mama. »Ich hole den Kaffee aus der Küche. Der Kuchen steht schon bereit.«
»Ja, gut«, sagte Tante Martina und nahm auf dem Sofa Platz. Sie warf Berthold einen missbilligenden Blick zu. »Du bist den ganzen Tag schon wie von einer Wespe gestochen«, entfuhr es ihr.
»Lass mich doch in Ruhe«, sagte Berthold mit uneinsichtigem Gesicht.
»Ja«, sagte Mama, als sie uns Kaffee und Kakao einschenkte, »ich glaube, wir müssen uns langsam damit abfinden: Unsere heranwachsenden Söhne entwickeln ihre eigenen Vorstellungen.«