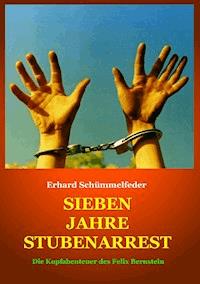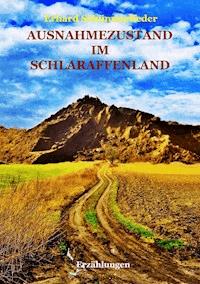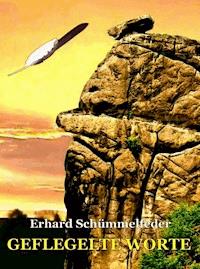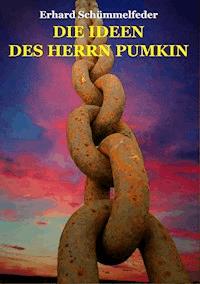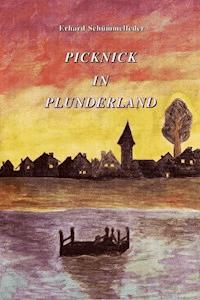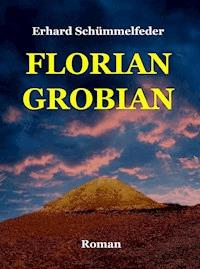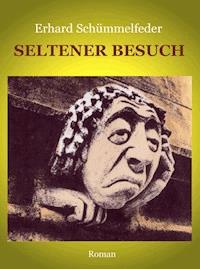
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Sommerferien lernt Tobias in einer Jugendherberge seinen sensiblen Stiefbruder Andy kennen. Der idealistische Andy wird von gleichaltrigen Jugendlichen unterdrückt. Als Tobias Andy vor den anderen beschützen will, kommt es zu Prügeleien unter den Jugendlichen. Gemeinsam verlassen Tobias und Andy die Feriengruppe und suchen Unterschlupf bei Onkel Nelles, einem nörglerischen Zyniker, den die Leute nicht ohne Grund "Kinderfresser" nennen. Die Begegnung von vollkommen unterschiedlich geprägten Menschen steht im Mittelpunkt dieses Romans, der das Tragische mit dem Komischen zu verbinden versucht. - LESERSTIMMEN: "Moderner Stoff in einer zeitlosen, ganz eigenen Sprache ... spritzig, witzig und originell." (MissGlueck) "Großartig und ausgereift!" (Antja M.) "... tiefgründig und spannend." (Kalindamarie) "Wunderbar lebendige Romanfiguren ..." (Liana) "Besser gehts nicht!" (Heike Wolter) * Dieses Werk gehört zu den Gewinner-Beiträgen im 4. neobooks-Wettbewerb 2011
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erhard Schümmelfeder
Seltener Besuch
oder Der Junge der keine Probleme hatte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Vorgeschichte
M o n t a g
D i e n s t a g
M i t t w o c h
D o n n e r s t a g
F r e i t a g
S a m s t a g
S o n n t a g
Das Ende der Geschichte
Impressum neobooks
Die Vorgeschichte
Der Zyniker Cornelius Schenkhut war bekannt für seine bissigen Reden, in denen er sich über die Dummheit in der Welt ereiferte. Nur selten bekam er Besuch von Verwandten; Bekannte und Nachbarn gingen ihm aus dem Weg, weil seine beleidigenden Bemerkungen zu Fragen des menschlichen Miteinanders stets in Streit ausarteten. Oft beklagte er voller Verbitterung die Verdorbenheit des Lebens und die schier grenzenlose Torheit der Menschen. Am Fenster seiner Küche sitzend, schickte er in Selbstgesprächen üble Flüche in die Welt hinaus, um seinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen. So lebte der nörglerische Mann allein in seinem Haus am Rande des Bevertals.
Unter den Kindern der Nachbarschaft wurde Cornelius Schenkhut nur der Kinderfresser genannt, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass mit diesem Zeitgenossen nicht zu spaßen sei. Auch Prospektverteiler und Handelsreisende, die den hitzköpfigen und rechthaberischen Sonderling längst kannten, mieden das Haus, denn hier war nichts zu bewegen oder gar zu holen.
Einmal im Jahr, zumeist im Frühling, verirrten sich zwei Männer in die Straße, an deren Ende Cornelius Schenkhut wohnte. Immer war einer der beiden Männer uniformiert, während der andere Zivilkleidung trug. Die von Jahr zu Jahr wechselnden Spendensammler des Kyffhäuser Soldatenbundes schellten auch jedes Mal an der Haustür von Cornelius Schenkhut, um ihr Anliegen vorzutragen: »Guten Tag, wir sammeln für die Kriegsgräberpflege in Russland. Möchten Sie etwas spenden?« Die Sammelbüchse, die stets von dem uniformierten jungen Mann gehalten wurde, veranlasste Cornelius Schenkhut im ersten Jahr dazu, ein bissig hingebelltes »Nein» ertönen zu lassen, bevor die Tür sich vor den verdutzt-erschrockenen Männern wieder verschloss. Im darauffolgenden Jahr wiederholte er seine schroffe Verneinung und ließ die Tür mit Wucht ins Schloss fallen. Im Laufe der Zeit wurde der Besuch der Spendensammler zu einer fast willkommenen Abwechselung im eintönigen Leben des alten Mannes. Einmal zwang er sich zu einem sarkastisch-freundlichen »Nein«, wobei er seine nicht mehr vollständig vorhandene Zahnreihe entblößte, während er zwölf Monate später einen gelangweilten und gleichgültigen Kommentar äußerte.
Da es keine anderen Auseinandersetzungen mit dem Leben und den Menschen gab, war der Besuch der Spendensammler gleichzeitig immer eine Gelegenheit, den angestauten Groll mit leidenschaftlicher Inbrunst hinauszubrüllen. Sobald er die beiden Männer in der Straße auf sein Haus zukommen sah, rieb er sich die Hände anlässlich der bevorstehenden Begegnung, auf die er zwölf Monate schimpfend gewartet hatte. Die Palette seiner Nein-Variationen war bunt und voller Gefühlsregungen: sachlich, lauthals, drohend, fauchend, hustend, krächzend, hämisch grinsend, verächtlich glotzend, empört prustend und einmal sogar gekünstelt singend, hatte er seine ablehnende Haltung bekundet.
Seine verbale Ausdrucksweise wich bald einer nonverbalen Form: Einmal schüttelte er nur mit zusammengepressten Lippen sein Haupt. Im darauffolgenden Jahr vollführte er schadenfroh grinsend ein bedauerndes Achselzucken. Nie erlaubten sich die Bittsteller ein Wort des Widerspruchs oder gar der Kritik; immer zogen sie sich kommentarlos zurück und gingen weiter zur nächsten Straße.
Wieder einmal schellte es an der Haustür. Wieder öffnete Cornelius Schenkhut, doch ließ er dem Sprecher keine Zeit, seine Bitte vorzutragen und sagte nur knapp: »Nein, nein und nochmals nein.« Schon wollte er die Tür zuschlagen, da fragte der Uniformierte mit der Sammelbüchse interessiert: »Und warum nicht?«
Die unverhoffte Frage irritierte Cornelius Schenkhut einen Moment. Schweigen. Nachdenken. Endlich fasste er sich und schnauzte den Männern seinen Standpunkt ins Gesicht: »Für Kriegsopfer spende ich, für Kriegstäter aber nicht. Basta!«
Von seinem Fenster aus beobachtete er die beiden Männer, die sich eilig aus der Straße entfernten. Bevor sie seinen Blicken entschwanden, zog der Mann in Zivil ein Notizbuch aus der Jacke und notierte etwas mit einem Stift. Aha, dachte der Zyniker, das saß!
Im folgenden Frühling hockte Cornelius Schenkhut wieder am Fenster seiner Küche und äugte lauernd die Straße entlang. Endlich erblickte er die beiden Sammler, deren Gesichter er nicht kannte. Vergeblich rieb er seine Hände, denn nachdem sie das vorletzte Haus der Straße besucht hatten, kehrten sie um, ohne sein Haus auch nur zu beachten. Die Flüche, die Cornelius Schenkhut ausstieß, können an dieser Stelle nicht alle wiedergegeben werden. Nur soviel sei versichert: sie waren recht übel und keinesfalls gesellschaftsfähig.
Im folgenden Frühling blieb der Besuch der Spendensammler wieder aus. In diesem Leben, soviel hatte Cornelius Schenkhut begriffen, würde er wahrscheinlich keine Spendenbitten mehr hören. Hatte er sich richtig verhalten? Ja, ja und nochmals ja, sagte er sich. Kein Wort würde er je von seiner Meinung zurücknehmen.
Trotzdem vermisste er merkwürdigerweise den Besuch der beiden Männer.
*
Tobias Schenkhut hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, alle Ereignisse seines Lebens mit Sympathienoten zu versehen. Die Ferien in der Weserstadt Höxter bewegten sich auf seiner imaginären Bewertungsskala launisch zwischen 1 und 6. Heute würde er auf dem Bahnhof den Jungen treffen, der keine Probleme hatte...
So könnte ein Roman aus der Sicht eines allwissenden Erzählers beginnen...
4 minus, dachte er, als ihm einfiel, dass es keine Möglichkeit gab, die erste Begegnung mit seinem Stiefbruder Andy an einen günstigeren Ort zu verlegen...
Aber ich bin nicht allwissend. Ich möchte aus meiner subjektiven und somit begrenzten Sicht etwas erzählen über den lange zurückliegenden Sommer, der ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte ist. Es ist die konfliktlastige Beschreibung vom Zusammentreffen dreier Menschen mit unterschiedlicher Prägung: Ein Realist, ein Idealist und ein grantiger Zyniker verbringen einige Tage in einem Haus auf dem Lande. Ich will versuchen, die merkwürdigen Ereignisse dieser Begegnung in Worte zu fassen. Mein Interesse für Menschen und die oft verborgenen Beweggründe ihres Handelns war in der Zeit meines neunzehnten Lebensjahres nur schwach entwickelt. Tiefgreifende Reflexionen über die prägenden Faktoren in der Lebensgeschichte anderer Leute, die mir begegneten, beschäftigten mich nicht. Die wesentlichste Erfahrung dieses Sommers - der plötzliche und unerwartete Tod eines mir nahestehenden Menschen - hat bis zum heutigen Tag Spuren in meinem Denken hinterlassen. In manchen Augenblicken sehne ich mich danach, die Zeit zurückzudrehen, um das Lebensgefühl dieses Sommers noch einmal zu erleben.
Wie soll ich mit meiner Schilderung anfangen?
Allein die Vorstellung, dass ein Junge namens Andy nun mit seiner Mutter unter einem Dach wohnte, war noch gewöhnungsbedürftig. Nach der Trennung seiner Eltern hatte seine Mutter wieder geheiratet und hieß nicht mehr Schenkhut, sondern Simon. Ihre Absicht, Tobias und Andy zusammenzuführen, war vereitelt worden durch eine Sommergrippe. Mit einwöchiger Verspätung sollte Andy gleich in der Stadt eintreffen, um die verbleibenden sechs Tage »unter Jungen seines Alters« zu verbringen...
Nein, das ist noch nicht der Ton jener Melodie, die in meiner Erinnerung spielt, wenn ich an meine erste Begegnung mit Andy denke. - Ich halte in Gedanken die Zeit an und spule sie - wie einen Film - zurück bis zu dem Julitag, an dem die Geschichte beginnt...
M o n t a g
Ich bin unterwegs. Als ich die Stufen zum Bahnhofsgebäude hinauf steige, schlägt die Kirchturmuhr über den Dächern der Stadt elf Mal. Ich öffne die Eingangstür, gehe durch den Warteraum auf den Bahnsteig hinaus und höre aus dem Lautsprecher die Ankündigung des in Kürze eintreffenden Zuges. Auf der Bank verschränke ich beide Arme vor der Brust und blicke zur Nebenbank, auf der ein Junge Gitarre spielt. Kenne ich das Lied? Klingt wie Kein schöner Land. Ich meine, Passagen der Nationalhymne aus dem Saitenspiel herauszuhören.
1, denke ich.
Dann fällt mir der gestrige Telefonanruf meiner Mutter ein.
»Andy ist schon sehr gespannt auf seinen Stiefbruder. Ich bin sicher: Ihr werdet euch gut verstehen.«
5, geht es mir durch den Sinn.
»Andy ist der sanftmütigste Junge der Welt. Er ist ein Mensch, der bislang keine Probleme hatte.«
»Dann ist er wohl zu beneiden.«
»Das glaube ich kaum. Ich finde, er ist zu viel allein. Ich wünschte, er hätte ein paar Probleme, denn daraus könnte er etwas fürs Leben lernen. Übrigens ist das der Grund, weshalb ich dich anrufe.«
5.
»Verstehe. Du meinst, wenn es um Probleme geht, ist er bei mir gut aufgehoben.«
»Tobias, du sprichst mir aus der Seele. Er sollte öfter mit Jungen seines Alters zusammen sein. In der Vergangenheit hast du oft bis zum Hals in irgendwelchen Schwierigkeiten gesteckt. Es hat dir aber nie geschadet. Versprichst du mir, dich ein wenig um Andy zu kümmern?«
6.
»Ja, ich werde es versuchen.«
»Du bist ein Schatz.«
»Mama, wir haben hier in unserer Gruppe auch etliche Grippefälle. Es wäre nicht gut für Andy, wenn er sich noch einmal anstecken würde.«
»Keine Sorge, Tobias. Unser Hausarzt hat für die Reise grünes Licht gegeben.«
Grünes Licht.
6.
Von meinem Platz aus sehe ich den weißen Raddampfer, der mit vergnügt winkenden Gästen auf der Weser stromaufwärts fährt. Die beiden Bahnschranken senken sich. Auf der Brücke stauen sich die Autos zu einer blechernen Schlange. Reisende mit Koffern hasten auf den Bahnsteig. Fast lautlos fährt der Zug ein. Türen öffnen sich zischend. Leute steigen aus, Leute steigen ein. Trotz meines Verdrusses bin ich insgeheim auch ein wenig neugierig auf den Jungen, der bislang keine Probleme hatte. Ich bleibe sitzen und lasse meinen Blick zwischen den eiligen Fahrgästen prüfend hin und her wandern. Kichernde Mädchen mit Lippenstift-Herzen auf den Wangen. Ein junger Bursche mit wallenden Haaren und Stirnband geht mit dem Gitarristen zum Ausgang. Ritterlich schleppt ein weißhaariger Greis die beiden Koffer einer vornehmen Dame. Dann, als der Bahnsteig sich zu leeren beginnt, entdeckte ich Andy zwischen zwei Reisetaschen, einem Rucksack und einem länglichen Stoffbeutel. Er ist mindestens zwei Jahre jünger als ich ist, höchstens sechzehn.
4 minus, mein erster Gedanke.
Es ist ungerecht, einen Jungen nach einem oberflächlichen Blick auf seine äußere Erscheinung negativ zu bewerten. Weiß ich. Ohne darüber nachzudenken, habe ich ein Urteil gefällt: 4 minus. Woran liegt es? An seiner Kleidung? Ja, auch an der Kleidung. Jacke und Hose sind khakifarben. Altmännerklamotten. Braune Bergsteigerschuhe. Hm. Der Schnürsenkel seines linken Schuhs hat sich unbemerkt gelöst und liegt nun zur Hälfte unter einer Tasche auf dem Bahnsteigboden.
Das wird Probleme geben, denke ich und kann mich nicht entschließen, auf meinen Stiefbruder zuzugehen. Etwas hält mich zurück.
Was die Stimme aus dem Lautsprecher sagt, nehme ich nicht wahr. Der Schaffner hebt die Blechkelle und lässt die Pfeife zwischen seinen Lippen trillern. Die Türen des Zuges schließen sich zischend. Fast geräuschlos zieht die Kolonne der Wagen auf den Schienen davon. Ich sehe, wie Andy in die Brusttasche seiner Jacke fasst und ein silbernes Gerät hervorholt. Ein Handy? Nein, es ist ein Diktiergerät. Er blickt dem Zug nach, sieht, wie die Bahnschranken sich öffnen, während sich der Strom der wartenden Autos in Bewegung setzt. Andy hält das Diktiergerät vor seinen Mund, sagt ein paar Worte in den Mikrofonschlitz und steckt es zurück in die Tasche. Nanu. Erst jetzt sehe ich Andys Gesicht deutlich: ein argloses Gesicht, irgendwie heiter, zuversichtlich. Die Haare: blond, ordentlich nach links gescheitelt. Das spricht gegen ihn.
5, wenn nicht schlimmer.
Mit staunenden Augen betrachtet er die Häuserzeile auf der anderen Straßenseite. Der Kiosk, das Arbeitsamt, das Modegeschäft, die Kneipe, der Geschenkladen ... Frauen mit Kopftüchern, Touristen, Kinder, ein Bettler, ein Straßenfeger ... Was fasziniert meinen Stiefbruder an diesen Eindrücken?
Ich räuspere mich, stehe auf und gehe über den Platz zu Andy, der sich mit freudiger Erregung herumdreht.
»Dein Schuhband hat sich gelöst«, sage ich und weise auf den Steinboden. »Kannst du schon eine Schleife binden, oder willst du dir von deinem Stiefbruder helfen lassen?«
»Tobias! Ich dachte es mir gleich, als ich dich sah!«
Der Druck seiner Hand ist ohne Kraft, doch ungewöhnlich herzlich und anhaltend. »Sei gegrüßt, mein Bruder!« Er verschluckt sich vor Aufregung und fährt fort:»Ich ehre das Licht in dir!«
Ich kratze mich am Hinterkopf. »Ach, wirklich?«
»Das muss ich dir natürlich erklären«, sagt er. »Weißt du, die Menschen in Nepal begrüßen sich mit diesen schönen Worten. Für unsere Ohren klingt es vielleicht ein wenig ungewohnt.«
»Ungewohnt. Kann man sagen. Warst du schon einmal in Nepal? «
»Oh ja. Ich war auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, in Mexiko, in Norwegen und in Afrika.«
»Dann hast du ja einiges von der Welt gesehen.«
»Wahrhaftig, das habe ich. - Aber wozu in die Ferne schweifen - das Schöne liegt so nahe. - Ich bin fasziniert vom malerischen Weserbergland. Es ist eine poetische Landschaft, wie von Zauberhand geschaffen.«
Ich denke nur: Malerisch, poetisch, Zauberhand, du lieber Himmel. Schon wieder räuspere ich mich. »Ich helfe dir bei deinem Gepäck. Lass uns gehen.«
»Oh, das ist sehr nett von dir. Ich nehme immer zu viele Sachen mit auf eine Reise. Ist es weit von hier bis zur Jugendherberge?«
»Zu Fuß fünfzehn stramme Minuten«, sage ich und zwänge mich mit einer Tasche die Stufen der Treppe hinunter auf den Bürgersteig. »Sag mal, was schleppe ich hier eigentlich mit mir herum? Backsteine?«
»Ein Leben ohne Bücher kann ich mir nicht vorstellen«, bekennt Andy. »Kommen wir zu spät zum Mittagessen?«
»Es ist noch genügend Zeit. Wir essen um halb eins. Wenn ich nicht pleite wäre, würde ich dich vorher zu einem Eis einladen.«
»Ein Eis - das ist das richtige Stichwort zur richtigen Zeit. Auf der Stelle lade ich dich ein. Das lasse ich mir nicht nehmen.«
»Wie du meinst«, sage ich beim Überqueren der Straße, die in die Innenstadt führt. »In der Nähe ist ein Eis-Café. Dort können wir uns noch etwas unterhalten.«
»Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, dich endlich kennenzulernen.«
»Hm.«
Schon nach wenigen Minuten erreichen wir das Cafe´.
»Was darf ich Ihnen bringen?« fragt die dunkelhäutige Kellnerin kurz darauf, als wir im Schatten des Sonnenschirms die Eiskarte studieren.
»Bananensplit.«
»Ich nehme das Gleiche wie mein Bruder«, entscheidet Andy. Seine Stimme klingt feierlich.
»Dein Schuh ist ja immer noch offen«, bemerke ich.
»Stimmt. Dann will ich ihn schnell zubinden.«
Als das Mädchen durch die Eingangstür ins Innere des Cafés geht, werfe ich einen Blick auf die umliegenden Tische, die von kaffeetrinkenden Gästen besetzt sind. Von den Leuten aus der Herberge ist hier niemand zu sehen. Ich beschließe plötzlich, Andy gegenüber Klartext zu reden. »Es ist schon merkwürdig. Gestern hatte ich fast einen kleinen Zorn auf dich.«
»Einen Zorn?« Andy umfasst mit Zeigefinger und Daumen der rechten Hand einen Bügel seiner Brille. »Wie ist das möglich?«
»Ich will es dir erklären. - Die Jungs aus unserer Gruppe haben mich aus dem Zimmer geekelt, weil sie lieber mit dir zusammen sein wollen.«
»Ja, aber wissen sie denn nicht, dass wir Stiefbrüder sind?«
»Nein. Sie sollten es auch nicht erfahren. Du hättest nämlich sonst nur Scherereien.«
Andy denkt mit einer offensichtlichen Bestürzung über meine Worte nach. »Ich glaube, ich verstehe«, sagt er dann. »Ihr habt euch gestritten.«
»So ist es.«
»Wo schläfst du jetzt?«
»Am Anfang des Ganges im Erdgeschoss. Ich habe ein 4-Bett-Zimmer für mich allein.«
»Für mich wäre es vielleicht auch besser, wenn ich in einem Einzelzimmer schlafen würde«, überlegt Andy im Flüsterton. Es klingt wie ein peinliches Geständnis.
»Weshalb?«
»Erstens bin ich gern allein und zweitens möchte ich niemanden stören bei meinen abendlichen Atemübungen.«
»Was für Atemübungen?«
»Weißt du, es sind Meditationen, bei denen ich vollkommene Entspannung finde.«
»Hast du diese Methoden auch aus Nepal mitgebracht?«
»Ja.«
»Also, Andy, es geht mich nichts an, was du für Übungen machst. Aber ich möchte dir den Rat geben, den Jungs in der Gruppe nichts davon zu erzählen.«
»Warum nicht?« fragt er arglos.
Ich versuche, meinen Standpunkt in passende Worte zu kleiden: »Die Jungs im Zimmer würden sich totlachen.« Während ich das ausspreche, fühle ich mich wie ein Schulmeister, der einen Schüler belehrt.
»Totlachen? »Du meinst, sie würden es befremdlich finden?«
»Glaubs mir doch. Du solltest ihnen auch den nepalesischen Gruß verschweigen. Die Jungs wissen, was eine Disco-Lightshow ist; mit dem Begriff Laserkanone können sie etwas anfangen; aber wenn du ihnen sagst, du würdest das Licht in ihnen ehren, werden sie dir den Puls fühlen und dich fragen, ob du noch alle Tassen im Schrank hast.«
Andy wirkt betroffen. »So ist das also hier.«
»Ja, ich kanns nicht ändern.«
Die beiden Taschen und der Rucksack lagern auf einem der freien Stühle am Tisch, während der längliche grüne Stoffbeutel noch immer an einer Schnur über Andys Schulter hängt.
»Was trägst du denn in dem Beutel mit dir herum?« erkundige ich mich.
»Oh, das ist mein kleines Geheimnis. Aber dir werde ich es heute Abend verraten.«
»Da bin ich aber gespannt. Was hast du vorhin in dein Diktiergerät gesprochen, wenn ich dich danach fragen darf?«
»Weißt du, Tobias, ich schreibe alle meine Eindrücke in mein Grübel-Buch. Unterwegs zeichne ich die eine oder andere Wahrnehmung mit dem Diktiergerät auf, damit ich sie nicht vergesse.«
»Interessant.«
»Finde ich auch. Es gibt so viele Beobachtungen und Empfindungen, die ich festhalten möchte. Wie vorhin auf dem Bahnhof.«
»Ach. Welche Empfindung hast du in diesem Augenblick?«
»Um ehrlich zu sein: Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich war noch nie mit fremden Jungen auf einem Zimmer. Könnte ich vielleicht mit dir zusammen -«
»Nein, könntest du nicht. Ich habe mit meiner Mutter über dich gesprochen. Sie hat mir dein Problem erklärt. Du bist ein Bücherwurm und kennst fast nur Büchermenschen. Meine Mutter meint, du solltest auch einmal ein paar Leuten aus Fleisch und Blut begegnen.«
»Damit hat sie bestimmt recht. Aber -«
»Mach dir keine Sorgen. Bleib cool. Ich bin immer in deiner Nähe. Dir wird schon nichts Schlimmes passieren.« Mein Gott, denke ich. Jetzt rede ich, als wäre ich doppelt so alt wie er.
»Du machst mir wirklich Mut. Sind die anderen Jungs in der Herberge denn nett?«
»Was weiß ich. Sind zumindest keine Unmenschen oder so. Sie haben ein paar Ecken und Kanten - aber wer hat die nicht?«
»Wahrhaftig, da stimme ich dir zu.«
»In der ersten Zeit solltest du versuchen, dich mit den anderen Jungen anzufreunden. Vergiss nicht: Niemand sollte von unserer geheimen Bruderschaft erfahren.«
»Aus welchem Grund hat es denn Streit zwischen dir und den anderen gegeben?«
»Es geht um ein Mädchen.«
»Ein Mädchen?«
»Sie heißt Monique. Das erkläre ich dir ein andermal.
Die Serviererin bringt das Eis auf den Tisch. Andy gibt ihr das Geld, nimmt den Löffel und probiert genüsslich mehrere Male eine dünne Sahnespur, wobei immer nur die Spitze des Löffels bedeckt wird. Sorgfältig seziert er die Bestandteile auf seinem Teller, bis die drei Eiskugeln - Erdbeere, Vanille, Schokolade – zwischen der längs zerteilten Banane sichtbar werden. Er fragt plötzlich kummervoll: »Wie heißen denn meine Zimmergenossen?«