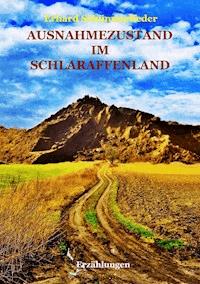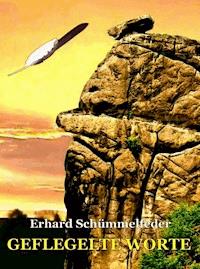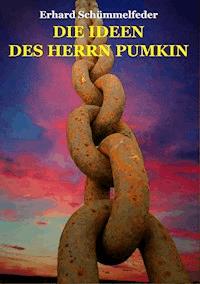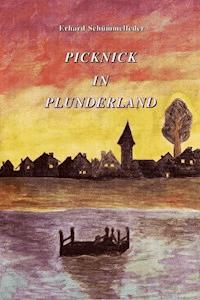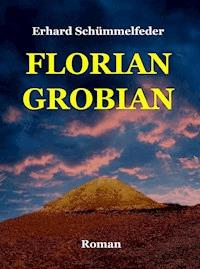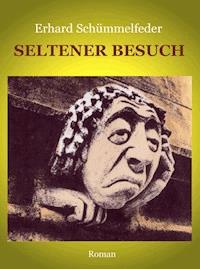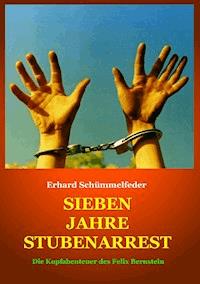
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felix Bernstein ist der erste Junge der Welt, der ständig von einem Erziehungs-Computer überwacht wird. Für jede positive oder negative Tat in seinem Leben registriert der Computer peinlich genau Plus- bzw. Minuspunkte auf seinem Verhaltens-Konto. Als Felix' Eltern eines Tages verreisen, manipuliert Cornelia, seine ältere Schwester, mit zwei Cousinen den Computer. Auf Felix' Konto befinden sich plötzlich mehr als sieben Millionen Minuspunkte.Fortan hat er sieben Jahre Stubenarrest. Während Olaf, sein bester Freund, ihn im Stich lässt, begreift der Junge, dass er sich nun auf seine eigene Kraft besinnen muss. Es gibt nur einen Weg, die Gefängnismauer zu überwinden: Er will versuchen, seine Peiniger und den Erziehungs-Computer zu überlisten. Aber wie? Hilfe erfährt Felix schließlich von Melinda, seiner jüngeren Schwester. - Die Kopfabenteuer des Felix Bernstein garantieren den Kennern satirsch-grotesker Katastrophengeschichten eine schwungvolle und facettenreiche Handlung für allerbesten Lesegenuss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erhard Schümmelfeder
SIEBEN JAHRE STUBENARREST
Die Kopfabenteuer des Felix Bernstein
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
NINIFEE
SIEBEN JAHRE STUBENARREST
WEITERE BÜCHER DES AUTORS
Impressum neobooks
NINIFEE
Die Träume der ersten Nacht
in einem fremden Haus
gehen in Erfüllung ...
Volksmund
Das fürchterlichste Strafurteil, das je über einen garstigen Jungen verhängt wurde, lautete streng und unerbittlich: Sieben Jahre Stubenarrest.
Oft wurde mir angedroht, »andere Saiten« für mich aufzuziehen, aber da meine Eltern beide berufstätig waren und nur wenig Zeit erübrigen konnten, verhallten ihre ausgesprochenen Warnungen vor »zügelnden Maßnahmen« meistens im Winde. Weil ich schon immer Schwierigkeiten bei der Einhaltung der geltenden Regeln des Lebens zeigte, machte mein besorgter Vater eines Tages aus dem erzieherischen Notstand eine höchst zweifelhafte Tugend, indem er das ALB-System entwickelte - ein vielseitiges Erziehungs-Computer-Programm, welches berufsbedingt abwesende Eltern bei der Bewältigung ihrer Hausaufgaben entlasten sollte.
Mein Vater, ein lächelnder Augenzwinker-Typ, geriet mit zunehmendem Alter immer mehr ins Grübeln. Beruflich war ihm das Lachen ein wenig vergangen: Eine gewisse Unzufriedenheit hatte sich bei ihm eingestellt, denn er verdiente unser tägliches Brot als kleiner und aussichtsarmer Angestellter mit der Installation elektronisch gesteuerter Sicherheitsanlagen für Banken und andere Geschäftshäuser. In seinen freien Stunden tüftelte er emsig an den Entwürfen für Video-Spiele, von denen er sich erhoffte, dass er sie eines Tages verkaufen könne. Anstelle des erwünschten Erfolges machte sich bei meinem Vater jene Erscheinung bemerkbar, die man gemeinhin die Midlife-Crisis nennt.
Auch meine Mutter, die halbtags als Ernährungsberaterin arbeitete, wurde vom Schicksal keineswegs verschont: Ihr Leiden nannte mein Vater »Klimakterium«. In meinen Ohren klang der Begriff wie »Klimakatastrophe«. Als ich meinen Vater nach der genauen Bedeutung des Wortes fragte, meinte er, ins Allgemeine abdriftend, es sei sozusagen eine »familiäre Klimakatastrophe«, von der wir zur Zeit alle mehr oder weniger betroffen seien.
Vermehrt wurde die leise schwelende Gereiztheit zu Hause durch meine streitbare Schwester Cornelia, die sich ebenfalls in einer »schwierigen Phase« ihres jugendlichen Lebens befand. Im Gegensatz zu Cornelia besaß meine fünfjährige Schwester Melinda keine nennenswerten Sorgen, was häufig der Grund dafür war, weshalb das mit Problemen randvoll gefüllte Fass nicht überlief.
Ich selbst sah der Einführung des Erziehungs-Programms anfangs gelassen entgegen, da ich wusste, dass mein Vater für den Erfolg seiner Forschungen ein geeignetes Studienobjekt benötigte. Allmählich aber verstärkte sich bei mir ein Gefühl von erlittener Ungerechtigkeit, da meine Eltern nicht in Erwägung gezogen hatten, bei Cornelia, die ständig »über die Stränge« schlug, einmal »andere Saiten« aufzuziehen. Ich meldete energischen Protest bei meinen Eltern an und forderte, auch Cornelia müsse mit ihrem zimmereigenen PC an den Zentral-Erziehungs-Computer in Papas Arbeitszimmer angeschlossen werden, damit man auch in ihrem besonderen Fall gegebenenfalls hart und entschieden »durchgreifen« könne. Papa versprach, sich die Sache einmal durch den Kopf gehen zu lassen, was aber erfahrungsgemäß einem höflich formulierten »Nein« entsprach.
Ich ahnte nicht, in welcher Gefahr ich mich bereits befand, als meine Eltern eines Abends im Mai bei Tisch den lang gehegten Entschluss fassten, ein Haus zu kaufen.
»Ein Haus wäre der Traum meines Lebens«, sagte Mama.
Romantisierend sagte Cornelia: »Ich möchte in einem weißen Haus am Meer leben.« Versonnen fügte sie hinzu: »Mit zwei Apfelschimmeln auf einer Wiese daneben.«
Papa räusperte sich nur, doch schien sein Blick zu sagen: Sonst hast du keine ausgefallenen Wünsche?
»Ich entscheide mich für einen heruntergekommenen Bauernhof mit einer Pferdekoppel und ein paar renovierungsbedürftigen Ställen«, sagte ich.
»Warum sollte es denn ein heruntergekommener Hof sein?«, erkundigte sich Mama, nachdem sie an ihrer Teetasse genippt hatte.
»Solche Kaufobjekte sind bedeutend billiger als neue Häuser«, erklärte ich ihr, wobei ich versuchte, meiner Stimme einen betont sachlichen Klang zu verleihen.
»Du hast manchmal einen ausgeprägten und lobenswerten Realitätssinn«, sagte Papa. Dann fiel ihm ein: »Den hast du von mir.«
Mama faltete ihre Hände und sagte entschieden: »Ich habe den größten Teil meines Lebens in baufälligen und öden Häusern zugebracht. Ich wünsche mir nur ein intaktes und hübsches kleines Häuschen im Grünen.«
»Nun, wir werden sehen, was sich machen lässt«, sagte Papa. »Ich will meine Fühler mal nach allen Seiten hin ausstrecken.«
»Ich möchte ein größeres Zimmer«, machte Melinda sich bemerkbar.
»Du bist bescheiden, mein Kind«, sagte Papa und strich ihr über den Kopf. »Ein größeres Zimmer sollst du haben. Selbstverständlich.«
Mama wollte einen weiteren Gedanken zum Thema äußern, doch dann fiel ihr Blick auf meine kleine Schwester. »Bist du müde, Melinda?«, fragte sie.
»Ja. Sehr.«
»Das kommt vom Eisenmangel«, erklärte Mama. »Ich habe mit dem Doktor über dich gesprochen. Der Eisenmangel ist auch der Grund für deine Gedächtnisprobleme.«
»Ja?«
»Hat der Arzt nichts verschrieben?«, fragte ich.
»Ja, das hat er«, sagte Mama. Aus dem Kühlschrank holte sie ein braunes Fläschchen hervor, schraubte den weißen Deckel herunter und goss eine rote Flüssigkeit auf einen Löffel, den sie meiner Schwester entgegenstreckte.
»Was ist das?«, fragte Melinda zögernd.
»Sieht aus wie Schweineblut«, bemerkte ich.
»Felix«, sagte Mama, »ich versuche gerade, deine Schwester mit Engelszungen davon zu überzeugen, wie hilfreich der Sirup ist. Mit deiner unpassenden Bemerkung demotivierst du sie leider.«
»Habe ich jetzt Redeverbot, Fernsehverbot und Ausgangssperre, nur weil ich gesagt habe, was ich gerade dachte?«, fragte ich.
Mama seufzte.
»Nein«, klärte Melinda die Situation. »Felix soll kein Redeverbot bekommen! Ich trinke gerne Schweineblut.« Sie beugte den Kopf vor, ließ sich den Löffel zum Munde führen und schluckte den Sirup rasch herunter.
»Trink noch einen Schluck Orangensaft«, forderte Mama sie auf.
»Als Kind litt ich auch oft unter Eisenmangel«, erinnerte Papa sich.
»Musstest du auch Schweineblut saufen?»
»Trinken«, verbesserte Cornelia mich.
»Viel schlimmer«, antwortete Papa. »Ich musste rohe Schweineleber essen.« Er schüttelte sich vor Ekel. »Es war die Hölle. Glaubt mir.«
»Ich glaube, wir sind jetzt ein wenig vom Thema des Abends abgewichen«, sagte Mama.
»Wenn wir kein Haus am Meer kaufen, will ich auf jeden Fall ein Zimmer beziehen, das nach Osten ein Fenster hat«, überlegte Cornelia.
»Ich dachte immer, der kalte Norden wäre die Himmelsrichtung, die am besten zu dir passt«, fiel mir ein.
Melindas Augen wanderten interessiert von einem zum anderen. »Warum der Norden?« erkundigte sie sich bei mir.
»Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Mittagslauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen.«
»Ach so.«
An Cornelias kritischem Blick erkannte ich, wie sie nach einer scharfzüngigen Entgegnung suchte, doch in das gereizte Schweigen hinein sagte Mama:
»Zur Verwirklichung unseres Traumes kann ich erheblich beitragen, wenn ich künftig nicht nur halbtags, sondern ganztägig arbeiten gehe.«
»Und wer kümmert sich um die Kinder?«, wollte Papa mit einem unterschwellig verborgenen Vorwurf wissen.
»Dein Computer«, sagte Mama unbeeindruckt. Es war mir nicht ganz klar, ob ihre Bemerkung ernst gemeint war. Sie fuhr fort: »Außerdem möchte ich mich beruflich verändern. Ich habe meine Fühler bereits ausgestreckt und den ersten Kontakt zu einem neuen Arbeitgeber hergestellt.«
»Aber davon wusste ich gar nichts«, sagte mein Papa leicht gekränkt.
»Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß.«
»Wer weiß«, antwortete er. »Um - um was für eine Arbeit handelt es sich denn, wenn ich fragen darf.«
»Du darfst«, sagte Mama. »Nachdem ich in der Vergangenheit zwanzig Jahre für die Gesundheit der Menschen geackert und gequasselt habe, möchte ich nun, dass es gut riecht in der Welt. Ich werde mit Beginn der kommenden Woche als Kosmetikberaterin ein wenig zur Finanzierung unseres Eigenheimes beisteuern.«
»Verstehst du denn etwas von Düften?«, fragte ich.
»In meiner Verwandtschaft ist der gute Geruchsinn erblich«, sagte Mama zufrieden lächelnd in die Richtung Papas, der nur uneinsichtig schwieg.
Ich schlug vor: »Für unser Haus könnte ich auch etwas Geld verdienen.«
»Und wie?«, fragte Cornelia zweifelnd.
»Ganz einfach. Ich könnte nach der Schule Werbezeitungen austragen und -«
»Irrtum, mein Sohn«, sagte Mama. »Das könntest du keineswegs.«
»Weshalb nicht?«
»Weil du nach der Schule auf dem Hosenboden sitzen wirst, um deine Bildungsdefizite auszugleichen.«
»Das finde ich auch«, sagte Cornelia zynisch und fragte mit gespielter Ahnungslosigkeit: »Ist Kinderarbeit in Deutschland nicht auch verboten?«
In der Schule erlangte ich eine gewisse Berühmtheit, als sich herumsprach, ich sei der erste Junge der Welt, der versuchsweise von einem Erziehungs-Computer-Programm überwacht und gesteuert werde.
Meine Klassenlehrerin, Frau Nethemeier, äußerte kopfschüttelnd Skepsis gegenüber der technischen Neuerung in meinem Leben, zumal mein allgemeines Leistungsniveau nach wie vor sehr zu wünschen übrig ließ. »Das Einzige, was dir fehlt, Felix, ist eine strenge Hand, die dir zeigt, wo es im Leben lang geht. Das sage ich.«
Über der Tür meines Zimmers befestigte mein Vater einen herkömmlichen Bewegungsmelder, der eine komplizierte Erkennungskamera mit eingebautem Mikrofon aktivierte. Die kostspielige Kamera, deren Herkunft mein Vater hartnäckig verschwieg, konnte meine Gesichtszüge exakt identifizieren und meine Stimme mit den gespeicherten Frequenzdaten vergleichen, weshalb eine Personenverwechselung unmöglich war.
Jeden Tag erschienen Mitschüler aus meiner Klasse bei uns zu Hause, um das ALB-System kennenzulernen. Ausgerechnet Olaf, mein bester Freund, war der Letzte aus der Klasse, der mich eines Nachmittags besuchte. Sein geringfügiges Interesse an dem Erziehungs-Programm hing damit zusammen, dass für ihn eigentlich nur drei Dinge zählten: Fußball, Comics und Fantasy-Romane. Für mich war es ein großer Vorteil, in der Öffentlichkeit mit einem sportlichen As wie Olaf gesehen zu werden, denn an unserer Schule wimmelte es von rauflustigen Rohlingen, die jede Gelegenheit wahrnahmen, ihre physische Überlegenheit an Schwächeren zu demonstrieren. Als Gegenleistung für den Schutz, den Olaf mir gewährte, ließ ich ihn regelmäßig bei Klassenarbeiten von mir abschreiben. Meine dürftigen Leistungen schienen seinen Ansprüchen vollauf zu genügen, denn er beklagte sich nie bei mir, obwohl sein allgemeiner Notendurchschnitt bei 4,0 lag. Als ich ihm einmal versprach, mich zu »bessern« riet er mir dringlich von diesem Vorhaben ab: »Nee, lass gut sein. Das würde sofort auffallen. Meine Eltern würden auch nie über meine Noten nörgeln. Sie wissen: Die Vier entspricht einer Beamten-Zwei.«
Ich führte Olaf durch den Korridor in mein Zimmer und schaltete den PC ein. Auf dem Bildschirm erschienen die gelb leuchtenden Buchstaben A L P in einem blauen Kreis.
»Bist du sicher, dass der Computer mich nicht mit dir verwechselt?«, fragte er mich, während er sich gleichzeitig auf den Schreibtischstuhl setzte.
»Ganz sicher«, sagte ich und zeigte ihm im Programm die Seite, auf der mein Eintritt ins Zimmer registriert worden war:
NAME: FELIX BERNSTEIN
DATUM: 3. MAI
UHRZEIT: 14 Uhr 2
»Unheimlich«, sagte er verblüfft. Er kaute mit schiefen Mundbewegungen einen Kaugummi. »Mich würde interessieren, ob ich auch erfasst worden bin.«
»Ja«, antwortete ich. »Bist du. Hier. Ich zeigs dir.« Ich blätterte bis zu der Seite, auf der die Eintragung erfolgt war.
NAME: UNIDENTIFIZIERTER BESUCH
MÄNNLICH
DATUM: 3. MAI
UHRZEIT: 14 UHR 3
»Ich trage jetzt deinen Namen ein. Dein Gesicht und deine Stimme sind schon gespeichert.« Dann tippte ich OLAF HALM in die Tastatur.
»Erklär mir, wie dieses Teufelsding funktioniert«, flüsterte er.
»Es ist im Grunde ganz simpel«, sagte ich. »Der Computer speichert alle Daten, die mit meinem Leben zu tun haben: Klassenarbeiten, Hausaufgaben, Zeugnisse, blaue Briefe, Beschwerden, Versäumnisse, Vergehen, Irrtümer, aber auch alles Positive. Für jede Registrierung gibt es Plus- oder Minuspunkte. Wenn sich 10 000 Minuspunkte angesammelt haben, bekomme ich Stubenarrest; außerdem wird mir das Taschengeld aufs Sperrkonto überwiesen.«
»Hat dein Vater sich dieses Punkt-System ausgedacht?«
»Ja. Er sammelt alle Daten, um daraus ein Video-Spiel zu entwickeln.«
»Also ist die ganze Apparatur keine ernste Sache, sondern nur ein Spiel?«
»Bis jetzt war es eher ein halbernstes Spiel, aber allmählich wird mir die Sache etwas lästig.«
»Warum?«
»Morgens, wenn ich zum Frühstück das Zimmer verlasse, prüft der Computer, ob ich mich gründlich gewaschen habe.«
»Wie kann er das prüfen?«
»Er ist mit dem Wasserzähler im Bad nebenan verbunden. Wenn der Wasserverbrauch 0, 00 Liter beträgt, zählt der Computer 1 000 Strafpunkte.«
»Schlimmer als meine Mutter.«
»Das kannst du laut sagen.«
Ich zeigte Olaf die Schreibtischfläche, über die eine Klarsichtfolie mit rechteckigen Linienfeldern geklebt war.
»Wozu sind die Felder unter der Folie?«, erkundigte er sich.
»Für die Ordnung auf dem Tisch«, sagte ich. »In dem großen Feld liegt die Schreibunterlage. Darüber steht die Schatulle mit den Stiften und dem Lineal. Daneben müssen die Büroklammern in der Dose aufbewahrt werden. Rechts außen ist der Platz für die Lampe. Alles muss auf seinem Platz sein. Die Sensoren melden jede Unordnung. Auch der Abfallkorb muss morgens geleert werden, sonst gibt es 100 Strafpunkte.«
»Hast du auch im Bett Sensoren?«
»Ja«, sagte ich.
»Welchen Zweck erfüllen die?«
»Bevor ich das Zimmer verlasse, soll ich das Bett machen. Die Decke muss glatt gezogen sein, damit die angenähten Sensoren mit den Sensoren am Laken in Berührung kommen.«
»Ist das nicht hirnrissig?«
»Glaub schon.«
»Kein normaler Mensch wird in aller Herrgottsfrühe gezwungen, sein Bett zu machen.«
»Ein Gefangener im Knast vielleicht.«
»Junge, Junge«, sagte er und blickte auf seine Uhr. »Das wäre nichts für mich. - Was - was machst du, wenn sich zu viele Strafpunkte auf deinem Konto ansammeln?«
»Es gibt eine WIEDERGUTMACHUNGS-Datei.«
»Das klingt schon etwas besser.«
»Soll ich dir erklären, wie die Sache mit der WIEDERGUTMACHUNG und den Pluspunkten funktioniert?«
»Nee, lass mal. Bin schon bedient. Außerdem hab ichs eilig. Muss zum Fußballtraining.«
»Fußball, Fußball«, sagte ich. »Immer nur Fußball. Du fängst an, dich einseitig zu entwickeln. Du solltest auch mal ein gutes Buch lesen, anstatt immer nur in billigen Comics zu schmökern.«
»Punkt eins«, sagte er. »Fußball ist nicht nur eine Sportart. Fußball ist eine Weltanschauung mit eigenen Gesetzen. Hier hat alles seine Ordnung. Anpfiff.Anstoß. Abstoß. Foul. Gelbe Karte. Rote Karte. Elfmeter.Sieg. Niederlage. Abpfiff und so weiter ... - Du siehst das alles zu negativ. Außerdem: Ich will ein Profi werden. Entweder man setzt seine ganze Energie in eine Sache oder man lässt die Finger davon. Halbe Sachen mache ich nicht. Punkt zwei: Comics sind gut. Fertig. Aus.«
»Fußballspielen ist nicht ungefährlich«, fiel mir ein. Es war ein schwaches Argument.
»Wer hat dir denn diesen Unsinn erzählt? Der Computer?«
»Ich habe einen Bericht gelesen über Gehirnerweichung bei Fußballspielern als Folge von Kopfbällen.«
»Glaube ich nicht«, sagte er.
»Dann lass es bleiben. - Ich habe dich jedenfalls gewarnt.«
»Danke. Du bist ein wahrer Freund.« Er nahm seinen Kaugummi aus dem Mund. »Darf ich den in deinen Abfallkorb werfen?«
»Ja, wenn du ihn mit Papier umwickelst.«
Später, als ich Olaf zur Haustür brachte, sagte er zum Abschied: »Vergiss nicht, morgen früh dein Bett zu machen. Sonst gibts wieder Strafpunkte.«
Die Suche nach einem Haus, das allen Wünschen unserer Familienmitglieder gerecht werden konnte, erwies sich als schwierig und zermürbend. Um Kosten zu sparen, wollten meine Eltern auf einen Makler verzichten. Daher studierten sie beinahe täglich die Immobilienangebote in unserer Tageszeitung. Unzählige Telefonate mit verkaufswilligen Hausbesitzern wurden geführt. Termine platzten oder wurden verschoben. Zig Besichtigungen in der näheren Umgebung des Weserberglandes blieben ohne Ergebnis. Hunderte Kilometer legten meine Eltern im Auto zurück, immer auf der Suche nach der Erfüllung ihres Traumes. Ein Angebot aus Höxter lehnte mein Vater rigoros ab: »Hier will ich nicht wohnen!«
»Aber hier ist doch eine schöne Gegend«, sagte Mama. »Keine Industrie. Ruhige Lage. Entspannte Atmosphäre ...«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte Papa und wies vom Bürgersteig in die Richtung einer cremegelben Villa, in deren Vorgarten uns ein Rottweiler aus einem Hundezwinger entgegenkläffte. »Ich suche mir meinen Nachbarn sorgfältig aus.«
»Kennst du denn den Mann, dem das Haus gehört?«, fragte Melinda und zupfte an seiner Jacke.
»Natürlich kenne ich ihn. Ich sehe ihn jeden Tag. Von morgens bis abends. Wenigstens in meiner freien Zeit möchte ich ihn nicht sehen.«
»Wer ist der Mann?«
»Mein Chef.«
In Karlshafen fanden wir ein schmuckes Haus am Waldrand, das nicht infrage kam, weil es eine Million kostete.
»Ist eine Million die höchste Zahl, die es gibt?«, fragte Melinda Papa während der Rückfahrt auf der Landstraße, von der aus wir Paddler auf der Weser sehen konnten.
»Nein«, antwortete er. »Nach einer Million kommt eine Milliarde. Danach kommt eine Billion.«
Melinda überlegte angestrengt. Dann stellte sie die Frage, die sie beschäftigte: »Aber was kommt nach der Billion?«
Ich wollte es ihr verraten, aber Papa kam mir zuvor und antwortete gedankenverloren:
»Nach einer Billion kommt eine Billgates.«
Ein Verkaufsangebot aus Dalhausen wurde von Mama rundweg verworfen. »In Dalhausen kann ich nicht wohnen.«
»Würdest du mir den Grund verraten?«, fragte Papa mit schwindender Geduld.
Entschieden sagte Mama: »Jeder weiß, dass sich die Uhren in Dalhausen langsamer drehen als anderswo auf der Welt. Die Dahlhausener sind die westfälischen Bayern. Reicht das als Erklärung?«
Papa brummte nur etwas Unverständliches in sich hinein und strich die kleingedruckte Anzeige in der Zeitung mit dem Kugelschreiber durch.
Mit vergnügtem Gesicht kam mein Vater am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause. Er erschien zwei Stunden später als üblich und sang sein Lied (Floh zu sein bedarf es wenig, und werFloh ist, ist ein König ...), und wir wussten sofort: Er war »fündig« geworden.
»Nun erzähl schon!«, platzte Cornelia heraus, nachdem er seine Jacke an den Garderobenhaken gehängt hatte.
»Was wollt ihr denn hören?«
»Stichwort Traumhaus«, half Cornelia ihm auf die Sprünge.
»Geduld«, sagte er feierlich. Erst will ich mich an den Tisch setzen, eine Tasse Kaffee trinken und ein Stückchen Sandkuchen knabbern. Dann werde ich Bericht erstatten.«
Er zelebrierte die sich ins Unerträgliche steigernde Spannung, während Mama skeptisch an ihrem Platz saß und ungeduldig mit den Fingern auf der Tischplatte einen Stepptanz vollführte. Scheinbar gleichgültig blätterte sie in einem Frauenjournal und wartete, bis mein Vater die letzten Kuchenkrümel gegessen hatte.
Nun?« sagte sie mit erhobenen Brauen.
»Ich habe eine neue Heimat für uns gefunden«, brach Papa sein Schweigen. Aber die Spannung löste sich nicht auf.
»In welcher Stadt?«, fragte Mama »Oder sollte ich sagen: In welchem Kuhkaff?«
»Hier im Ort«, antwortete er.
»Ein neues Haus?«, wollte Cornelia wissen.
»Nicht ganz neu.«
»Also alt«, stellte Mama fest.
»Sei beruhigt. - Es ist jedenfalls keine 400 Jahre alt.«
»Das klingt wenig aussichtsreich. Ist es vielleicht nur 200 Jahre alt?«
»Du wirst begeistert sein«, versprach Papa, »wenn du hörst, um welches Gebäude es sich handelt.«
»Da bin ich aber gespannt.«
»Ich auch«, sagte ich.
»Nun erzähl schon«, forderte Melinda ihn auf.
»Es ist das Haus der aufgehenden Sonne.«
»The House Of The Rising Sun«, bemerkte Cornelia ernüchtert. »Ich ahne Unheilvolles.«
Betont sachlich fragte Mama: »Wo steht denn das Haus?«
»In der Bahnhofstraße.«
Mamas Augen wanderten nach links in die Höhe. Dann sagte sie: »In der Bahnhofstraße gibt es nur ein Gebäude, wenn ich mich richtig entsinne.«
»Stimmt«, sagte Papa nickend. »Es ist der alte Bahnhof.«
Am Ende der leicht ansteigenden Kastanienallee lag der stillgelegte Bahnhof unserer Stadt. Wir parkten den Wagen auf dem kleinen Vorplatz. Papa zog knarrend die Handbremse an, während Mama noch einen Moment auf ihrem Platz sitzen blieb und das Gebäude musterte. Ihr Gesicht zeigte entschiedene Missbilligung, als sie endlich mit uns ausstieg. Ihre Enttäuschung war begründet. Das hoch aufragende Gebäude hatte eine einfallslose Kastenform mit einem Dach und zwei Erkern. Anthrazitfarbene Eternitplatten waren als Verkleidung angebracht worden. An einigen Stellen der Außenwände fehlten die quadratischen Verkleidungsplatten: Man sah sofort die Schäden, die der Regen an dem darunter liegenden Holzgerüst angerichtet hatte. Die Farbe von den weißen Holzfenstern löste sich. Um das Haus herum türmten sich Bauschutt und Gerümpel. Im Vorbeigehen sah ich verrostete Fahrräder, ein ausgebranntes Autowrack, ein paar Sessel mit offenen Federkernen und ein regendurchweichtes Sofa.
»Also doch eine Bruchbude«, murmelte Mama. »Wie ich es mir gedacht hatte.«
»Du wirst deine Ansicht schnell ändern«, sagte Papa, »wenn du siehst, welche Möglichkeiten dieses wunderschöne Haus uns bietet.«
»Im Moment vertrete ich die Ansicht, dass ich hier nicht einmal tot überm Zaun hängen möchte.«
»Jetzt übertreibst du aber wirklich, Schatz.«
Papa zog den Schlüssel, den er zuvor von der Stadtverwaltung besorgt hatte, aus seiner Jackentasche und öffnete die verglaste Eingangstür. Es roch ein wenig nach offenem Müllsack, fand ich, doch behielt ich meine Wahrnehmung für mich. Durch den ehemaligen Warteraum mit dem Fahrkartenschalter führte mein Vater uns in das Bahnhofscafé. Der hohe Raum mit der gewölbten Decke, von der sechs verstaubte Kronleuchter herabhingen, vermittelte den Eindruck einer Kathedrale. Hinter einer langgestreckten Eichentheke war eine Spiegelwand. An der gegenüberliegenden Seite befanden sich Sitznieschen mit rot gepolsterten Bänken. Einbeinige Tische mit vier Füßen und runder Tischfläche hatte man in der Mitte des Raumes aufgestellt. Die dazugehörigen Stühle ruhten, zu Türmen aufeinandergestapelt, an einer der beiden Säulen.
Hinter der Fensterreihe mit der Ausgangstür konnten wir den Bahnsteig sehen. Die Uhr unter dem Vordach war auf 15 Uhr 39 stehen geblieben.
»Hier möchtest du wohnen?«, fragte Mama, ohne Papa anzublicken.
»Hier natürlich nicht. Die untere Etage des Hauses soll zum Broterwerb genutzt werden. Zur Zeit bin ich beruflich ein Floh. Aber eines Tages werde ich ein Gigant sein, mich selbstständig machen und alle Kontinente der Erde mit meinen Video-Spielen überschwemmen. Ich werde ein Firmenimperium aufbauen.«
»Bis es soweit ist, möchte ich unter menschenwürdigen Bedingungen in einem halbwegs akzeptablen Haus wohnen«, sagte Mama gepresst.
»Die oberen Etagen sind so gut wie bezugsfertig. Kommt, ich zeige euch, wo die Treppe ist.«
»Etwas exotisch ist das Haus in der Tat«, bemerkte Cornelia, als wir weitergingen. »Aber ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen.«
Durch eine Tür im Warteraum gelangten wir zu der breiten Holztreppe, die in die oberen zwei Etagen führte. Hinter einer Rundbogentür mit mattem Sichtfenster lag die großzügig angelegte Wohnung im ersten Stock.
Papa kratzte vorsichtig über die nylonstrumpfartige Glasscheibe, wobei ein reißverschlüssiges Ssssst! erklang. »Chinchillaornament«, erklärte er vielversprechend.
»Fantastisch.«
Das Sonnenlicht warf die Schatten der Flurfensterkreuze schrägt über den Parkettboden. Papa zeigte uns die leeren Räume: »Wohnzimmer, Küche, Bad, Gästezimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Aussicht auf den Mühlenberg, den Kapellenberg, den Galgenberg, den Selsberg. Hier liegen die beiden Zimmer für unsere Mädchen.« Er wandte sich salbungsvoll an Mama: »Und dieser besondere Raum wird dein Büro. Oder sollte ich besser deinKosmetik-Beratungs-Studio sagen?«
Mama zuckte nur die Achseln und blickte aus dem Fenster in den verwilderten Obstgarten hinter den Bahngleisen. »Gehört der Dschungel auch zum Haus?«
»Aber ja doch.«
»Was ist mit der oberen Etage?«
»Sie gleicht dieser Wohnung. Ein wenig Geld müssten wir allerdings in die Renovierung stecken. Dann wäre zu überlegen, ob wir die Zimmer der oberen Etage selbst nutzen für unsere freie Entfaltung oder ob wir sie an eine kinderreiche Familie vermieten.«
»Keine Zentralheizung?«