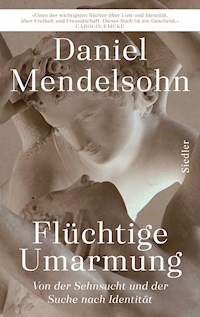
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem renommierten Malaparte-Preis 2022
»Alle Menschen sehen sich demselben Rätsel gegenüber: Woher weiß man, wer man ist?«
Aufgewachsen als Sohn eines Mathematikers in einem Vorort auf Long Island, treibt es Daniel Mendelsohn weg von zu Hause, um herauszufinden, wer er ist: Er stürzt sich in sein Studium der Altphilologie und erkennt sich in den Texten der griechischen Klassiker wieder; um seine Wurzeln zu ergründen, erforscht er die Geschichte seiner Familie, osteuropäischer Juden; in New York City wird er Teil der Schwulenszene; die Sehnsucht nach einer eigenen Familie erfüllt sich wider alle Erwartungen.
Ein leidenschaftliches Buch über die verschlungene Suche nach der eigenen Identität mit all den Konflikten, die damit einhergehen. Ein literarisch brillanter Streifzug - und eine Meditation über das Leben.
Platz 2 der Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk im Februar 2022
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Debüt des großen Intellektuellen: »Eines der wichtigsten Bücher über Lust und Identität, über Freiheit und Freundschaft.« (Carolin Emcke)
Woher wissen wir, wer wir sind? Radikal persönlich und intellektuell aufregend zeigt Daniel Mendelsohn, einer der großen Essayisten unserer Zeit, warum Identität im Grunde ein Paradox ist. Auf raffinierte Weise verwebt er seine eigene Lebensgeschichte – die Herkunft zwischen der Rationalität des Mathematiker-Vaters und dem jüdisch-orthodoxen Großvater und die Erlebnisse als Homosexueller im New York der frühen neunziger Jahre – mit der Deutung klassischer Texte von Sophokles und Ovid, Euripides und Sappho. Er reflektiert über sein eigenes »Doppelleben« und erkundet so die Geheimnisse der Identität mit all den profunden Konflikten, die damit einhergehen. Ein literarisch brillanter Streifzug – und eine Meditation über das Leben.
Daniel Mendelsohn, geboren 1960 in New York, gehört zu den bedeutendsten Intellektuellen in den USA und ist als Autor und Übersetzer bekannt geworden. Er promovierte 1994 in Classical Studies und arbeitete als Kritiker u. a. für The New York Review of Books, das New York Magazine, für The New Yorker und die New York Times. 2006 erschien sein aufsehenerregendes, preisgekröntes Familien-Memoir Die Verlorenen. Eine Suche nach sechs von sechs Millionen. Zuletzt veröffentlichte Siedler Eine Odyssee. Mein Vater, ein Epos und ich (2019).
»Ein einzigartiges Buch – klug, verblüffend, außergewöhnlich.« Newsweek
»Einer dieser seltenen, wirklich makellosen Essays: eine tiefgründige Betrachtung schwuler Kultur, der griechischen Sprache und Mythen, der eigenen Familie – weniger geschrieben als vielmehr gewebt.« Los Angeles Times Book Review
»Schonungslos ehrlich, überaus einfühlsam und sehr schön.« The Boston Globe
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de.
Daniel
Mendelsohn
Flüchtige
Umarmung
Von der Sehnsucht und
der Suche nach Identität
Aus dem Englischen
von Eike Schönfeld
Mit einem Vorwort
von Carolin Emcke
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel The Elusive Embrace: Desire and the Riddle of Identity bei Knopf.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,
so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung,
da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich
auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 1999 by Daniel Mendelsohn
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
Siedler Verlag, München, in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München
Umschlagabbildung: Antonio Canova, Amor und Psyche
(Ausschnitt), 1787–93
© akg-images/Erich Lessing
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-16331-0V001
www.siedler-verlag.de
Zum Gedenken an
ABRAHAM JAEGER
1902–1980
und an
PAULINE STANGER FREEMAN
1901–1963
der Anfang aller Geschichten
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre
Was ist das Rätsel dahinter?
Sokrates, in Platons Apologie
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
I. Geographien
II. Vielzahlen
III. Vaterschaften
IV. Mythologien
V. Identitäten
Nachwort
Dank
Quellennachweis
VORWORT
In der ersten ihrer Frankfurter Poetik-Vorlesungen mit dem Titel »Fragen und Scheinfragen« aus dem Jahr 1959 spricht Ingeborg Bachmann von dem
»Denken, das zuerst noch nicht um eine Richtung besorgt ist, einem Denken, das Erkenntnis will und mit der Sprache und durch Sprache hindurch etwas erreichen will. Nennen wir es vorläufig: Realität.«
Nichts beschreibt besser die unvergleichbare Gabe von Daniel Mendelsohn, nichts beschreibt besser, was sein brillantes Debüt, den biographischen Essay Flüchtige Umarmung, auszeichnet: Es ist eine Meditation, in der das Denken noch nicht um eine Richtung bemüht ist, in der das Denken nichts scheut und niemanden schont. Auch nicht sich selbst oder die eigenen Gewissheiten. Es ist ein Denken, das Erkenntnis will und mit der Sprache und durch die Sprache hindurch etwas erreichen will. Mendelsohns Denken nimmt Umwege und Abzweigungen, er untersucht das Vertraute und das Unvertraute, er will das Rätsel des Selbst freilegen, ohne es seiner Ambivalenzen oder Komplexitäten zu berauben.
Daniel Mendelsohn ist Autor, Kritiker, Übersetzer und, nicht zuletzt, Altphilologe, und so schöpft er aus dem spektakulär tiefen Fundus einer Bildung, die weniger statisches Material als dynamisches Instrument ist, um in immer wieder neuen Zugriffen, neuen Blickachsen eigene Erfahrungen und Erinnerungen zu durchleuchten. Dabei ist Mendelsohn vor allem Geschichten-Erzähler, man kann ihn fast hören, wenn man ihn liest. Die Art und Weise, wie Mendelsohn das Erlesene und das Erlebte verbindet, ist so elegant wie witzig, wie er literarische Figuren oder reale Familienangehörige gleichermaßen auf ihre Beweggründe hin prüft, ist so berührend wie weise.
Mendelsohns Essays sind gelehrt, aber niemals belehrend, sie sind subjektiv, aber nie aufdringlich oder indiskret. Das hat damit zu tun, dass Mendelsohn ein untrügliches Gespür für Nähe und Distanz auszeichnet: Es gibt kaum einen Autor, der so genau den richtigen Abstand zu wahren weiß zu den Figuren seiner Erzählungen. Nie klingt er distanziert-besserwisserisch, nie distanzlos-übergriffig. Auch wenn er Menschen in ihren Irrungen oder Eitelkeiten, ihren Sehnsüchten oder Nöten beschreibt, behalten sie doch immer ihre Autonomie und ihre Würde. Auch wenn er Illusionen erschüttert oder Geheimnisse lüftet, belässt er allen Figuren immer noch einen Rest des unerklärlich Menschlichen. Die Suche nach Erkenntnis ist in Flüchtige Umarmung nie bitter und gnadenlos, sondern immer staunend und human.
»Es gibt nichts Elementareres und damit auch Stressanfälligeres als unseren Wunsch zu wissen, wer wir wirklich sind, und unsere Abstammung genau zu kennen.«
Daniel Mendelsohn denkt und erzählt genealogisch: Er nimmt einen Wert, eine Tradition, eine Gewohnheit und legt ihren historischen Ursprung frei. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine intime Praxis oder ein öffentlicher Ort oder ein altes Epos ist, ob es promiske Lust oder Grabinschriften auf jüdischen Friedhöfen zwischen Brooklyn und Queens oder die Tragödien von Sophokles sind – Mendelsohn befragt mit derselben neugierigen Unbestechlichkeit das Individuelle und das Gemeinsame, das Gegenwärtige oder das Vergangene. Er nimmt Mythen, Geschichten, Sätze, Begriffe auseinander, führt sie zurück auf ihre Wurzeln und befragt sie auf ihre Bedeutung, er will verstehen, was ihn (und uns) prägt und bedingt.
Herkunft verweist hier nie allein auf einen Ort oder eine Familie, sondern immer auch auf die Geschichten, die weitergereicht wurden von Generation zu Generation, die Erzählungen und Bilder, die als kulturelle Bezüge vererbt wurden, die vergilbten Aufnahmen oder unleserlichen Einträge in Registern, die Legenden, die gebildet wurden, aus Scham oder Verzweiflung. Herkunft verweist hier auch auf das, was beschwiegen oder verdrängt wurde, die Lücken der Erinnerungen und die bewussten oder unbewussten Retuschierungen. Etwas in seiner Entstehung zu rekonstruieren, bedeutet bei Daniel Mendelsohn eben gerade nicht, etwas nachzuvollziehen, das einen abhängig oder unfrei macht, sondern im Gegenteil sich der Zufälle, Fehlleistungen und Brutalitäten der Geschichte bewusst zu werden – und freier daraus hervorzugehen.
Es ist dieses Buch, mit dem Mendelsohn erstmals das einzigartige Genre des analytischen Erzählens vorführt. Schon hier zeigt sich, was die Leser:innen seiner späteren, vielfach ausgezeichneten Bücher (Die Verlorenen, deutsch: 2010, oder Eine Odyssee. Mein Vater, ein Epos und ich, deutsch: 2019) kennen: das elegante Verknüpfen autobiographischer Erinnerungen mit philologischen und literarischen Reflexionen, aber auch die leidenschaftliche Suche nach den Bruchstücken der eigenen Geschichte, nach dem, was verloren und vergessen wurde. Es ist eine kuriose Verdrehung, eine, die in einer von Daniel Mendelsohns Erzählungen auftauchen könnte, dass seine Bücher auf Deutsch in falscher Reihenfolge erscheinen: dass eben sein Debüt, das Werk, mit dem er sich und sein homosexuelles Begehren vorstellt, als Letztes erscheint.
In fünf Kapiteln – Geographien, Vielzahlen, Vaterschaften, Mythologien, Identitäten – vermisst Mendelsohn die sexuellen, affektiven und geistigen Räume seines Lebens. Dort, wo andere homosexuelle Autoren individuelle und kollektive Verletzungen und Kränkungen betonen würden, dort, wo andere gesellschaftliche Tabus und Repression herausstellen würden, öffnet Mendelsohn die Freiräume, die Möglichkeiten, den Horizont aus Lust und Begehren, aber auch Vaterschaft und Familie. Was als sich wechselseitig ausschließende Sehnsüchte gilt, der flüchtige, bindungslose Sex der Straße oder des Onlinedatings und die dauerhafte, tiefe Liebe zu einem Kind, Mendelsohn bringt sie so leichthändig zusammen, als wären sie ideologisch nie als Gegensätze aufgebaut worden.
Das Leitmotiv des Essays, das wie das Thema einer Fuge in verschiedenen Stimmen variiert, immer wieder aufgenommen und verwandelt wird, bildet dabei Mendelsohns Rekurs auf das altgriechische Begriffspaar »men« und »de«, das Sowohl-als-Auch, das einerseits und andererseits, die vermeintlichen Widersprüche, die sich nicht ausschließen müssen, die sich in einem verbinden können.
»Liest man griechische Literatur lange genug, dann strukturiert dieser Rhythmus zunehmend auch das Denken über andere Dinge. Die Welt men, in die man hineingeboren wurde, die Welt de, die man sich zum Leben aussucht.«
Ich erinnere mich, wie ich dieses Buch bei seinem Erscheinen in den USA las und welchen glücklichen Schock es auslöste. Selten gibt es Bücher, die wirklich ins eigene Leben eingreifen, die eine Denkfigur oder eine literarische Form entwickeln, die etwas löst, mit der es sich anders, besser, freier leben lässt. Daniel Mendelsohns Flüchtige Umarmung war und ist für mich ein solches Buch. Wie sich das eigene Leben (und Schreiben) den normativen Zuschreibungen entziehen kann, wie die Vorgaben und Annahmen, die uns in falsche Gegensätze zwingen wollen, aufgelöst werden können, wie sich Identität eben nie als etwas Reines und Statisches verstehen lässt, sondern als etwas Lebendiges, Hybrides, Wandelbares, wie sich im Schreiben wie im Leben eine eigene Form schaffen lässt – davon handelt dieses wunderbare Buch. Es ist ein Geschenk.
Carolin Emcke, Berlin im Juni 2021
I. GEOGRAPHIEN
Seit Langem lebe ich an zwei Orten.
Der eine ist eine stille Straße mit Häusern, deren Fenster zwischen Holzläden auf Bäume und gelegentlich ein Auto spähen, eine Straße, die in vieler Hinsicht der nichtssagenden gleicht, in der ich aufwuchs, gärend und voller Angst. Wenn ich dort bin, lebe ich in einem jener schmalen, äugenden Häuser mit einer Frau und einem Kind. Doch dazu später.
Der andere Ort, an dem ich lebe, liegt in New York, ein klein wenig nördlich der Schwulenkultur.
Einen halben Block westlich von meiner Haustür verläuft die Eighth Avenue, eine vierspurige Nord-Süd-Ader, die den Verkehr in die Vorstädte leitet – also nach Norden. Die Eighth Avenue beginnt tief im Zentrum als die viel kleinere Hudson Street, die an manchen Stellen noch mit Kopfsteinen gepflastert ist und endlos obskuren Dauerreparaturen unterzogen wird; dort unten führt sie vorbei an winzigen Querstraßen, deren nummernlose Namen ihr hohes Alter verraten, denn gelangt man übers Village hinaus, über die Fourteenth Street, tritt an die Stelle der willkürlichen, krummen, uralten Straßen südlich davon das jüngere, moderne, starre Gitter, als das Manhattan angelegt ist. Das Gitter ist zumeist einfach: Die längs laufenden Linien heißen Avenues, und ihre Zahlen steigen von Ost nach West an (mit ein paar berühmten Ausnahmen wie Park und Madison); die quer laufenden Linien sind Straßen, deren Nummern von Süden nach Norden ansteigen. Gelegentlich werden Versuche unternommen, diesen Nummern Namen aufzuzwingen – beispielsweise sollen wir die Sixth Avenue »Avenue of the Americas« nennen, und jemand hat ein Stückchen der West Sixty-fifth Street beim Lincoln Center in »Leonard Bernstein Way« umgetauft – doch die New Yorker, stets in Zeitnot, freuen sich an der fixen, unromantischen Effizienz der Nummern und ignorieren die Namen. In vieler Hinsicht sind wir eine Stadt mit Menschen, denen Nummern lieber sind als Namen.
Auf ihrem Weg durchs West Village, bis vor Kurzem noch das Zentrum von New Yorks schwulem Leben, schüttelt die Hudson Street kurz vor der Fourteenth Street, der Ost-West-Ader, welche die Südgrenze des Viertels namens Chelsea bildet, des gegenwärtigen Zentrums von New Yorks schwulem Leben, ihre Kurven ab und verbreitert sich zur Eighth Avenue. Die Fourteenth Street trennt das Village von Chelsea. Die meisten Straßen im Greenwich Village tragen Namen, in Chelsea sind alle nummeriert.
Geht man den halben Block von meiner Tür zur Eighth Avenue, biegt dort, in den mittleren Twenties, nach rechts in sie ein und folgt dem Verkehr nach Norden, gelangt man erst an einigen nichtssagenden Lager- und Mietshäusern vorbei und dann, an der Twenty-seventh Street, am Fashion Institute of Technology, allgemein bekannt unter seinem Kürzel FIT oder, wie die Einheimischen sagen, »Fags in Training« (Schwuchteln in der Ausbildung); danach kommen der große Bahnhof an der Thirty-fourth Street und der Busbahnhof an der Forty-second. Die Avenue führt weiter über das glitzernde Gewirr des Times Square, um dann nach einer kurzen Auflösung in den unüberschaubaren Schnellen des Columbus Circle wieder ziemlich prachtvoll als Central Park West aufzuerstehen. Gesäumt von stämmigen, matronenhaften Vorkriegsbauten auf einer Seite und vom Park auf der anderen, trennt die Central Park West säuberlich Kultur von Natur, damit Letztere von all jenen eingehend betrachtet werden kann, die hinreichend betucht sind, um den Blick zu genießen. Sie setzt sich mit bourgeoisem Biedersinn den Park entlang fort in die West Seventies, Eighties und Nineties – Adressen, die mindestens bis zum Aufstieg Chelseas zum vorrangigen Schwulenviertel bei vielen Schwulen beliebt waren, nun aber eher, wenigstens von den Emigranten in meinem Viertel, mit Yuppies, Flaneuren und irgendwie Heterosexualität assoziiert werden.
Aber natürlich wende ich mich am Ende meines Blocks nur selten nach rechts. Vielmehr gehe ich meistens nach Süden, entgegen dem Verkehrsstrom. Dann sind es von meiner Straße nur zwei Blocks zur Twenty-third Street, der Nordgrenze Chelseas. Das Viertel erstreckt sich nach Osten bis zum Broadway und nach Westen bis zur Tenth Avenue, doch ihr Herzstück ist die Eighth Avenue. Zwischen der Fourteenth Street im Süden und der Twenty-third im Norden ist die Eighth Avenue praktisch die Hauptstraße der schwulsten Enklave der schwulsten Stadt der Welt.
Von einem solchen Ort träumte ich, als ich auf der Highschool war, in einem ziemlich neuen Vorort, der das Wort »Old« im Namen trug, als wollte er seinen Bewohnern, amerikanischen Hausbesitzern der ersten Generation, die Unsicherheit nehmen; einem Vorort, dessen bauidentische Häuser sich lediglich durch die Farbe ihrer funktionslosen Fensterläden unterschieden. Bestimmt hatten viele andere schwule Jugendliche denselben Traum (und haben ihn noch immer). Wie ich werden sie mehrere aufeinanderfolgende Wochenenden nervös zwischen den Regalen der örtlichen Leihbücherei oder bei B. Dalton verbracht haben, um dort heimlich gewisse Bücher zu lesen, so groß war die Panik, diese gewissen Bücher mit nach Hause zu nehmen; wie ich werden sie weiche, fordernde Mädchenkörper mit derselben willigen Leidenschaftslosigkeit geküsst und gestreichelt haben, mit der sie im Labor Frösche sezierten, und wie ich werden sie sich dabei vielleicht andere Klassenkameraden vorgestellt haben müssen, deren gestreifte Badehosen und breite, linkische Schultern in manchen ihrer Freunde eine panische Zärtlichkeit weckten, die sich, da unaussprechlich, schnell zu Ironie verhärtete. Ich stellte mir insgeheim einen Ort vor, wo alle Leute andere Jungen waren und wo alle Geschäfte, alle Bücher, Lieder, Filme und Restaurants von Jungen waren und sich um andere Jungen drehten. An einem solchen Ort konnte die äußere Wirklichkeit der Welt, die auf Augen und Ohren traf, endlich irgendwie der inneren, verborgenen Realität dessen angepasst werden, wie man sich selbst empfand. Ein Ort, wo willige Leidenschaftslosigkeit und Ironiepanzer nicht mehr nötig wären.
An diesen Ort gelange ich nun, wenn ich mich, am Ende meiner Straße angekommen, statt nach rechts nach links wende. Es ist seltsam, aber nun, da ich dort bin, weiß ich nicht recht, ob ich tatsächlich auch dort sein will. Ich teile jetzt mein Leben zwischen meinen beiden Geographien auf: den vertrauten Straßen Chelseas mit ihren Männern und Jungen, ihrem Fleisch, und der Straße in dem Vorort rund hundert Kilometer entfernt, gesäumt von Sumpfeichen und verschwiegenen alten Häusern. Vor diesen Häusern sind keine jungen Männer zu sehen. Eher ein pensionierter Witwer, der mit einem rostigen roten Mäher den Rasen mäht – »das Gras schneidet«, könnte er sagen –, oder eine alte Frau, die auf der Veranda sitzt und sich mit einem Boulevardblatt Luft zufächelt, die Straße und anderer Leute Fenster nach einem Ereignis absucht, nach etwas, was passieren könnte. Diese Häuser, die schon lange standen, als die mit dünnen Schindeln gedeckten Häuser dort, wo ich aufwuchs, hastig zusammengebaut wurden, sind behäbig: Man spürt, sie wissen, dass sie auch noch die jetzige Generation ihrer Besitzer überleben werden. Diese Häuser haben echte Fensterläden, die auch funktionieren.
Manchmal gehe ich in einer Schreibpause die Eighth Avenue entlang bis zur Fourteenth Street. An der Ecke Twenty-second Street ist das Big Cup, ein Coffeeshop in Neonfarben, der als spätabendliche Alternative zu den Schwulenbars noch beliebter geworden ist denn als nachmittäglicher Treffpunkt anderer Freiberufler. Letztere fallen, soweit ich sehe, tendenziell in zwei Gruppen: Schreiber, deren aufwändige Scharade, ihren Laptop produktiv zu nutzen, mit jedem hoffnungsvollen Blick zur Eingangstür durchsichtiger wird, sowie eine kleine, aber ziemlich regelmäßig erscheinende Ansammlung von Strichern, die das Telefon am hinteren Ende in Beschlag nehmen und dabei Namen in ihrem vermutlich schwarzen Büchlein abhaken. In der Twenty-second Street selbst sind das Barracuda, eine niedrige Schwulenbar, die, seitdem sie im Herbst 1995 mit einer Party anlässlich des Erscheinens einer radikal queeren Abhandlung der lesbischen Aktivistin Urvashi Vaid eröffnet wurde, ausschließlich von geilen jungen Mittelschichtschwulen frequentiert wird, sowie die direkte Nachbarin des Barracuda, eine Buchhandlung namens Unicorn, deren von unbedeutenden Auslagen gesäumten kleinen Verkaufsraum man auf dem Weg ins schummrige Hinterzimmer durchquert, wo Männer miteinander Sex haben können, nachdem sie ein Eintrittsgeld von zehn Dollar bezahlt haben.
Aber wie gesagt, zumeist gehe ich einfach die Eighth weiter. Gleich hinterm Big Cup ist ein Einrichtungshaus namens Distinctive Furnishings, wo man unter anderem auch Bildschirmschoner mit fast nackten, muskelbepackten jungen Männern in Badehose erwerben kann. Dann kommt ein Bekleidungsgeschäft namens Tops N Bottoms (ein lustiger Doppelsinn: In der Sprache des Schwulensex stehen diese Wörter für jene, die beim Verkehr die aktive und passive Rolle bevorzugen). Ein Kartenladen gleich nebenan, Rainbows and Triangles, bietet eine vollständige Sammlung schwulenaffiner Geburtstags-, Jubiläums- und Trauerkarten. »Weil ich weiß, wie du dich fühlst«, steht auf der Innenseite einer Karte, die außen einen gut gekleideten jungen Prachtkerl im schwarzen Anzug mit einer weißen Rose in der Hand zeigt. Auf dieser Seite der Avenue passiert man dann auch das Fitnessstudio American Fitness, das fast ausschließlich unter seinem eher schelmisch-wortspielerischen Spitznamen »American Princess« bekannt ist. Viele der von Schwulen frequentierten Fitnessstudios wurden ähnlich umgetauft: Better Bodies wurde zu »Bitter Bottoms«, und in einem mokanten, aber durchaus auch bewundernden Tribut an die hypertrophen Brustmuskeln des Besitzers kennt man den Fitnessclub David Barton an der Ecke Sixth Avenue und Thirteenth Street auch als »Dolly Parton’s«. Etwas weiter südlich ist das Chelsea Gym, durch dessen riesige Fenster im ersten Stock man Männern beim Radfahren, Stemmen und Laufen zusehen kann. Dort findet auch die entscheidende Begegnung zwischen den beiden männlichen Hauptrollen in dem Schwulenfilm Jeffrey statt. Vielleicht in Anerkennung seines Primats in der Chronologie der Körperkultur hat das Chelsea Gym keinen Spitznamen.
Ebenfalls auf dieser Seite der Eighth Avenue befinden sich das Restaurant Viceroy – was als eines der »netten« Esslokale in dieser Avenue gilt, die offenbar, je mehr man’s sich überlegt, zu kaum etwas anderem existiert, als Männerkörper zu ernähren, zu formen und einzukleiden – und der Videoladen Video Blitz. Direkt gegenüber dem Video Blitz an der Seventeenth Street ist eine riesige Blockbuster-Filiale, doch anwohnende Schwule frequentieren gern beide, da das Blockbuster nicht mit der reichen Auswahl des Video Blitz an Kunstfilmen und Schwulenpornos zum Ausleihen mithalten kann: The Bigger the Better, A Matter of Size, Brothers Should Do It.
Komme ich südlich bis zur Fourteenth Street, überquere ich die Eighth Avenue meistens und gehe wieder zurück nach Norden. An der Fifteenth passiere ich das Candy Bar and Grill, das im Herbst 1996 aufmachte und dessen Tür abwechselnd von einer recht großen Dragqueen und einem kleineren, pummeligen Club-Promoter überwacht wird. Das Dekor erinnert an die gehobenen Hotels der Catskills in den fünfziger Jahren, wo meine jüdische, heterosexuelle Familie etwa 1953 ein Wochenende verbracht haben mag, dem Jahr, als meine Eltern, ein Mathematiker und eine Lehrerin, heirateten; inzwischen jedoch sind die großen, raffinierten Art-Moderne-Leuchten, die jene jungen Juden vor beinahe fünfzig Jahren beeindruckt haben mögen, irgendwie zu Objekten der Ironie geworden und stehen bei den jungen, attraktiven Schwulen, die hierherkommen, um sich glamourös und besonders zu fühlen, für eine ganz eigene Form von Stylishness, eine gewisse Art des Bescheidwissens. Nördlich der Candy Bar ist die FoodBar, vielleicht das beliebteste Restaurant des Viertels, mindestens teilweise deswegen, weil sein Mitbesitzer Joe ebenso üppig mit Muskeln versehen und von dunkler Schönheit ist wie manche Gäste oder wie die meisten es erstreben. Passiert man die FoodBar, sieht man ihn unweigerlich durch das riesige Schaufenster, in das der Name des Restaurants eingeätzt ist; er sitzt in seinem engen T-Shirt rauchend auf einem Barhocker am Eingang und verteilt Sitzplätze und Luftküsse an massige Männer in Arbeitsstiefeln und Tanktops. Oft, wenn ich vorbeikomme, zieht er amüsiert die Augenbrauen hoch und winkt mich mit einem Blick zu sich, der sagt, er werde meine unvermeidlichen Klagen über zu viel Arbeit und drohende Abgabetermine nicht ernst nehmen; er schiebt mir auf dem Tresen eine Schachtel Zigaretten hin, bestellt ein Glas Rotwein für mich und eins für sich, und dann plaudern wir über Jungen und Bücher. In der FoodBar finden sich keine unansehnlichen Kellner.
Gleich hinter der FoodBar, weiter Richtung Norden auf der Eighth, ist das Eighteenth and Eighth, ein Anker des Viertels mit einer etwas anderen, nicht ganz so komplex bemuskelten Klientel wie die der FoodBar; man spürt, dass das Personal hier eher mit Musicalmelodien vertraut ist als mit den überlangen Dance-Remixes von I am What I Am, dem Hit aus dem Broadwaymusical nach der französischen Komödie La Cage aux Folles, ein Song, der zu einer Art informeller Nationalhymne der amerikanischen Schwulencommunity geworden ist. Danach kommt ein ziemlich karges Stück bis zur Twenty-third – wenngleich auf diesem Abschnitt absurderweise wohl am meisten im Viertel gecruist wird, vielleicht, weil die Fußgänger dort eher nicht in Schaufenster, sondern stur geradeaus schauen.
Die Kreuzung Twenty-third und Eighth ist diejenige, die einer meiner Freunde und ich nur halb im Scherz die Kreuzung des Begehrens nennen. Hier habe ich gelegentlich vollkommen fremde Männer getroffen, die ich attraktiv fand und mit denen ich dann auch nach Hause gegangen bin. An deren Südwestecke steht ein Gebäude, das manche meiner Bekannten Trick Towers nennen und in dem ich mit Fremden Sex hatte, eines auch, in dem ein hübscher Mann, den ich kennen- und mögen gelernt hatte, ein erfolgreicher junger Manager, der auf Geschäftsreisen heimlich traurige Gedichte schrieb, wohnte und auch wohnen blieb, nachdem er mich schlagartig nicht mehr zurückrief. (Das ist die andere, die Kehrseite des Tricking.) Der erste Fremde, den ich dort auf diese Weise traf, nachdem ich nach Chelsea gezogen war, ohne zu wissen, wie es sich seit meinem letzten Aufenthalt in New York entwickelt hatte – ich war nur erleichtert, dass ich nach dieser langen Abwesenheit von der Stadt, einer Zeit, in der ich die Worte der Toten studierte, so schnell eine Wohnung gefunden hatte, die der Freundin einer Freundin; Letztere machte mich mit ihrem Mitbewohner bekannt, mit dem ich eine Weile schlief und der inzwischen gestorben ist; auch der Bruder der Ersteren ist gestorben –, der erste Fremde also, den ich auf diese Weise traf, war ein dunkeläugiger, dunkelhaariger Kubaner, dem ich eines Tages auf dem Heimweg von der FoodBar begegnete. Er wirkte nicht wie ein Latino auf mich. Etwas an seiner kompakten Statur und seiner Nase, die irgendwie gebrochen schien, weckte in mir den Gedanken, dass er möglicherweise einer meiner jüdischen Verwandten war.
Es war ein klassischer Cruise mit seiner vorhersehbaren Choreographie. Nach einem Blickwechsel gingen wir ein paar Schritte weiter, dann drehte sich jeder um, um sicherzugehen, dass der andere auch hersah, dann gingen wir noch ein paar weitere Schritte, machten schließlich kehrt und gingen mit einem schützenden ironischen Grinsen aufeinander zu. Er sei unterwegs zu einem Termin, sagte er, ob ich mich aber mit ihm später, gegen sechs, an derselben Stelle treffen wolle? Ich wollte. Wir trafen uns um sechs und gingen dann in seine Wohnung, die nur einen halben Block von meiner entfernt lag; davor aber gingen wir noch ein-, zweimal um den Block. Das war, bevor ich die flinke Effizienz des Street Cruising gewohnt war, bevor mir klar war, dass »Präliminarien« ein Überbleibsel aus jener anderen Welt waren, die ich bewohnt hatte, derjenigen mit Mädchen, in der Sex der Abschluss von erotischer Interaktion und nicht die Voraussetzung dafür war. Wir redeten vielleicht vier Minuten, ehe er mir die Hand auf den Oberschenkel legte – über seine Familie in Queens, vor der er flüchtete, sobald er alt genug war, um sich eine Stelle zu suchen. Nachdem wir fertig waren, bat ich ihn um ein Glas Wasser, und während wir sehr kurz in der Küche standen, ganz angekleidet merklich weniger entspannt miteinander als zuvor nackt in seinem Bett, bewunderte ich die schicken Gummimatten, die das alte Resopal auf den Arbeitsflächen verbargen. Als ich dann ging, empfahl er mir Geschäfte, wo ich sie bekommen könne, billig.
Mein Männergeschmack reicht von extremer Ähnlichkeit zu extremer Verschiedenheit. Der Latino mit den Tintenaugen, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, falls ich ihn überhaupt gekannt habe, war kompakt und dunkel, und der Unterschied zu einem anderen Jungen, den ich an der Kreuzung Twenty-third und Eighth etwa ein Jahr später abschleppte, hätte größer nicht sein können. Dieser andere war ein großer, geschmeidig-muskulöser Blonder namens Mike, dessen verkehrt herum aufgesetzte Baseballkappe ich ausnahmsweise mal ansprechend authentisch fand. Ich behaupte nicht, dass das seinen Reiz für mich nicht vergrößerte – und das, obwohl er, allzu vorhersehbar, angehender Schauspieler und Model war. Das jedenfalls glaubte man ihm schnell. Seine Züge waren ernst und regelmäßig, und er schwang sich unbefangen in den hüftlockeren Kontrapost, den die Models in den Obsession-Anzeigen so gern einnehmen. In den griechischen Skulpturen der Hochklassik gibt es eine Pose namens diadúmenos: Ein Athlet steht da, die Arme erhoben, und bindet sich ein Band um den Kopf. Während unserer Unterhaltung langte Mike einmal mit beiden Händen hoch, um seine Kappe zurechtzurücken; kniff man die Augen zusammen, war der Vergleich nicht sehr weit hergeholt.
Als ich den Jungen kennenlernte, saß ich gerade an einem Artikel über den Wegzug offen schwuler Männer aus den Schwulenghettos wie dem hier zurück in die Vororte, in denen sie aufgewachsen waren. Während der Arbeit daran ging ich einmal spazieren; nach einer Plauderrunde mit Joe in der FoodBar war ich schon auf dem Heimweg, als Mike und ich einander begegneten. Es folgte der kleine Pas de deux. Aber zwischen dem Kubaner und Mike hatte es noch einige – nicht ganz wenige, aber auch nicht sehr viele – Zufallsbegegnungen an oder in der Nähe der Ecke Twenty-third und Eighth gegeben. Diesmal war er derjenige, der darauf bestand, ein paarmal um den Block zu laufen, bevor wir dann zu mir gingen, eine Übung, die mir damals weniger mit seinem Versuch zu tun zu haben schien sicherzugehen, dass ich nicht irgendwie gefährlich war – wie damals bei dem Kubaner, den ich im Sommer davor kennengelernt hatte –, sondern vielmehr mit einem verborgenen, inneren Bemühen, etwas anderes zu exorzieren, etwas Dunkleres, weniger leicht zu Artikulierendes.
Auf dieser Runde nun fragte mich Mike, der mit seinen fünfundzwanzig zehn Jahre jünger war als ich, was ich machte, und als ich ihm sagte, worüber ich schrieb – in den gröbsten Zügen, da ich nicht von dem wahren, stillschweigenden Thema unseres Gesprächs abgelenkt werden wollte –, ging er zum ersten Mal richtig aus sich heraus. Nun lebhaft, erzählte er mir hastig, auch er ziehe zurück in den Vorort von St. Louis, in dem er aufgewachsen sei, und dies sei sein letzter Tag in New York. Er sagte, das berauschende Nachtleben, die schiere, verwirrende Überfülle an Gelegenheiten überwältige ihn. »Ich muss wieder klar im Kopf werden«, sagte er und langte wieder nach oben, um seine Baseballkappe zurechtzurücken, als könnte sie ihn mit einer beruhigenden Wirklichkeit aus seiner Kindheit verbinden: vielleicht Fangen spielen mit seinem Vater oder die Little League. Wir unterhielten uns noch ein wenig und gingen dann zu mir. Als er kam, hatte er einen merkwürdig abstrakten Gesichtsausdruck, als wollte er sich etwas sehr Wichtiges einprägen. Er zog sich rasch an, während wir beide versuchten, Konversation zu treiben, um den Raum zwischen meinem Bett und der Tür aufzulockern. Er erzählte noch mehr davon, warum er New York verlasse. »Ich bin hergekommen, um mich zu finden«, sagte er, als er von meiner Wohnungstür durch den Gang zum Fahrstuhl ging, »stattdessen habe ich mich verloren.«
In den erhaltenen Skulpturen des diadúmenos-Typs, zum Beispiel der römischen Kopie einer solchen des berühmten Athener Bildhauers Polyklet, die ich im Archäologischen Nationalmuseum in Athen betrachtete, sind Unterarme und Hände oberhalb der gekrümmten Ellbogen abgebrochen und der Figur nur erhobene Stümpfe geblieben, die parallel zum oberen Torso aufragen. Damals ein keineswegs seltener Unfall der Zeit – Extremitäten brechen oder erodieren immer als Erste –, hat diese Veränderung bei diesen Skulpturen etwas, was eine Haltung lässigen Selbstbewusstseins sein sollte, in eine hilflosen Erstaunens oder der Verzweiflung umgeformt.
Der Gang mit Mike erinnerte mich an etwas, doch erst viel später fiel mir ein, woran. Dreißig Jahre davor, an einem strahlend hellen, kalten Februartag, waren meine Mutter und mein Großvater dreimal um den Block gelaufen, vorbei an den Häusern mit den verschiedenfarbigen Fensterläden. Sie hatten gerade noch für meine Großmutter Schiv’a gesessen – die mit mir übrigens häufig um denselben Block gelaufen war, wobei ich, ein dürrer Vierjähriger, mich an ihrem dicken diabetischen Unterarm festhielt. Meine Großmutter ging mit mir immer zu unserem Park, wo sie mir dann zusah, wie ich hin und her schaukelte, ein schmächtiger, maushaariger Junge auf einem feisten bemalten Metallpferd, das auf einer kräftigen Feder steckte. Nach unserer Heimkehr von dem Park saß ich mit ihr auf der breiten Betonstufe vor dem Haus meiner Eltern auf einem geflochtenen Gartenstuhl, spielte mit ihren Ohrringen, klobigen Perlen- und Kristallmassen, die jetzt, seither unbenutzt, im Schmuckkasten meiner Mutter liegen. Ihre Ohrläppchen waren weich wie Obst. Häufiger aber saß mein Großvater dort, massig und besitzergreifend in seiner makellosen Kleidung, den rasiermesserscharfen Bügelfalten und dem weichen Filzhut, begutachtete den Blick über Rasen und Sprenger und gratulierte sich vielleicht zu dem Glück seines einzigen Kindes, seiner Tochter, der lebhaften Grundschullehrerin mit dem unvorhersehbaren Humor, die Herrenanzüge getragen hatte, für sie geschneidert von ihrem Onkel, einem Schneidermeister; die in ihrem College-Jahrbuch als Hobby »Höhlenforschung« angab und als Berufsziel »Taxidermie«; die unheimliche Dietrich-Imitationen zum Besten hab und in ihrem tiefen Contralto gewisse gewagte Lieder auf Deutsch sang, die sie später dann auch ihren fünf Kindern statt Schlafliedern vorsang; die Bette-Davis-Filme auswendig kannte und die schließlich einen Mann geheiratet hatte, der ihr ein von Grün und zischenden Schläuchen umgebenes Haus bieten konnte, ein Haus mit Bäumen und Gras … Saß der Vater meiner Mutter nicht auf der Stufe und betrachtete alles, in Gedanken vielleicht bei seinen eigenen verlorenen grünen Landschaften (»Man konnte dort wunderbar picknicken«, schrieb er mir einmal über das Dorf in den Karpaten, das er 1920 verlassen hatte), stahlen meine Großmutter und ich uns auf seinen Stuhl und saßen still da, und ich streichelte ihr die Ohren, während sie das tat, was sie immer getan hatte, nämlich zu warten, dass er zurückkehrte und den Stuhl wieder in Besitz nahm.
Jetzt, ein Jahr danach, war sie endlich Gegenstand der Aufmerksamkeit geworden, die Ursache allen Treibens. Nun sagte mir meine Mutter, sie und mein Großvater brächten die Seele ihrer toten Mutter in den Himmel. Die Strecke, die sie dafür zurücklegen mussten, ist ein Stückchen länger als die letzte Etappe meiner gewohnten Runde die Eighth Avenue hinab und wieder herauf – die Strecke, die von der Kreuzung des Begehrens bis zu mir führt.
Die Erfahrung, dass ich einen Mann begehrte, von dem ich auch wusste, dass er mich begehrt, machte ich zum allerersten Mal am College, an einem Tag vor langer Zeit, an dem ich ziellos stundenlang umherlief, immer ihm nach. Wir waren beide neunzehn, und ich habe nie erfahren, wie er hieß. Er wartete am hintersten Ende des Universitätsfriedhofs auf mich, einer Stelle, wo die Gräber sich schon nicht mehr vom Wald unterscheiden.
Es war an einem College im Süden, und dieser Wald war dicht, erstickt von Schlingpflanzen und voller Bäume, die es in den Vorstädten auf Long Island nicht gibt. Für einen wie mich war das ein ganz eigenartiger Ort. Ich war an dieser Universität, die sich in die Ausläufer der Blue Ridge Mountains schmiegte, weil ich mich an der Highschool in einen Jungen verliebt hatte, der aus dem Staat kam und der mich mied, als er merkte, dass ich ihn wollte; ich dachte, indem ich dorthin ging, wo er herstammte, könnte ich ihn irgendwie wiedererlangen, einen Teil von ihm haben. Ich dachte, hier, bei diesen Bergen und Pferdefarmen und dem rauchblauen Grat des Gebirgszugs in der Ferne, könnte ich ihn endlich erleben. Meine Wahl der Universität war den Leuten, mit denen ich aufgewachsen war, seltsam erschienen; von den fünfhundert Schülern, die mit mir den Highschoolabschluss machten, hatte sich niemand außer mir auch nur dort beworben; der Süden, so die Ansicht, war Juden gegenüber feindlich gesinnt. Auf Long Island bedurfte der Süden einer Erklärung. Natürlich sagte ich ihnen nicht, dass ich wegen eines Jungen mit schimmernd blonden Haaren hinging, also führte ich an, dass die Universität meiner Wahl eine angesehene Englischfakultät habe. Alle gingen immer davon aus, dass ich Englisch im Hauptfach studieren würde, und damit schien man sich zufriedenzugeben.
Aber was ich ihnen – und mir – auch einredete, ich fühlte mich wider aller Erwartung bald wie zu Hause. Hier ging ich auf Partys, wo so magere blonde Jungen waren, dass ihnen die Khakihosen und rosa Button-down-Hemden aus Oxford-Stoff am Körper schlackerten wie Fahnen, wenn sie erzählten, wo sie herkamen, Orte, die ihnen allen bekannt waren, für mich aber, der ich an einem Ort aufgewachsen war, der einen Monat vor meiner Geburt noch gar nicht existiert hatte, wunderlich und schön klangen. Sie erzählten von Städten, in denen ihre Familien seit zehn Generationen lebten. Ich besuchte sie dort in Häusern, auf deren Grundstück der Familienfriedhof lag, auf deren Kaminsimsen die Porträts von hübschen toten Soldaten in der Uniform einer besiegten Nation standen, begriff, dass für die Frauen (die ich nicht begehrte, deren sorgsam gepflegte Schönheit dennoch auf mich wirkte) die aufwändigen Standards für Schönheit und gesellschaftliche Umgangsformen, die sie auf andere nur ein klein wenig strenger anwandten als auf sich selbst, von ihrem übrigen Leben nicht zu trennen waren, vielmehr wie ihre Häuser und die Familiennamen, die sie weitervererbten, zu den Dingen gehörten, mittels derer sie sich ihrer selbst wie auch ihrer Kultur und Geschichte versicherten. Es war eine Kultur, die ich verstand, eine, die aus einer großen Niederlage eine große Romanze geschaffen hatte, eine Zivilisation, die Verlust und echte Not hatte ertragen können, weil sie an ihren eigenen Mythos von verlorener Schönheit glaubte; dass sie diese Schönheit einmal besessen hatten, wie kurz und vor wie langer Zeit auch immer, erhob die reizvollen, entkräfteten Besiegten weit über die groben, praktischen Sieger. Eine solche Fabel hatte ich schon einmal gehört, am Knie meines Großvaters, wenn er mir von seiner Familie erzählte, einer Familie der zarten Schönheiten, denen Krieg, unerwartete Armut und die zynischen Manöver praktischer veranlagter, weniger feiner Verwandten übel mitgespielt hatten, eine Fabel, nach der ich unbewusst wieder hier am College suchte, indem ich die Griechen studierte, auch sie eine besiegte Nation, die sich in ihrem Elend an den Glauben klammerte, dem Sieger überlegen zu sein. Graecia capta ferum victorem cepit et artes/intulit agresti Latio …, schrieb der römische Dichter Horaz: »Das bezwungene Griechenland bezwang den wilden Sieger und brachte die Künste in das bäuerische Latium.« Die Kultur des Südens leuchtete mir ein.
Da stand ich also auf diesem Friedhof vor dem dichten Wald und fixierte diesen Jungen. Ich hatte ihn schon mehrmals gesehen. Auf dem Campus, in Seminarräumen, auf Partys erschien er wie eine optische Täuschung oder das Symptom einer seltsamen neuen Augenkrankheit, denn offenbar existierte er nur am äußersten Rand meines Blickfelds. Manchmal drückte er sich aus einem Hörsaal, als ich gerade hineinging – so auch, ich weiß es noch wie heute, an einem sengend heißen Frühnachmittag im Sommer gegen Ende des Studienjahrs, als ich so einen Hörsaal zur letzten Vorlesung einer Reihe über Dantes Commedia betrat, einer Reihe, in deren Verlauf mir der Professor (ein hochgewachsener Mann, der sich in seinem linkischen Körper offenbar nie ganz wohlfühlte und dessen weit ausholende, clowneske Gebärden die höflichen und geschniegelten Studenten, die zu jung waren, um zu wissen, wie Traurigkeit aussah, lustig fanden, denn der Professor war nicht Italiener, sondern Ungar, ein politischer Flüchtling, der auf ganz unglaublichen Wegen in dieser unbeschwerten Stadt des Südens gelandet war) – in der mir der Professor auf meine Frage, warum die ewige Umarmung der ehebrecherischen Paolo und Francesca als Strafe galt, wo sie sich doch nach ebenjener Umarmung gesehnt hatten, antwortete, dass »manche Freuden, wiederholt man sie oft genug, allmählich zu Schmerz werden« … Manchmal erhob der Junge sich auch in der Bibliothek von einem schmalen Plastikstuhl genau dann, wenn ich stumm an ihm vorbei und weiter durch die Regale ging, als wäre das, was ich suchte, ein Buch. In der Bibliothek sah ich ihn am häufigsten, und jedes Mal, wenn ich ihm dort begegnete, worauf er sie stets gleich darauf verließ, bekundete ich bewusst auffällig Enttäuschung darüber, den Band, nach dem ich vorgeblich suchte, nicht gefunden zu haben – nur um jeden, der eventuell hergesehen haben mochte, davon zu überzeugen, dass ich ja nur ein Buch gesucht hatte. Ich machte vor einer imaginären Stelle im Regal eine ungeduldige Gebärde oder schüttelte den Kopf wie bestürzt über die Inkompetenz des Personals. Zu der Zeit, als sich das alles zutrug, als ich neunzehn, zwanzig und dann einundzwanzig war, mag ich mir eingeredet haben, dass dieses ganze Theater nur andere täuschen sollte – Leute, die ein ganz eigenes listiges Geheimwissen haben konnten (Oberschichtmänner? Lehrkörper?) und die die Motive für meine Heimlichtuerei auf den vielen Meilen zwischen den Bücherregalen bestimmt schon durchschaut hatten. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Doch sogar schon damals war mir bewusst geworden, dass ich nach wenigen Monaten dieser scheinbar zufälligen Begegnungen einen Gehtick entwickelt hatte. Jedes Mal, wenn ich ein Seminar oder eine Mensa betrat oder verließ, ging ich plötzlich langsamer, so wie man einen Film verlangsamt, um so den genauen Augenblick, da dieser große, unbekannte Junge – dessen Freunde nicht meine Freunde waren, dessen dunkle Haare ihm ständig über ein Auge fielen, sodass es mir vor Aufregung und Verlangen den Atem verschlug – unvermittelt auftauchte, besser bestimmen zu können.
Ich wusste, dass er wusste, dass ich ihn beobachtete. Im Frühling meines zweiten Jahrs war ich einmal frühabends auf einer Party in einem Garten, der von dem verblüffend frischen Zwiebelgeruch zertretener Magnolienblüten erfüllt war. Unter den Bäumen sah man Studenten zu zweit und zu dritt, die Stimmen aufgekratzt vom Alkohol und der Vorahnung von Sex. Von dort, wo ich saß, einer Bank, die zwischen niedrigem Gebüsch an einer wellig sich windenden Mauer – nur einen Backstein dick, wie die studentischen Universitätslotsen besserwisserisch betonten – nahezu verdeckt war, konnte ich eine Dreiergruppe beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Es waren zwei Jungen und eine Frau, die mit dem Rücken zu mir saß. Sie trug ein mattweißes Kleid, blonde Ringellocken flossen ihren feuchten, rosa Nacken hinab. Unter einem ihrer cremefarbenen Schuhe lugte die Spitze einer schwarzen Seidenfliege hervor wie eine ungesunde Zunge unter einer blassen Oberlippe. Einer der Jungen kniete komisch-demütig vor ihr und zerrte an der schwarzen Zunge: Was für ein Spiel es auch war, sie hatte eindeutig gewonnen. Als er sich nach der Fliege bückte, schaute er unvermittelt auf, genau zu mir her. Natürlich war er es. Seine Augen hatten keine besondere Farbe – dunkel, ohne richtig braun zu sein, die Farbe von Seetang, noch nass vom Ozean. Unsere Blicke verhakten sich derart vehement, dass man fast das Klick hörte.
Das alles dauerte nur wenige Sekunden, doch es genügte; in dem Augenblick, als wir einander ansahen, herrschte zwischen uns vollkommenes Einvernehmen, so klar, als hätten wir es ausgesprochen. Danach stand er plötzlich auf, wandte sich von mir ab und reichte die Fliege seinem Freund. Doch die Geste war lasch; das Spiel hatte seinen Reiz verloren. Nur ich war befriedigt, weil ich da verstand, dass soeben ein anderes Spiel begonnen hatte, das nur er und ich spielten.
Jetzt, ein halbes Jahr später, stand er am Rand eines Friedhofs, dessen vernachlässigte Grabsteine aus dem Oktobermatsch ragten wie krumme Zähne aus schlechtem Zahnfleisch. Um diese Zeit fanden die Zwischenprüfungen statt, aber niemand wusste so recht, ob es das war oder der unerbittliche Regen und der sonnenlose Himmel, was mehrere Generationen Studierender, vor allem aber Erstsemester, dazu angeregt hatte, den nassen Shenandoah-Herbst »Selbstmordwetter« zu nennen. Überall war Matsch: auf den aufwändig gemusterten Ziegelwegen, die einen zu den neoklassizistischen Ziegel-und-Putz-Bauten führten, in denen die Seminare stattfanden, auf den Böden der Wohnheimzimmer und Mensen, an den Schuhen (Bootsschuhe, duck boots





























