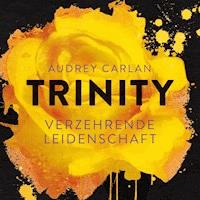6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Höhenflüge der Lust, sinnlich, geheimnisvoll, romantisch - alle sechs Folgen des erfolgreichen erotischen Liebesromans in überarbeiteter Fassung in einem Band! Ein Meister der Verführung, der jede Bindung scheut, trifft auf eine selbstbewusste Frau, bereit für eine große Liebe jenseits aller Konventionen: Die junge Dozentin Ann-Sophie Lauenstein besucht mit ihren Studenten ein von dem milliardenschweren Hotelier Ian Reed gestiftetes Privatmuseum. Im Museumscafé lässt sie sich zu äußerst kritischen Bemerkungen über den unsteten Playboy und Immobilienhai Reed hinreißen - ohne zu ahnen, wer der ungemein attraktive Geschäftsmann am Nebentisch wirklich ist. Als Reed sich zu erkennen gibt, verlangt er als Wiedergutmachung ein gemeinsames Abendessen. Doch er hat mehr im Sinn als bloß ein romantisches Dinner. In einer rauschhaften Liebesnacht entführt er Ann-Sophie an die fremden Gestade dunkler, gefährlicher Leidenschaft - und das ist erst der Anfang ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Anaïs Goutier
Fly me to the Moon
In seinem Bann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Meister der Verführung, der jede Bindung scheut, trifft auf eine selbstbewusste Frau, bereit für eine große Liebe jenseits aller Konventionen!
Die junge Dozentin Ann-Sophie Lauenstein besucht mit ihren Studenten ein von dem milliardenschweren Hotelier Ian Reed gestiftetes Privatmuseum. Im Museumscafé lässt sie sich zu äußerst kritischen Bemerkungen über den unsteten Playboy und Immobilienhai Reed hinreißen - ohne zu ahnen, wer der ungemein attraktive Geschäftsmann am Nebentisch wirklich ist. Als Reed sich zu erkennen gibt, verlangt er als Wiedergutmachung ein gemeinsames Abendessen. Doch er hat mehr im Sinn als bloß ein romantisches Dinner. In einer rauschhaften Liebesnacht entführt er Ann-Sophie an die fremden Gestade dunkler, gefährlicher Leidenschaft - und das ist erst der Anfang ...
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Motto
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Vorbemerkung
Alle in diesem Roman erwähnten Namen sowie alle darin geschilderten Handlungen, Personen, Orte und Begebenheiten sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie mit realen Ereignissen oder Schauplätzen wären zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Es existiert ein unbekanntes Land, voll seltsamer Blumen und zarter Düfte. Ein Land, von dem zu träumen die Freude aller Freuden ist. Ein Land, in dem alle Dinge vollkommen sind und vergiftet.
(Oscar Wilde)
Eins
Sometimes you get so lonely
Sometimes you get nowhere
I’ve lived all over the world
(David Bowie)
Wir betrachteten das Objekt, das auf einem niedrigen Podest vor uns lag wie auf einem Seziertisch. Einige der Studierenden gingen um den Tisch herum, beäugten den allansichtigen Gegenstand auch von der Rückseite und den schmalen Seiten. Wenige Neugierige gingen sogar in die Hocke oder beugten sich über das obskure Gebilde, um seine intimen Details auszumachen. Die meisten aber blieben hinter mir zurück, bildeten, gespannt auf meine Ausführungen wartend, einen Halbkreis um mich, und ich sah in ihren Mienen das Unbehagen und die gleichzeitige Faszination, die dieser verbotene voyeuristische Blick hervorrief, zu dem uns der Künstler mit aller Macht verführte.
Vor uns lag ein nackter weiblicher Körper mit vier verrenkt gespreizten Beinen, ähnlich einem siamesischen Zwilling, am Bauch zusammengewachsen, ohne Oberkörper und Kopf, dafür mit zwei klaffenden, geröteten Spalten. Die schwarzen flachen Sonntagssandalen und die weißen Söckchen an allen vier Füßen ließen das entblößte, sich windende Geschöpf im Kopf des Betrachters zu einem Mädchen werden, zu einem unschuldigen minderjährigen Mädchen.
Obwohl ich dieses Werk aus unzähligen Abbildungen kannte und ihm sogar bereits zweimal in anderen Ausstellungen in natura gegenübergestanden hatte, waren meine Empfindungen noch immer ebenso zwiespältig wie die meiner Studierenden. Es schockierte mich jedes Mal aufs Neue, diesen hilflos ausgelieferten Körper vor mir zu sehen, der so schutzbedürftig wirkte und dabei auf so brutale Weise entmenschlicht.
»Was Sie hier sehen, ist eine von Hans Bellmers berühmt-berüchtigten Puppen«, begann ich mit belegter Stimme. »Formal handelt es sich um Versatzstücke von hölzernen Schaufensterpuppen aus den 1930er-Jahren, zusammengehalten von einer Metallkonstruktion und Gips-Kitt. Zunächst dienten diese und ähnliche Puppen Bellmer lediglich als Modelle für seine Skizzen und Zeichnungen oder er setzte sie wirkungsvoll in Fotografien in Szene. Was wir hier haben, ist also weniger ein eigenständiges skulpturales Kunstwerk, denn eine Requisite, ein kunsthistorisches Artefakt.«
Nach dieser kurzen formalästhetischen Einführung hätte ich die Frage nach subjektiven Eindrücken und Interpretationsansätzen gern ins Plenum weitergereicht und die Wirkung auf den Betrachter mit den Studierenden diskutiert, doch wie befürchtet, folgte auf meine Aufforderung lediglich betretenes Schweigen.
»Möchte sich wirklich keiner von Ihnen zu dieser Arbeit äußern?«
Mein Blick wanderte über die Gruppe, dann gezielt zu denjenigen Seminarteilnehmern, die sich die Chance auf einen Redebeitrag normalerweise nie entgehen ließen.
»Larissa, Carola, Fabian? Sind Sie wirklich alle so sprachlos vor Entsetzen?«
Ein schwaches Grinsen, dann der schülerhafte Blick auf die eigenen Schuhspitzen. Selbst zu einer banalen Werkbeschreibung ließ sich keiner bewegen.
»Also gut. Ich kann verstehen, dass Sie sich mit dieser Arbeit schwertun. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass uns in dieser Ausstellung noch einige Werke begegnen werden, die es Ihnen nicht unbedingt leichter machen werden als die Puppe. Und ich habe nicht vor, Ihnen einen Rundgang mit Frontalunterricht zu servieren. Schließlich haben Sie sich alle wissentlich in ein Seminar über Schockstrategien in der Kunst eingeschrieben. Das nur als Zuruf, und jetzt zu Bellmers Puppe.«
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass drei Männer den Raum betreten hatten, sich aber vermutlich unseretwegen zunächst den gerahmten Zeichnungen und Druckgrafiken zuwandten, statt mit der prominent in den Raum gesetzten Puppe zu beginnen.
Dennoch sprach ich eine Nuance leiser, als ich fortfuhr.
»Um ein Kugelgelenk, die Bauchkugel, sind zwei weibliche Unterleiber mit den dazugehörigen unteren Extremitäten gespiegelt. Obwohl derart fragmentarisiert und verfremdet, dass man sich an Tod Brownings Film Freaks und Frankensteins Monster erinnert fühlen könnte, wirkt dieser Körper auf beunruhigende Art menschlich und bemitleidenswert. Diese Echtheit und Lebendigkeit verdankt die Puppe der Detailversessenheit ihres Schöpfers. Die blasse, porzellanfarbene Haut der Beine und des Bauches lässt die fleischfarben klaffenden Vulven und die unnatürlich geröteten Hinterbacken noch deutlicher hervortreten. Das sind eher die Attribute von Gummipuppen denn von Schaufenster-Mannequins. Der weibliche Körper wird also radikal modifiziert und auf seine am stärksten sexuell aufgeladenen Teile reduziert. Schon auf dieser Ebene wird diesem Körper Gewalt angetan. Hinzu kommen die biederen Mädchenschuhe und die unnatürliche, krampfartig-verdrehte Körperhaltung. Man kann als Betrachter kaum umhin, hier ein Gewaltverbrechen, ein minderjähriges Opfer von sexuellem Missbrauch zu assoziieren.«
Als ich meinen Blick erneut über die Gruppe schweifen ließ, stellte ich fest, dass die drei Herren den Saal gar nicht verlassen hatten, wie ich zwischenzeitlich angenommen hatte, sondern sich zu uns gesellt und meinen Ausführungen vom Rand der Gruppe aus gelauscht hatten.
Sie alle trugen Maßanzüge, und ich nahm an, dass es sich um Frankfurter Banker handelte, die ihre Mittagspause zu einer der neuerdings so populären Kunstpausen, einem kurzen Ausstellungsbesuch, nutzten. Während mir für zwei von ihnen, dem leicht untersetzten Endfünfziger mit weichen Zügen, Halbglatze und Randlosbrille und dem schlaksig wirkenden Asiaten mit der mausgrauen Krawatte, ein kurzer Seitenblick genügte, um sie in meine imaginären Typ-Schubladen einzusortieren, blieb mein Blick an dem dritten Geschäftsmann länger hängen.
Er war überdurchschnittlich attraktiv, gertenschlank, aber nicht hager, mit einem äußerst scharf geschnittenen Gesicht. Mir fiel auf, dass er als Einziger der drei keine Krawatte trug. Seine dunklen Haare, in denen die ersten silbrigen Reflexe spielten, wirkten wie vom Wind zerzaust und sein weißes Hemd mit dem schmalen Kragen war ein bisschen verknittert. Dennoch saß der sündhaft teure Hedi-Slimane-Anzug wie angegossen.
Ich merkte, dass ich leicht ins Stottern geriet, während ich meinen Blick einfach nicht von ihm zu lösen vermochte. Noch schlimmer wurde es, als er meine Konzentrationsschwierigkeiten offenbar umgehend registrierte und mich anlächelte.
Himmel, dieses Lächeln! Es war nur ein ganz feines Schmunzeln, das seine sinnlich geschwungenen Lippen umspielte, nicht breit oder gar hämisch, sondern sympathisch, wenn auch mit einem Hauch von spöttischem Amüsement. Und es ließ seine wachen graublauen Augen strahlen, die unter perfekt geformten Brauen genau auf mich gerichtet waren.
Endlich fand ich die nötige Kraft, meinen Blick von ihm abzuwenden, doch ich sah aus dem Augenwinkel, wie er mir wenig später freundlich zunickte und seinen Begleitern dann mit einer ausholenden Geste bedeutete, ihm in den nächsten Raum zu folgen. Einen Moment lang sah ich den dreien nach, und mir fiel auf, dass ich noch nie einen Mann gesehen hatte, der so ging. In seinen gemessenen und gleichzeitig kraftvollen Bewegungen vereinigten sich Anmut und männliche Selbstsicherheit auf eine nie gesehene, äußerst anziehende Weise.
Wir brachten noch fast zwei Stunden in der Ausstellung zu, die das künstlerische Schaffen Hans Bellmers auf kongeniale Weise dem Werk Louise Bourgeois’ gegenüberstellte, deren radikale Installationen und Objekte nicht minder schockierten und ebenso sexuell aufgeladen waren wie die ihres männlichen Künstlerkollegen.
Für die hochkarätige Dauerausstellung der Sammlung Reed im ersten Stock blieb uns nur noch wenig Zeit, doch alle Seminarteilnehmer waren zu einer halbstündigen Überziehung der Sitzungszeit bereit, da viele von ihnen zum ersten Mal diese beeindruckende Sammlung von Ikonen der fantastischen Malerei zu Gesicht bekamen.
Als wir das Museum für fantastische Kunst verließen, schien die Sonne warm und strahlend auf das parkartig angelegte Grundstück am Schaumainkai.
Drei Studentinnen im ersten Semester, die in der nächsten Woche ihr allererstes Referat über Paul McCarthy halten würden, hatten noch ein paar Fragen zur Aufteilung ihres Vortrags und zum Medieneinsatz. Da ich die drei Mädchen bisher als sehr gewissenhaft und eifrig kennengelernt hatte und mich über ihr Engagement freute, verwies ich sie nicht, wie üblich, auf meine Sprechstunde am Dienstagnachmittag, sondern lud sie zu einem Cappuccino auf der Terrasse des Museumscafés ein.
Ich riet ihnen, den biografischen Teil so kurz wie möglich zu halten und die genauen Daten zu Leben und Werken lediglich im Handout aufzulisten. Außerdem gab ich ihnen noch ein paar Tipps zur PowerPoint-Präsentation und einige Literaturhinweise.
Nachdem ich ihre Fragen hinlänglich beantwortet hatte, verabschiedete sich Laura wegen eines nachfolgenden Seminars. Carola und Kristin blieben noch sitzen, obwohl ich gern einfach noch ein paar Minuten das Gesicht in die Sonne gehalten und meinen Gedanken nachgehangen hätte.
Die Terrasse mit ihrer edlen Teakholz-Bestuhlung war an diesem frühen Mai-Nachmittag bereits gut besucht, und alle schienen das schöne Wetter nach einer recht verregneten Woche zu genießen.
Die beiden Damen am Nebentisch unterhielten sich auf Italienisch, während die Männer hinter mir ein gepflegtes British English sprachen und die vier älteren Frauen zwei Tische weiter genauso babbelten wie meine Oma. Genau das liebte ich an Frankfurt.
Irgendwann kam das Gespräch über Paul McCarthy zum Erliegen und ich hoffte, dass mich die beiden Mädchen nun allein lassen würden. Das taten sie aber nicht.
»Was sind das eigentlich für Leute, die ein ganzes Museum spenden, Frau Dr. Lauenstein?«, fragte Carola.
Ich nippte an meinem Cappuccino.
»Unglaublich reiche Leute«, gab ich einsilbig zur Antwort. Ich hatte keine Lust, mich nun auf das nächste Thema einzulassen.
»Reich und sozial«, ergänzte Kristin.
»Ja, auch das«, brummte ich. »Allerdings muss man zwischen Spenden und Leihgaben unterscheiden. Zunächst einmal handelt es sich bei der Sammlung Reed um eine auf zehn Jahre begrenzte Dauerleihgabe an die Stadt Frankfurt.«
»Wissen Sie etwas über die Stifter?«, fragte Carola weiter.
Ich lächelte.
»Der Name Reed dürfte eigentlich auch Ihnen etwas sagen, Carola. Oder kennen Sie die gleichnamige Hotelkette nicht?«
Die Mädchen machten große Augen.
»Aber ich dachte, das wäre eine englische Kette«, gab Kristin zu bedenken.
»Stimmt. Aber soviel ich weiß, war die Mutter des jetzigen Konzernchefs Frankfurterin. Die Villa in dieser exponierten Lage war bereits in Familienbesitz. Und vor einigen Jahren hat der Erbe in seiner grenzenlosen Großzügigkeit entschieden, die bis dahin unzugängliche Privatsammlung in eine Stiftung zu überführen und das Museum für fantastische Kunst in der Heimatstadt seiner Mutter zu eröffnen.«
»Aber das ist doch super! Warum klingen Sie dabei so kritisch, Frau Dr. Lauenstein?«
»Natürlich ist das für Frankfurt ein riesiger Gewinn, für den wir sehr dankbar sein müssen. Und selbstverständlich ist es wunderbar, dass diese Werke von Weltrang nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, statt auf Nimmerwiedersehen im Wohnzimmer irgendeines Oligarchen oder Scheichs zu verschwinden. Aber genau dort verbargen sich auch diese Kunstwerke über Jahrzehnte hinweg, und wie viele sich noch immer in den Villen und Luxus-Apartments des werten Herrn Reed türmen, wissen wir natürlich auch nicht. Außerdem besetzt Mr. Reed auf unbegrenzte Zeit den Posten des Museumsdirektors und künstlerischen Leiters, obwohl seine eigentliche Profession das Immobiliengeschäft ist. Ein Hotelier und Playboy, der laut Presse ständig um die Welt jettet, aber nie eine kunstwissenschaftliche Vorlesung besucht hat und kaum drei Tage im Jahr in der Stadt verbringt, in der sein Museum steht – das finde ich doch schon recht abenteuerlich und … anmaßend.«
Unser Gespräch über den Londoner Hotelmagnaten Reed, der sich ein Museum als Spielzeug hält, führte uns auch noch zu einem kurzen Exkurs über Steueroasen und Heuschreckenkapitalismus, doch mein wiederholter Blick auf die Uhr und ein Wink zur Kellnerin signalisierten endlich auch meinen beiden hartnäckigen Tischpartnerinnen, dass es an der Zeit war, aufzubrechen.
Ich hatte kein großes Interesse daran, auch noch auf dem Heimweg von Kristin und Carola in Beschlag genommen zu werden. Also war ich froh, dass die Kellnerin mit der Rechnung noch auf sich warten ließ und ich die beiden Mädchen endlich durch das große Tor verschwinden sah.
Auch die beiden Herren in meinem Rücken schienen sich voneinander zu verabschieden. Ich bemerkte, dass es sich um den attraktiven Mann aus der Ausstellung und seinen asiatischen Geschäftspartner handelte, den er bis zum Tor begleitete, um dann kehrtzumachen und auf die Caféterrasse zurückzukehren.
»Darf ich mich einen Augenblick zu Ihnen setzen?«
Die Frage war an mich gerichtet.
Verdattert bejahte ich.
»Danke sehr, Frau Dr. Lauenstein?« Er intonierte es als Frage, dennoch war ich mehr als verblüfft, als er meinen Namen aussprach. Das musste er auch meinem Mienenspiel angesehen haben, denn er beeilte sich zu erklären: »Verzeihen Sie, ich habe ein wenig Ihren Ausführungen gelauscht und habe gehört, wie Ihre Studenten Sie angesprochen haben.«
Er sprach mit einem leicht britischen Akzent und einer sanft-herben Stimme, die mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte.
»Ja, ich habe Sie in der Ausstellung gesehen«, erwiderte ich freundlich lächelnd.
Etwas Besseres fiel mir in diesem Augenblick nicht ein. Schließlich fühlte ich mich völlig überrumpelt, plötzlich und unerwartet mit diesem Mann am Tisch zu sitzen, der aus der Nähe noch atemberaubender aussah. Er hatte die Beine lässig übereinandergeschlagen, und mein Blick fiel auf seine schönen schlanken Hände mit den perfekt manikürten Nägeln und der Omega am linken Handgelenk. Auch sein ebenmäßiges Gesicht wirkte aus der Nähe noch schöner. Wie gerade seine Nase war, wie hoch und scharf geschnitten seine Wangenknochen.
»Mir hat gefallen, was Sie über Bellmers Puppe erzählt haben«, sagte er.
»Danke.«
Er zeigte wieder dieses feine Lächeln, das mir schon vorhin so imponiert hatte.
»Nicht unbedingt ein einfacher Einstieg für eine Ausstellung, aber ein treffender und folgerichtiger bei diesem Themenkomplex.«
Er winkte die Kellnerin herbei, und auf seine Geste hin überschlug sie sich fast, während sie mich dahingegen zehn Minuten lang mit Nichtbeachtung gestraft hatte.
»Bringen Sie uns bitte noch etwas zu trinken, Sandra. Was möchten Sie, Frau Dr. Lauenstein?«
»Eigentlich zahlen«, entgegnete ich verdattert und hörte sein melodisches, perlendes Lachen, das zu seinem feinen Lächeln passte.
»Bitte machen Sie mir die Freude und bleiben Sie noch einen Moment. Als mein Gast.«
Ich gab mich geschlagen. »Dann bitte noch ein Cappuccino«, sagte ich.
»Gut. Und für mich einen doppelten Espresso. Danke, Sandra.«
Die junge Frau wurde rot, als er ihren Namen schon zum zweiten Mal aussprach, knickste dann tatsächlich und verschwand im Laufschritt aus meinem Blickfeld.
»Es freut mich, dass Sie der Puppe als Einstieg etwas abgewinnen können«, nahm er das Thema wieder auf. »Natürlich ist es ein Wagnis, ein so polarisierendes und in gewisser Weise plakatives Werk als Auftakt zu verwenden, aber Ihr fachkundiges Urteil bestätigt mich in meiner Auffassung.«
Ich runzelte die Stirn.
»Verzeihen Sie, Frau Dr. Lauenstein. Ich vergaß, mich vorzustellen. Ian Reed.«
Wahrscheinlich entglitten mir in diesem Moment sämtliche Gesichtszüge. Er reichte mir diese schöne aristokratische Hand und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken.
Sein Händedruck war zupackend, fast ein bisschen zu fest und vor allem irritierend lang. Während er meine Hand festhielt, sah er mir geradewegs in die Augen, und es kostete mich ziemlich viel Willensstärke, diesem tiefen, forschenden Blick standzuhalten und nicht verunsichert wegzusehen.
»Ich habe übrigens ein paar kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht, wenn diese Studien auch zugegebenermaßen ohne Abschluss blieben«, bestätigte er meine schlimmsten Befürchtungen. Er hatte unserem Gespräch also tatsächlich zugehört. Ich glaube, ich wechselte meine Gesichtsfarbe wie ein Chamäleon.
Doch dann umspielte wieder dieses anziehende Lächeln seine Lippen, als er ergänzte: »Keine Sorge, ich nehme Ihnen nicht übel, was Sie sonst noch über mich gesagt haben. Lediglich dieses Detail wollte ich gern korrigiert wissen.«
»Das ist mir wirklich sehr unangenehm, aber wenn Sie mir zugehört haben, wissen Sie auch, dass ich Ihr Museum für eine große Bereicherung und einen nicht zu unterschätzenden Gewinn für die Frankfurter Kulturlandschaft halte.«
»Schon gut, Sie brauchen sich nicht in Lob zu ergehen, Frau Dr. Lauenstein. Außerdem schätze ich ehrliche Kritik.«
»Das ehrt Sie, Mr. Reed«, erwiderte ich und meinte es auch so.
»Aber Sie haben mich auch einen Playboy und später einen Steuerflüchtling und Immobilienhai genannt.«
Er fixierte mich streng mit seinen verwirrend schönen Augen, und ich errötete erneut.
Ich räusperte mich. »Nun, Sie wissen, was man über den Lauscher an der Wand sagt, Mr. Reed?«
Er lachte herzlich und entblößte dabei seine strahlend weißen Zähne.
»Ja, das sagte meine Nanny auch immer.«
Doch kaum wiegte mich sein Lachen in Sicherheit, wurde seine Miene wieder ernst und mein Herzschlag beschleunigte sich abermals.
Er hob seine perfekt geformten Augenbrauen.
»Ich denke, Sie sind mir einen Gefallen schuldig, Frau Dr. Lauenstein.«
Ich runzelte die Stirn.
»Haben Sie heute Abend bereits irgendwelche Verpflichtungen?«
Irritiert schüttelte ich den Kopf.
»Gut. Dann verlange ich, dass Sie mit mir zu Abend essen. Ich erwarte Sie pünktlich um 19.30 Uhr in der Lobby des Grand Reed. Soll ich Ihnen einen Fahrer schicken?«
»Nein, das ist nicht nötig«, hörte ich mich selbst sagen.
Er hatte mich derart überrumpelt, dass ich seiner bestimmenden Art und seinem unverschämten Befehlston im Augenblick rein gar nichts entgegenzusetzen hatte.
Als wir uns etwa gleichzeitig erhoben, zeigte er mir erneut sein äußerst gewinnendes, leicht überhebliches Lächeln.
Wieder reichte er mir seine Hand, doch diesmal war sein Griff sehr viel gefühlvoller, und zu meinem Erstaunen führte er meine Hand an seine Lippen, um einen sanften Kuss daraufzuhauchen. Dabei sah er mir auf eine Weise in die Augen, die ich kaum beschreiben kann und doch nie vergessen werde. Ich hatte das Gefühl, als schaue er mit seinen faszinierenden graublauen Augen bis in die tiefsten Tiefen meiner Seele.
Die vier Stunden bis zu meinem unverhofften Date mit Ian Reed brachte ich mit einem kurzen Telefonat mit meiner besten Freundin Kiki, einer intensiven Internetrecherche, einem entspannenden Vollbad und einer nervenzehrenden Exklusiv-Modenschau vor meinem Schlafzimmerspiegel zu.
Was um alles in der Welt trug man zu einem Abendessen mit einem Milliardär? Selbst wenn ich es gewusst hätte, wäre in meinem Kleiderschrank wohl kaum das Entsprechende zu finden gewesen. Nicht, dass ich nicht genügend Auswahl gehabt hätte. Mein Kleiderschrank war zum Bersten gefüllt. Ich mochte Mode. Und besonders in Zeiten des Schlussverkaufs erwachte angesichts der Designer-Schnäppchen allerorten regelmäßig die Jägerin in mir. Ich hatte sogar schon Seminare zur Mode- und Kostümgeschichte gehalten. All das half mir in meiner jetzigen Situation aber herzlich wenig weiter.
Da ohnehin kaum eines meiner Kleidungsstücke aus der aktuellen Saison stammte, entschied ich mich letztendlich für ein fliederfarbenes Sommerkleid von Betsey Johnson, das ich vor zwei Jahren bei einer Studienreise nach New York erstanden hatte. Es war mein erster Transatlantikflug, mein erster langer Flug überhaupt gewesen und damit für mich als von Höhen- und Flugangst geplagtem Menschen schon ein äußerst denkwürdiges Erlebnis. Der Big Apple hatte mich jedoch für jegliche Unannehmlichkeiten entschädigt. Eine ganze Woche lang hatten Kiki und ich uns die Füße wund und sogar blutig gelaufen, ein Museum, eine Ausstellung, eine Galerie, eine Sehenswürdigkeit nach der nächsten abgeklappert. Zum Shoppen blieb da wenig Zeit, und so war das fliederfarbene Betsey-Kleid neben den paar üblichen NYC-Souvenirs mein einziger Kauf geblieben und bis heute mein liebstes Andenken.
Ich hatte mich auf den ersten Blick in den zauberhaften Millefleurs-Stoff verliebt, und als Kiki meinte, das zarte Blauviolett entspreche genau meiner Augenfarbe, musste ich es einfach haben. Und siehe da, es passte wie angegossen und schien in dieser kleinen ausgeflippten New Yorker Boutique nur auf mich gewartet zu haben.
Ich mochte, wie sich das eng geschnittene Kleid um meine Hüften legte und wie die unzähligen kleinen Glastropfen am unteren Saum bei jedem Schritt leise klimperten und um meine Waden spielten. Der schmeichelnde Wasserfallausschnitt und die kunstvolle Ausbrenner-Optik aus Seidenchiffon und Samt verliehen ihm einen eleganten Charakter.
Das nächste Problem waren meine Haare. Man konnte nicht gerade sagen, dass sie im Alltag übermäßig anspruchsvoll oder widerspenstig waren. Eher war meine aschblonde, in meinen Worten straßenköterfarbene Mähne sogar von recht unkomplizierter Natur und ich widmete ihr meist eher geringe Aufmerksamkeit. Doch wehe, mein übriges Ich wurde von nervöser Unruhe erfasst. Das spürten meine Haare genau, und mein allgemeiner Gemütszustand übertrug sich umgehend auf sie. Dann erwachte die Diva auf meinem Kopf.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, sie zu bändigen und irgendetwas Elegantes aus ihnen zu zaubern, griff ich genervt zu der abgegriffenen Simpelklemme, mit der ich sie tagtäglich im Uni-Alltag zusammenhielt. Das Ergebnis war nicht gerade eine Galafrisur, aber es erfüllte seinen Zweck.
Obwohl ich mir immer wieder sagte, dass es eine vollkommen unverbindliche Verabredung mit einem Mann war, dem ich mich in keiner Weise verpflichtet fühlte, mit dem mich außer dem Interesse für fantastische Kunst rein gar nichts verband und den ich sicher niemals wiedersehen würde, stieg meine Nervosität von Minute zu Minute. Die Informationen, die ich über ihn im Internet eingeholt hatte, machten mich dabei nicht gerade ruhiger. Das Forbes Magazine nannte ihn unter den reichsten Männern der Welt und führte ihn in der Liste der einflussreichsten Unternehmer weltweit. Andere Magazine hatten ihn wiederholt zum begehrtesten Junggesellen gewählt. Ian Reed war 42 Jahre alt, kinderlos, wohltätig, offenbar weitestgehend skandalfrei und führte ein unstetes Leben ohne festen Wohnsitz.
Ich blickte auf die Uhr. Schnell noch die Katzen füttern, dann wurde es höchste Zeit, aufzubrechen. Mir wurde ein bisschen übel. Was, wenn ich dieser Verabredung nicht gewachsen war? Ich verkehrte nicht in solchen Kreisen. Mein Kosmos war die Universität. Die einzig »reichen« Leute in meinem Bekanntenkreis waren einige Künstler und Galeristen, die es geschafft hatten und denen ich ihren Erfolg von Herzen gönnte. Aber Ian Reed war ein ganz anderes Kaliber. Was, wenn ich mich blamieren würde? Kurz blitzte der Gedanke auf, einfach nicht hinzugehen.
Nein, das konnte ich nicht machen. Ich hatte ihm mein Wort gegeben. Und ich hatte einen ganzen Nachmittag nichts anderes getan, als mich auf diesen Abend vorzubereiten. Wie hätte ich Kiki erklären sollen, dass ich vor lauter Feigheit gekniffen hatte? Außerdem hätte ich es mir wohl selbst nie verzeihen können. Ich kannte mich. Ich hätte mich noch in Jahren und Jahrzehnten gefragt, wie es gewesen wäre, mit Ian Reed auszugehen, und was um alles in der Welt ich an diesem Abend verpasst haben mochte.
Mit klopfendem Herzen und schweißfeuchten Händen lenkte ich meinen kleinen Suzuki Cappuccino in eine Parklücke in der Bethmannstraße vis-à-vis dem Grand Reed. Es war fünf Minuten nach halb acht. Natürlich kannte ich das luxuriöse Traditionshotel, war schon hundertmal daran vorbeigegangen, doch heute sah ich das beeindruckende Gebäude mit seiner historisierenden Fassade und den goldenen Lettern über dem imposanten Säulenportal wie zum allerersten Mal.
Ich zögerte, über die Schwelle zu treten, doch der junge Portier im grauen Frack nahm mir die Entscheidung ab.
Meine Absätze klackerten auf dem spiegelglatten, hochglänzenden Marmorboden des Entrees, als ich den mittleren Teil der dreiflügeligen Lobby betrat, in dem sich die Rezeption befand. Das alles war noch gigantischer, als ich es mir vorgestellt hatte, und ich war gerade dabei, meinen erneut aufkeimenden Fluchtinstinkt niederzukämpfen, als ein zierlicher älterer Herr mit Schnauzbart und schwarzem Frack hinter einem der Rezeptionstresen hervortrat und sich zu mir gesellte.
Ich öffnete den Mund, um ihm mein Anliegen zu erklären, doch ich klappte ihn wieder zu, als er mich bereits ansprach.
»Frau Dr. Lauenstein?«, fragte er ebenso höflich wie vorsichtig.
Das war heute schon das zweite Mal, dass ich über die Nennung meines Namens in Erstaunen geriet.
»Ja«, bestätigte ich konsterniert.
»Herzlich willkommen im Grand Reed. Mein Name ist Wilfried Suter, ich bin der Concierge. Mr. Reed erwartet Sie in der großen Halle. Wenn Sie mir bitte folgen wollen?«
Wie ferngesteuert tat ich, wie mir geheißen, und ließ mich von ihm in den nächsten Saal der Lobby führen, in dem unter einem riesenhaften Kronleuchter Gruppen von Chesterfield-Sesseln um einen Steinway-Flügel angeordnet waren, auf dem ein junger Pianist Fly me to the Moon spielte. Ich ließ meinen Blick durch die Halle schweifen und registrierte, dass nur wenige der Sessel besetzt waren, als sich Ian Reed aus einem von ihnen erhob und quer durch den Saal auf uns zukam.
»Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich habe gehofft, dass Sie eine Frau sind, die ihr Wort hält«, sagte er mit einem strahlenden Lächeln, ehe er zum zweiten Mal an diesem Tag meine Hand küsste.
»Sie sehen bezaubernd aus«, ergänzte er, ohne meine Hand loszulassen, und es klang aufrichtig aus seinem Mund.
Er führte mich zu zwei Chesterfield-Sesseln, die etwas abseits vom Flügel und dafür näher an dem spektakulären Jahrhundertwende-Kamin standen, und der Concierge folgte uns mit ein paar Schritten Abstand.
»Ich dachte, wir nehmen hier einen Aperitif, ehe wir drüben dinieren«, erklärte Ian Reed und bedeutete mir, Platz zu nehmen, ehe auch er sich setzte.
Im Gegensatz zu mir trug er noch genau das Gleiche wie am Nachmittag, und auch die Haare schien er sich zwischenzeitlich nicht gekämmt zu haben. Dennoch sah er einfach umwerfend aus. Es war gerade diese lässige Nonchalance in seinem Auftreten, gepaart mit der über alle Zweifel erhabenen, weltmännischen Selbstsicherheit, die ihn so anziehend machte.
»Lassen Sie uns zwei Kir Blackberrys bringen. Das wäre dann alles. Vielen Dank, Wilfried.«
»Sehr gern, Sir.« Der alte Herr deutete eine Verbeugung an und ließ uns dann allein.
»Worüber amüsieren Sie sich?«, fragte Ian Reed, und seine silbrig schimmernden Augen betrachteten mich aufmerksam.
Ich hatte geglaubt, nur in mich hineingelächelt zu haben, und fühlte mich ein bisschen ertappt, als ich gestand: »Im ersten Moment dachte ich, Sie hätten zwei Mobiltelefone bestellt.«
Jetzt lachte auch er dieses perlende Lachen, dessen Klang mir schon vorhin so gut gefallen hatte.
»Ich hoffe, Sie mögen Brombeerlikör?«, fragte er.
»Ehrlich gesagt habe ich noch nie welchen getrunken«, gab ich zu, als ein ganz in Schwarz gekleideter Enddreißiger mit leichtem Bauchansatz und Henriquatre-Bart an unseren Tisch trat.
»Mr. Reed, Sir, meine Dame«, grüßte er ehrfürchtig und stellte das silberne Tablett, das er auf dem linken Unterarm balanciert hatte, vorsichtig auf dem niedrigen Beistelltisch ab.
Ich hatte zwei fertige Drinks erwartet, doch stattdessen hatte uns der Mann im schwarzen Hemd eine Flasche Moët, ein Fläschchen Likör, ein Schälchen mit Brombeeren und zwei Sektflöten mit Medusenhäuptern am Fuß mitgebracht.
»Sam ist der beste Barkeeper weit und breit und ein echter Magier auf seinem Gebiet«, erklärte Ian Reed mit einem gewissen Stolz in der Stimme. »Die Zubereitung eines Kir unterfordert ihn gewissermaßen.«
»Aber nein, Sir«, entgegnete der über beide Wangen strahlende Sam, während er jeweils eine kleine Menge Likör in die Sektgläser fließen ließ und dann mit einem ordentlichen Knall den Champagner entkorkte. Zum Schluss fügte er jedem Glas eine frische Brombeere hinzu und reichte uns die Drinks, um sich dann schnell und diskret zu entfernen.
»Auf das Schicksal und unsere zufällige Begegnung«, sagte Ian Reed, und wieder tauchten seine hypnotischen Augen bis tief in mein Innerstes, als er sein Glas klingend gegen das meine tippen ließ.
Der Kir Blackberry schmeckte köstlich; fruchtig, prickelnd, kühl und angenehm säuerlich.
»Kommt es häufiger vor, dass Sie Zufallsbekanntschaften zu einem solchen Abend einladen?«
»Nur wenn mich die Zufallsbekanntschaft zuvor beleidigt hat«, entgegnete er mit einem spöttischen Grinsen. »Und wenn sie noch dazu überaus attraktiv und klug ist.«
Er nippte an seinem Kir und fixierte mich wieder auf diese ebenso anziehende wie beunruhigende Weise.
Dann schüttelte er seinen hübschen Kopf.
»Nein, Frau Dr. Lauenstein. Um ehrlich zu sein, ist das hier das erste Mal. Ein Experiment gewissermaßen.«
»Ein Experiment, wie schmeichelhaft. Und worin liegt das Erkenntnisinteresse dieses Experiments?«
Er lächelte jungenhaft, fast ein bisschen unsicher.
»Nun, einen Abend mit jemandem zu verbringen, mit dem ich keinerlei geschäftliche Beziehungen pflege, ist seit Ewigkeiten nicht mehr vorgekommen. Ich setze also gewisse Hoffnungen in Sie.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Könnten Sie bitte präzisieren, welche Art Hoffnungen Sie hegen? Ich möchte nämlich vermeiden, dass es die falschen sind, Mr. Reed.«
Er grinste entwaffnend.
»Aber Sie sind hier, Frau Dr. Lauenstein. Mehr zählt im Moment nicht für mich. Der Abend wird zeigen, welche und wessen Hoffnungen erfüllt und welche enttäuscht werden.«
Er prostete mir nochmals zu.
»Sie haben also eine Postdocstelle am Kunstgeschichtlichen Institut der Universität Frankfurt, auf der Sie an Ihrem Habilitationsvorhaben über Körper und Körperlichkeit in der Modernen Kunst arbeiten. Sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass Sie erst dreißig sind.«
»Ich muss sagen, Sie überraschen mich, Mr. Reed. Meine Stellenbeschreibung ist im Online-Mitarbeiterverzeichnis des Instituts einzusehen. Aber mein Alter und mein Forschungsthema stehen dort nicht. Verraten Sie mir, woher Sie diese Informationen haben?«
»Tut mir leid, Betriebsgeheimnis. Nur so viel: Ich bin sehr gut auf dem Feld der Recherche.«
»Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, Sie überlassen nicht viel dem Zufall, oder? Einem spontanen Impuls nachzugeben, eine solche Einladung auszusprechen, entspricht wohl nicht gerade Ihrem Stil. Vermutlich haben Sie meine Vita schon gecheckt, ehe wir uns auf der Caféterrasse zum zweiten Mal begegnet sind. Ihre Selbstsicherheit fußt zu einem guten Stück auf Kontrolle, habe ich recht?«
»Sie ahnen ja nicht, wie recht Sie haben.«
Seine Stimme klang plötzlich so anders. Einen Moment lang wirkte er wie jemand, dessen wunden Punkt man getroffen hatte, und für einen ganz kurzen Augenblick, kaum mehr als ein Wimpernschlag, lugte hinter der Maske des strahlenden Geschäftsmannes ein verunsichertes, zweiflerisches und gequältes Wesen hervor, dessen Anwesenheit mich über alle Maßen irritierte.
Doch dann kehrte das feine Lächeln auf sein ebenmäßiges Gesicht zurück, und alles war wie zuvor.
»Jetzt sehen Sie mich überrascht, Frau Dr. Lauenstein. Das kommt nicht besonders häufig vor. Respekt.«
»Nun, auch ich bin zur Internetrecherche fähig, Mr. Reed.«
»Aber auch da steht nicht, dass ich ein kontrollsüchtiger Sonderling bin. Anderenfalls hätten meine Anwälte bereits einstweilige Verfügungen erwirkt.«
»Nein, keine Sorge. So steht es dort nicht und das ist auch nicht das Bild, das ich von Ihnen gewonnen habe. Ich habe lediglich ein wenig zwischen den Zeilen gelesen. Ein Leben ohne feste Bindungen, ohne Fixpunkte.«
»Sie spielen auf meinen ungewöhnlichen Lebenswandel an. Ein Leben ohne festen Wohnsitz, ohne Lebensmittelpunkt, können sich die meisten Leute nur schwerlich vorstellen. Ich gebe zu, dass es ein wenig befremdlich klingen mag, aber eigentlich ist es nur eine logische Konsequenz. Ich lebe in meinen eigenen Hotels und nutze meine Aufenthalte, um nach dem Rechten zu sehen. Ich habe in meinem Leben nie ein Zuhause im eigentlichen Sinn gehabt. Also vermisse ich nichts.«
»Das tut mir sehr leid für Sie, Mr. Reed.«
»Das muss es nicht. Dieses Zigeuner- und Vagabundenleben passt zu mir. Es ist die ultimative Freiheit, ohne Verpflichtungen und Abhängigkeiten.«
»Aber jeder Mensch braucht doch einen Rückzugsort. Einen Ort, an dem er sich geborgen fühlt und ankommen kann.«
»Vielleicht werde ich diesen Wunsch ja eines Tages auch verspüren und sesshaft werden. Wer weiß. Derzeit sind jedenfalls meine Hotels mein Zuhause, und wer kann schon von sich sagen, überall auf der Welt so komfortabel daheim zu sein.«
Ich lächelte.
»Ja, so gesehen haben Sie natürlich recht. Ein First-Class-Nomadenleben mit Zimmerservice, Spa und Fünfsterne-Ambiente lässt sich in der Tat auch als einmaliges Privileg betrachten.«
Ohne Ankündigung erhob sich Ian Reed aus seinem Sessel und reichte mir seine Hand.
Ich musste etwas irritiert dreingeschaut haben, denn er erklärte: »Ich denke, es ist Zeit für unser Dinner.«
Also ergriff ich zögernd seine Hand und erhob mich ebenfalls. Er schob meine Hand unter seinen angewinkelten Arm, und diese klassische, gewissermaßen anachronistische Geste überraschte mich bei einem Mann, dessen Auftreten mir bisher so unkonventionell erschienen war.
Und ich muss gestehen, es fühlte sich großartig an. Die Selbstverständlichkeit, mit der er mich an seiner Seite hielt, dieser diskrete Körperkontakt, seine dynamische Körperspannung, das diffuse Gefühl von Sicherheit, das mir seine Nähe gab.
Obwohl wir in einem der hauseigenen Restaurants essen würden, wie mir Ian Reed mitteilte, war es ein weiter Weg, und ich gewann einen erneuten Eindruck von der immensen Größe dieses Hotels.
»Ich hoffe, Sie mögen die moderne französische Küche«, sagte er, als wir um eine weitere Ecke bogen und das elegante Entree eines Luxusrestaurants vor uns auftauchte.
Ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf den messingfarbenen ›Notenständer‹ mit der ganz in französischer Sprache abgefassten und selbstverständlich preislosen Menüfolge. Dann hatte uns schon die junge Empfangsdame gesichtet: »Mr. Reed, Mademoiselle, bienvenue à la Petite Europe. Ihr Tisch ist wie immer für Sie reserviert, Mr. Reed. Wenn Sie mir bitte folgen mögen.«
Wir gingen durch einen Saal mit herrlich hohen, holzvertäfelten Wänden, vorbei an kunstvoll gedeckten runden Tischen mit bodenlangen Tischdecken, an denen Geschäftsleute und vornehm gekleidete Paare speisten und sich in gedämpfter Lautstärke unterhielten. Dann folgten wir ihr in einen zweiten, kleineren Raum, und als ich die riesigen bleiverzierten Rundbogenfenster sah, wusste ich, welches Ian Reeds Stammplatz sein musste. Hier am Fenster, etwas abseits vom Trubel des übrigen Hotel- und Restaurantbetriebs hatte man nicht nur einen fabelhaften Blick auf die traumhafte Terrasse, sondern man konnte durch die große, offen stehende Rundbogentür auch das ganze Restaurant sehen.
Ganz Gentleman schob mir Ian Reed den samtbezogenen Louisquinze-Sessel hin, ehe er an meiner Seite Platz nahm.
»Ich werde Monsieur Lezard informieren, dass Sie hier sind«, sagte die junge Frau, nachdem sie die Tischkerze angezündet hatte.
Ich bewunderte das kunstvolle, in einer antiken silbernen Schale arrangierte Blumenbouquet aus weißen Rosen und Hortensien, wobei mir nicht entging, dass die Komposition auf unserem Tisch noch eine Nuance prachtvoller und ausgefallener war als die Gestecke auf den übrigen Tischen.
»Ein wirklich beeindruckendes Ambiente«, sagte ich und registrierte dabei das sterlingsilberne Besteck und das vor jedem von uns aufgebaute Ensemble von Versace-Gläsern.
Ian Reed lächelte leicht.
»Nicht halb so eindrucksvoll wie meine Begleitung am heutigen Abend«, entgegnete er mit dieser wunderbar feinherben Stimme, und seine Worte ließen mich augenblicklich erröten. Warum klang das aus seinem Mund kein bisschen kitschig?
Dann erschien ein Mann mit einer fast absurd hohen Kochmütze auf dem Kopf in der Tür. Der Küchenchef höchstpersönlich.
Monsieur Lezard entpuppte sich als ein Freund von Ian Reed, sofern Ian Reed so etwas wie Freunde besaß. Zumindest duzten sich die beiden, und von den Menschen, die ich am heutigen Tag im Umgang mit Ian Reed erlebt hatte, schien er mir am unbefangensten und natürlichsten. Und er schien überrascht, mich in seiner Begleitung zu sehen; ob positiv oder negativ vermochte ich nicht zu sagen.
»Gibt es etwas, das Sie nicht essen?«, wandte sich Ian Reed an mich.
»Ich esse nicht so gern Fleisch«, gestand ich. »Aber …«
Ich wollte hinzufügen, dass ich nicht streng vegetarisch lebte und man sich meinetwegen keine Umstände machen müsse, doch Ian Reed fiel mir ins Wort.
»Très bien. Dann bring uns bitte ein Dutzend Austern und anschließend das Übliche. Zweimal. Merci, Jacques.«
Der Küchenchef nickte beflissen, wobei sein schwierig zu deutender Blick einen Moment lang bei mir verharrte, ehe er uns allein ließ.
Mein fragender Gesichtsausdruck jedenfalls war offenbar eindeutig genug, um Ian Reed eine Erklärung zu entlocken.
»Auch ich ernähre mich nach Möglichkeit fleischlos. Das Menü, das man uns servieren wird, hat man speziell für mich zusammengestellt. Ich hoffe, Sie werden meinen Geschmack teilen.«
Ich lächelte, doch gleichzeitig spürte ich, wie sich meine verräterischen Lippen leicht kräuselten.
Die wenigsten Menschen hätten auf diese winzige Mimik geachtet, Ian Reeds Reaktion hingegen folgte prompt: »Habe ich Ihr Missfallen erregt, Frau Dr. Lauenstein?«
»Nein, es ist nur …«, stotterte ich ertappt, doch er unterbrach mich, indem er an meiner statt den Satz beendete.
»Sie sind es nicht gewohnt, dass man Entscheidungen für Sie trifft. Es irritiert Sie, dass ich die Bestellung aufgegeben habe, ohne nach Ihren Wünschen zu fragen. Das empfinden Sie als anmaßend.« Er fixierte mich streng mit seinen silberblau schimmernden Augen, und dieser Blick ließ mich frösteln. Mit einem Mal fühlte ich mich unwohl in meiner Haut.
»Nun, ich hätte es nicht so drastisch ausgedrückt und auch nicht so empfunden, aber es geht in die richtige Richtung«, entgegnete ich, um einen neutralen Tonfall bemüht.
Jetzt kräuselte er die Lippen. »Das kann ich sogar verstehen«, sagte er nachdenklich. »Und doch muss ich Ihnen sagen, dass Sie sich wohl daran werden gewöhnen müssen.«
»Gewöhnen?« Ich runzelte die Stirn.
»Entscheidungen zu treffen liegt in meiner Natur, Frau Dr. Lauenstein. Ich kann nicht anders.«
»Das mag im Hinblick auf Ihren beispiellosen unternehmerischen Erfolg ein vorteilhafter Wesenszug sein. Im privaten Bereich erscheint mir eine solche Haltung jedoch durchaus problematisch.«
Als er schwieg und sein Blick an mir vorbei in die unbekannte Ferne der lang gestreckten Raumflucht wanderte, fügte ich kleinlaut hinzu: »Verzeihen Sie mir meine offenen Worte. Das stand mir nicht zu.«
»Aber nein.« Er schüttelte den Kopf. »Selbstverständlich steht Ihnen das zu. Mehr noch, Sie haben vermutlich ganz recht mit Ihrer Einschätzung. Das ist heute im Übrigen schon das zweite Mal, dass Sie mich mit einer Wahrheit konfrontieren, die mir selbst nur allzu bewusst ist, die aber niemand in meinem Umfeld jemals auszusprechen wagt. Ich bin kontrollsüchtig und ich neige dazu, meine Mitmenschen zu bevormunden.«
Er lächelte ein freudloses Lächeln.
»Ich kann mich nur nochmals bei Ihnen entschuldigen, Mr. Reed. Es liegt mir gänzlich fern, mir ein Urteil über Ihre Person zu bilden. Ich kenne Sie ja kaum. Und ganz gewiss wollte ich Sie nicht beleidigen.«
»Das haben Sie nicht«, sagte er noch, ehe Jacques Lezard zusammen mit einem schlaksigen Kellner mit bodenlanger Schürze an unserem Tisch erschien.
»Zu den Belon-Austern empfehle ich diesen Muscadet Sèvre et Maine sur Lie vom Château du Poyet«, erklärte der Küchenchef.
»Für mich bitte ein stilles Mineralwasser«, sagte ich.
Und auf Ian Reeds irritierten Blick hin ergänzte ich entschuldigend: »Ich bin mit dem Auto hier.«
»Deshalb hatte ich ja angeboten, Ihnen einen Wagen zu schicken«, entgegnete er überheblich. »Nun, auch das lässt sich regeln, Frau Dr. Lauenstein. Wir bleiben jedenfalls bei deiner vorzüglichen Weinfolge, Jacques.«
Auf die Austern folgten noch sieben weitere Gänge, wie es sich für ein klassisches französisches Menü gehörte, sowie sieben unterschiedliche Weine, die mir trotz der sparsamen Einzelmengen spürbar zu Kopf stiegen.
Ich hatte bis zum heutigen Tag nicht geahnt, wie vielseitig und abwechslungsreich die vegetarische Haute Cuisine sein konnte, und abgesehen vom Kaviar im zweiten Gang, den ich verschmähte, schmeckte alles ganz vorzüglich, auch wenn ich stellenweise nicht genau wusste, was ich da eigentlich aß.
»Wie ich sehen kann, hat mir der Erfolg wieder einmal recht gegeben«, verkündete Ian Reed mit einem gewinnenden Lächeln, während ich den letzten Löffel des göttlichen Limetten-Sorbets auf meiner Zunge zergehen ließ.
»Ich gebe zu, Sie haben eine vorzügliche und sehr stimmige Wahl getroffen.«
»Aus Ihrem hübschen Mund, hinter dem sich ein derart kritischer Geist verbirgt, ehrt mich dieses Lob ganz besonders.«
Dann sah er auf seine Omega.
»Ich schlage vor, wir wechseln hinüber in die Hemingway-Bar. Dort geht es weniger steif zu und man kann den Abend bei einem Drink und guter Jazzmusik ausklingen lassen.«
Auch ich warf einen schnellen Blick auf meine Uhr.
»Es ist gleich Mitternacht. Ich denke, ich sollte jetzt gehen, Mr. Reed.«
»Fünf Minuten nach halb zwölf, um genau zu sein, Frau Dr. Lauenstein. Und nicht zu vergessen, die fünf Minuten Verspätung, mit denen Sie hier im Hotel eingetroffen sind. Vergessen Sie nicht, dass Sie hier sind, um eine Schuld zu begleichen.«
Er hob beide Brauen und seine graublauen Augen schillerten diabolisch, wenn seine strenge Miene auch nicht ganz frei von Ironie war.
»Ich erwarte, dass Sie mir noch bis Mitternacht Gesellschaft leisten. Danach steht es Ihnen frei, zu gehen oder noch zu bleiben. Oder sind Sie meiner schon derart überdrüssig?«
»Sie wissen ganz genau, dass es so nicht gemeint war, Mr. Reed. Ich schätze Ihre Gesellschaft und die geistreiche Konversation mit Ihnen sehr«, entgegnete ich wahrheitsgetreu, und wieder einmal hatte er mich dazu gebracht, mich vor ihm zu rechtfertigen.
Erneut bot er mir wie selbstverständlich seinen Arm, und diesmal ließ ich diese charmante Geste zu, ohne zu zögern.
So, Sie schätzen also die geistreiche Konversation mit mir, Frau Dr. Lauenstein«, griff er unser Gespräch mit leicht sarkastischem Tonfall wieder auf, nachdem wir in einer gemütlichen Nische der ebenso atmosphärischen wie detailverliebt möblierten Bar Platz genommen hatten.
»Ja, genau das sagte ich, Mr. Reed«, erwiderte ich leichthin, während ich mich umsah. Ich mochte dieses nostalgische Ambiente, das warme, schummrige Licht, die hochglanzpolierten, cognacfarbenen Holzvertäfelungen, die wuchtigen englischen Klubsessel und die spiegelverglaste Theke mit ihren unzähligen Spirituosen.
Und da war auch Sam wieder.
»Für die Dame bitte einen Singapore Sling. Für mich nur einen doppelten Espresso.«
»Möchten Sie mich gern betrunken sehen, Mr. Reed?«, fragte ich frei heraus, nachdem Sam uns den Rücken gekehrt hatte.
»Ich muss gestehen, das wäre eine durchaus reizvolle Vorstellung. Aber vorerst sind Sie mir bei klarem Verstand lieber, Frau Dr. Lauenstein.«
»Vorerst«, wiederholte ich stirnrunzelnd und mit gekräuselten Lippen, ehe ich dankend meinen Drink entgegennahm.
»Was genau ist das?«, fragte ich und betrachtete den grellroten Cocktail mit der aufwendig gestalteten Ananas-Deko am Rand.
»Der Singapore Sling ist ein Klassiker auf Basis von Gin, Kirschlikör, Triple Sec und Bénédictine«, erläuterte Ian Reed beflissen. »Ich bin überzeugt, er wird Ihnen schmecken.«
Versuchsweise nippte ich an dem exotischen Mixgetränk, tat mich jedoch ein bisschen schwer mit dem überbreiten Strohhalm.
»Mhm.«
»Ich wusste, dass er Ihren Geschmack trifft. Und ich hatte auf diesen wundervollen Anblick gehofft.«
Ich hob fragend beide Augenbrauen.
»Wie sich Ihre Lippen um den Trinkhalm schließen, die An- und Entspannung Ihrer Wangenmuskulatur, wenn Sie die Flüssigkeit ansaugen. Das ist sehr sinnlich.«
Seine Stimme klang rau und unglaublich sexy.
Ich lächelte verlegen, und vermutlich wurde ich sogar ein wenig rot.
Ian Reed hatte mich zum Dinner in sein sündhaft teures Hotel eingeladen. Was hatte ich geglaubt, was er sich davon versprach? Nur einen netten Plausch unter Kunstfreunden? Wohl kaum. Natürlich hatte er mehr im Sinn. Ich konnte mir zwar nicht erklären, warum seine Wahl ausgerechnet auf mich gefallen war, aber seine Absichten waren ganz plötzlich mit Händen zu greifen. Warum hatte ich heute Nachmittag nicht einen einzigen Gedanken an diese Frage verschwendet? Weil ich dann ganz sicher nicht hergekommen wäre. Die bewährte Verdrängungstaktik à la Lauenstein. Glückwunsch, Ann-Sophie.
»Sinnlich und gefährlich«, fügte er kryptisch hinzu, und der Blick, mit dem er mich durch seine silbrig-blauen Augen ansah, ließ mich erschauern. Wie konnte ein Blick voller Begehren derart kühl und überlegen wirken? Und doch berührte gerade diese Ambivalenz etwas tief in mir.
»Gefährlich für Sie oder für mich?«, fragte ich, um einen abgeklärten Tonfall bemüht, und zwang mich zu einem ebenso neutralen Lächeln.
»Ich fürchte für uns beide, Ann-Sophie. Ich darf Sie doch so nennen?«
Ich nickte irritiert. Wie melodisch und verheißungsvoll mein Name aus seinem Mund klang.
»Wie meinen Sie das, Mr. Reed?«
»Ian. Gefährlich für Sie, weil Sie meine Spielregeln nicht kennen. Gefährlich für mich, weil ich mich auf dünnem Eis bewege.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie meinen, Ian.«
»Nein, Ann-Sophie. Wie sollten Sie auch.«
Er lächelte ein melancholisches Lächeln, doch um seine Mundwinkel spielte zugleich ein harter Zug.
»Ich hätte Sie nicht hierherbestellen dürfen. Das tut mir leid.«
Sein hübsches Gesicht wirkte plötzlich gequält und mit einem Schlag um mehrere Jahre gealtert. Mit einem Mal sah er aus wie ein Mann, der eine schwere Bürde zu tragen hatte. Er leerte das Wasserglas, das ihm Sam zu seinem Espresso gereicht hatte, mit einem Zug.
»Sie sind ein rätselhafter Mann, Ian Reed, aber das entspricht wohl auch dem Bild, das Sie vermitteln wollen. Ich halte es für das Beste, wenn ich jetzt gehe.«
Ich erhob mich und wollte ihm zum Abschied und zum Dank die Hand reichen. Doch stattdessen stieß ich mit dem Handgelenk gegen mein halb geleertes Cocktail-Glas, dessen Inhalt sich augenblicklich über den Tisch und über Ian Reeds Hose ergoss.
»Oje, das tut mir leid«, brachte ich hervor.
Das tat es wirklich, doch sein völlig entsetzter Gesichtsausdruck brachte mich unweigerlich zum Grinsen.
Er erhob sich mit einem theatralisch strafenden, tadelnden Blick.
»Ach, Sie finden das auch noch komisch?«, blaffte er durch halb zusammengebissene Zähne, und sein Tonfall war so schneidend, dass ich das Grinsen augenblicklich einstellte.
»Nein, verzeihen Sie. Selbstverständlich werde ich für die Reinigung aufkommen«, beeilte ich mich zu erklären und dabei eine möglichst betretene Miene aufzusetzen.
»Ich fürchte, das wird mir nicht genügen«, knurrte er.
Jetzt begann mir die Situation wirklich unangenehm zu werden. Natürlich war dieses Malheur ärgerlich, insbesondere bei einem Hedi-Slimane-Anzug. Aber dennoch hatte ich erwartet, dass ein milliardenschwerer Unternehmer wie Ian Reed ein wenig mehr über solchen Dingen stehen würde und sich seinen Ärger zumindest nicht so deutlich würde anmerken lassen.
Doch da hatte ich mich offenbar gehörig getäuscht.
Er ergriff meine Hand auf eine resolute und nicht allzu galante Weise und führte, besser zog mich zum Ausgang der Bar und von dort zu den drei Aufzügen direkt gegenüber.
Endlich fand ich meine Stimme wieder, um zu protestieren.
»Bei allem Respekt, ich muss sagen, ich finde Ihr Verhalten ziemlich befremdlich und übertrieben. Wo wollen Sie überhaupt mit mir hin, Ian? Schicken Sie mir die Reinigungsrechnung, aber …«
Weiter kam ich nicht, denn in diesem Augenblick öffnete sich die Tür des mittleren Aufzugs, und nachdem er sich mit einem kurzen Blick überzeugt hatte, dass die Kabine leer war, stieß er mich förmlich hinein.
»Die Hose ist mir vollkommen gleichgültig, Ann-Sophie«, knurrte er, während er mich gegen die spiegelverglaste Rückwand schob und die Tür sich hinter uns schloss.
Ich schnappte nach Luft, als mir die Intimität dieser Situation bewusst wurde. Mit diesem verboten attraktiven, unberechenbaren Mann hier drin eingeschlossen zu sein war so ziemlich das Aufregendste und Erotischste, das ich mir vorstellen konnte.
Plötzlich war er ganz nah und ich nahm seinen betörenden Duft wahr – herb und männlich mit einem edlen Hauch Floris.
Mein Herz raste und mein Puls pochte hämmernd in meinem Hals, als Ian seine Hände kraftvoll links und rechts von meinem Kopf gegen den Spiegel stemmte und mich zwischen sich und der Glaswand gefangen hielt.
Dann senkte er seine Lippen auf meine, wobei diese fein geschnittenen, sinnlichen Lippen überraschend roh und unnachgiebig agierten. Gierig zwang er meinen Mund auf, und atemlos ließ ich ihn gewähren. Der Kuss, der nun folgte, stellte alles bisher Erlebte in den Schatten. Das war kein Kuss, das war eine Urgewalt, die da über mich hereinbrach; ursprünglich, besitzergreifend, elementar.
Dann hielt der Aufzug, und ehe ich begriff, wie mir geschah, zerrte er mich den Korridor entlang, bis er vor der Tür mit dem goldenen Türschild Präsidentensuite stehen blieb.
Ohne mich loszulassen, zog er seine Magnetkarte aus der Jacketttasche und stieß mit dem Ellbogen die Tür auf.
Mir blieb keine Zeit, die weitläufigen Räumlichkeiten und den Luxus zu bestaunen, der mich hier umgab, denn Ian warf sein Sakko achtlos zu Boden und drängte mich ohne Umschweife rücklings gegen die Wand im Flur, um mich erneut auf diese unnachgiebige Weise zu küssen.
Ich kann nicht sagen, welche vielfältigen Empfindungen mich in diesem Moment durchströmten, aber sie alle sammelten sich heiß und verlangend in meiner Mitte. Ich begehrte Ian Reed wie keinen Mann vor ihm.
Seine sinnlichen Lippen wanderten an meinem Hals hinab und versengten die Mulde meines Schlüsselbeins, mein Dekolleté, die weiche Haut entlang meines Ausschnitts. Jeder einzelne dieser mal samtig weichen, mal ungemein rohen Küsse hallte in meinem Inneren wider und erzeugte ein Feuer, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Ich stand lichterloh in Flammen. Noch niemals hatte mich ein Mann auf so leidenschaftliche, ungestüme Weise geküsst und noch nie war ich so bedingungslos bereit gewesen, mich hinzugeben.
Ian ging vor mir in die Knie und ich sah auf seine verwuschelten Haare hinab, während seine makellosen Hände meine Beine liebkosten und mir dann brüsk das Kleid über die Hüften schoben.
Für einen kurzen Augenblick wurde mir bewusst, was ich hier eigentlich tat. Ich hatte mich noch niemals auf eine solche Weise von einem Mann nehmen lassen. Wir würden es im Stehen tun; wie ein Flittchen gegen die Wand gelehnt, noch halb angezogen, wie eine Hure.
Er sah mit fiebrig glänzenden Augen zu mir auf und schien diesen Moment des Unbehagens in meinem Blick zu sehen, denn plötzlich wurden seine Berührungen wieder sanfter. Behutsam drängte er meine Schenkel auseinander, war mit seinem Kopf zwischen meinen Beinen und bedeckte die Innenseiten meiner Schenkel mit unzähligen samtigen Küssen, ehe er mir das Spitzenhöschen auszog und ich es achtlos mit dem Fuß wegtrat.
Die Kühle an meinem entblößten, erhitzten Schoß erregte mich, und ich spürte plötzlich die heftige Feuchte zwischen meinen Beinen, während Ian sich wieder erhob.
»Nimmst du die Pille?« Seine Stimme klang kehlig und unheimlich sexy.
Ich nickte atemlos.
Ja, ich wollte diesen Mann. Ohne jeden Zweifel. Hier und jetzt und ganz gleich, wie verrucht es auch sein mochte.
Ian erstickte meine Gedanken mit einem erneuten fordernden Kuss, während er an seiner Hose nestelte und mich im nächsten Moment an den Hüften emporhob.
Und dann war er in mir. Ich stöhnte laut in seinen Mund, in einer wilden Mischung aus Schreck, Schmerz und höchster Erregung. Er war so unglaublich groß. Er dehnte mich bis an die Schmerzgrenze, füllte mich so vollkommen aus, dass ich glaubte, dieses wunderbare, quälende, unvergleichliche Gefühl keine Sekunde länger zu ertragen. Doch ich ertrug es und ich genoss es. Er ließ mir einen Moment Zeit, mich an ihn zu gewöhnen, dann begann er, sich in mir zu bewegen. Und wie er sich bewegte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Mann zu solchen Stößen fähig sein könnte. Meine bebenden Schenkel suchten Halt um seine schmalen Hüften, meine Hände krallten sich in seinen Nacken, während er sich immer wieder aufs Neue so unglaublich tief und erbarmungslos hart in mich rammte.
Wie eine Ertrinkende hing ich an ihm, wurde zwischen ihm und der Wand aufgerieben, glaubte, es nicht mehr auszuhalten, und gierte doch nach noch mehr. Keuchend und wimmernd ließ ich mich von ihm an den Rand der Besinnungslosigkeit treiben, erduldete und genoss seine unbändige Kraft, mit der er in mir wütete. Wie in Trance spürte ich das Herannahen dieses elementaren inneren Zitterns, das mich überrollte, über mich hinwegbrandete wie eine gigantische Welle und sich in der Kontraktion all meiner inneren Muskeln Bahn brach.
Jetzt stöhnte auch Ian und trieb sich mit einem letzten gnadenlosen Stoß in mich, ehe wir gemeinsam kamen und er sich wie eine Naturgewalt in mir entlud.
Er blieb noch einen Augenblick in mir und küsste mich zärtlich, ehe er mich behutsam hinunterließ. Kraftlos ließ ich mich an der Wand zu Boden sinken und raffte mein Kleid um meine Beine, die wie Espenlaub zitterten.
»Alles in Ordnung?«, fragte er sanft, während er routiniert seine Kleider ordnete.
Als er keine Antwort von mir erhielt, blickte er mir tief in die Augen, schien darin lesen zu wollen, wie es mir ging.
Ich schloss die Augen und nickte.
Dann streckte auch ich die Hand nach meinem Slip aus, doch Ian trat dazwischen.
»Den wirst du heute Nacht nicht mehr brauchen«, sagte er mit einem spöttischen Lächeln und einer Stimme, die noch immer unglaublich rau klang.
Ich errötete, ließ mich aber nicht beirren und hielt seinem tadelnden Blick stand, während ich mich wieder halbwegs herrichtete.
Ich glaubte, er würde sich neben mir niederlassen, doch er bückte sich, um mich aufzuheben. Er lud mich auf seine Arme und trug mich ohne erkennbare Anstrengung in das herrschaftliche Wohnzimmer seiner Suite, wo er mich vorsichtig auf dem riesigen elfenbeinfarbenen Sofa ablegte und meine Füße auf seine Knie bettete.
Mit geübten Griffen öffnete er die Schnallen meiner hohen Sandaletten und begann dann gekonnt, meine Füße zu massieren. Er knetete meine Fußsohlen, ließ seine langen Finger über meinen Spann wandern und liebkoste meine Waden und Schienbeine. Es war himmlisch.
»Wie viele Frauen hast du auf diese Weise bereits in deine Suite gelockt, Ian?«, fragte ich und dachte an den Wein, die Bar, die Szene mit dem Cocktail.
Er hielt in seinem Tun inne.
»Ein solcher Aufwand war bisher nie nötig, Ann-Sophie. Denn gewöhnlich zahle ich für entsprechende Gesellschaft.«
Ich lächelte unsicher, denn ich hielt diese Worte für einen Scherz, doch er blieb ganz ernst.
»Du hast erlebt, wie ich bin.«
Ich war wie vor den Kopf gestoßen und wusste nicht, was ich darauf hätte entgegnen sollen. Meine Gedanken waren noch immer bei der Vorstellung, dass ein Mann, der so attraktiv, charismatisch und wohlhabend war wie Ian Reed, ein Mann, der so ziemlich jede Frau der Welt haben konnte, die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahm.
Wieder begann er, zärtlich meine Beine zu streicheln.
»Du bist eine wunderschöne, begehrenswerte Frau, Ann-Sophie Lauenstein. Du hast hinreißende Beine und eine unglaublich zarte, glatte Haut. Trotzdem solltest du wissen, dass ich Nylon bevorzuge. Halterlose oder Strapse.«
Ich sah ihn irritiert an und hob die Augenbrauen. Ein Nylon-Fetisch? Fast hätte ich erleichtert aufgelacht.
Doch dann wurde sein Griff um meine Wade fester, fast schmerzhaft fest.
»Und ich will nicht, dass du so missbilligend die Brauen hebst oder die Lippen kräuselst. Nicht, solange wir intim miteinander sind. Hast du mich verstanden?« Um seine Mundwinkel spielte ein harter Zug und sein Tonfall klang energisch.
Langsam begann ich zu begreifen. Der harte, schweißtreibende Sex eben im Flur war nicht nur Ausdruck spontaner Begierde und überschäumender Lust gewesen. Es war seine Art von Sexualität. Ian Reed gab nicht nur im Alltag und beruflich gern den Ton an, er war auch dominant im Bett. Und obwohl ich niemals zuvor ein Verlangen nach derartigen Machtspielen verspürt hatte, erregte mich diese Vorstellung plötzlich zutiefst.
»Ich hatte dich vor mir zu warnen versucht. Ich hätte dich gehen lassen, Ann-Sophie. Aber dir musste ja unbedingt dieses Missgeschick passieren.« Er lächelte gequält und fuhr sich in einer resignierten Geste mit der Hand über sein hübsches Gesicht.
Ich streckte meine Hand nach ihm aus und strich ihm sanft eine dieser widerspenstigen Haarsträhnen aus der Stirn.
»Ich für meinen Teil bin ganz froh, dass ich dir den Singapore Sling über die Hose geschüttet habe«, sagte ich schmunzelnd. »Kaum auszudenken, was ich sonst verpasst hätte.«
Ian sah mich überrascht an.
»Es hat dir also gefallen?«, fragte er verblüfft und ohne eine Spur der überheblichen Selbstsicherheit, die er üblicherweise zur Schau trug.
»Ich hatte eigentlich angenommen, das wäre offensichtlich gewesen.«
»Dein Körper hat mit Verlangen reagiert, Ann-Sophie. Das ist mir nicht entgangen. Worum ich mir eher Sorgen mache, ist deine charakterstarke Persönlichkeit. Meine Bettgefährtinnen waren bisher nie Frauen von deiner Art.«
»Frauen von meiner Art?« Ich hob skeptisch die Augenbrauen, denn die Formulierung implizierte, dass er mich in eine bestimmte Schublade einsortiert hatte.
»Ich habe registriert, was du gerade wieder mit deinen Brauen gemacht hast«, entgegnete er drohend, ehe er fortfuhr: »Ich meine, Frauen von deinem Format, von deiner Klasse, deinem Standing, deinem Intellekt. Ich bin gewohnt, dass die Frauen in meinem Bett tun, was ich von ihnen erwarte und verlange.«
Ich räusperte mich und kräuselte die Lippen, wohl wissend, dass es ihm auffallen würde.
Er sah mich missbilligend an, sagte aber nichts dazu, sondern beeilte sich zu erklären: »Versteh mich nicht falsch, Ann-Sophie. Ich bin kein Chauvinist. Ich schätze starke, kluge Frauen. Viele meiner Hotels werden von Frauen geführt. Aber beim Sex liegen die Dinge anders. Meine Gespielinnen sind devot, demütig und unterwerfen sich meinem Willen.«
Ich schluckte.
»Nun, ich bin keine deiner Gespielinnen, Ian Reed. Und ich bin nicht devot oder demütig. Aber ich schätze die geistreiche Konversation mit dir.«
Wir mussten beide lachen, ehe ich ernster ergänzte: »Und ich bin wirklich gern mit dir zusammen.«
Ian beugte sich über mich, um mich zu küssen. Und diesmal war sein Kuss liebevoll und ungemein zärtlich.
»Ich bin auch gern mit dir zusammen, Ann-Sophie Lauenstein. Und ich bin froh, dass du keine von diesen Frauen bist. Ich habe dich über die Puppe sprechen hören, und es war, als hätte ich sie selbst zum allerersten Mal gesehen. Und dann sah ich dich. Eine Kunstwissenschaftlerin, wie sie sich Hollywood nicht begehrenswerter ausdenken könnte. Ich musste dich einfach kennenlernen, auch wenn es bedeutete, gegen all meine ureigenen Grundsätze zu verstoßen.«
»Welche Grundsätze, Ian?«
Er lachte jungenhaft.
»Ich fürchte, es sind so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Zunächst und vor allem, dich gegen jede Vernunft hierherzubringen und mich dir zu offenbaren, dich mit meinen Neigungen zu konfrontieren. Eine unbescholtene Geisteswissenschaftlerin, die ich nicht für ihr Schweigen bezahlt habe. Das war im höchsten Maße fahrlässig und die Tat eines vernarrten Dilettanten.«
»Dass du in mich vernarrt bist, gefällt mir. Für einen Dilettanten halte ich dich nicht.«
»Aber genau das bin ich, Ann-Sophie. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Wie ich mit dir umgehen soll. Das Zwischenmenschliche ist nicht gerade meine Stärke. Vermutlich war es schon mein erster großer Fehler, so mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich fürchte, ich habe dich gehörig verschreckt.«
»Nur ein bisschen.« Ich lächelte tapfer. »Aber ich bin froh darüber, dass du mit offenen Karten spielst und mir deutlich gemacht hast, woran ich bei dir bin.«
»Wenn du dich jetzt schaudernd von mir abwendest und die Flucht ergreifst, kann ich das verstehen.« Er schluckte schwer. »Möchtest du, dass ich dir einen Wagen rufe?«
Seine Stimme klang eigenartig fremd und kraftlos, seine graublauen Augen wirkten niedergeschlagen und hatten allen Glanz verloren.
»Nein.« Ich schüttelte langsam den Kopf. »Ich möchte lieber noch bei dir bleiben, Ian.«
Dieses kleine, feine Lächeln spielte um seine Mundwinkel.
»Das hatte ich nicht zu hoffen gewagt.« Er wirkte erleichtert.
Dann griff er zum Telefonhörer und orderte Wein, Wasser, Käse und Obst.
Ich nutzte die Gelegenheit, um die Toilette aufzusuchen und mich etwas frisch zu machen. Die Suite war noch gigantischer, als ich sie mir vorgestellt hatte, und das spektakuläre marmorne Badezimmer mit Whirlpool, Fernseher und Sauna wirklich beeindruckend. Ich warf einen prüfenden Blick in den monströsen Facettenschliff-Spiegel, wobei mir die schwarzmarmorne Ablage hinter den Waschbecken ins Auge fiel.
Selbst wenn ich nur eine Nacht in einem Hotelzimmer verbrachte, stand eine solche Ablage sofort rappelvoll mit meinen persönlichen Badutensilien. In Ian Reeds Suite standen dort genau ein Flacon von Floris, einer von Creed, dazu eine elektrische Zahnbürste und das Übliche vom Hotel gestellte Körbchen mit Pflegeprodukten. Sonst nichts.
Ich kehrte ins Wohnzimmer zurück und sah, dass Ian telefonierte. Er sprach lupenreines Französisch, und ich konnte seinen knappen Gesprächsfetzen entnehmen, dass es um Marokko ging und um Terminabsprachen. Dann klingelte der Zimmerservice und Ian öffnete, noch immer mit dem Smartphone am Ohr.
Er bedeutete dem jungen Mann, den Wein zu entkorken, uns einzuschenken und alles Weitere auf einem der Beistelltische zu arrangieren.
Nachdem wir wieder allein waren, naschte ich ein paar der kernlosen Trauben von der üppig dekorierten Obstschale und ließ meinen Blick durch den Raum schweifen. Auch hier war alles bis ins kleinste Detail durchkomponiert. Die hohen Fenster mit den schweren Brokatvorhängen, die edlen dunklen Hölzer, das helle Leder, die Designerlampen. Auf jedem der hochglanzpolierten Beistelltische stand eine echte Orchidee, jeweils mit weißer Blütenpracht im cremefarbenen Topf. An den Wänden hingen signierte Lithografien aus Dalís Don Quichotte, im Kamin prasselte ein Ethanol-Feuer.