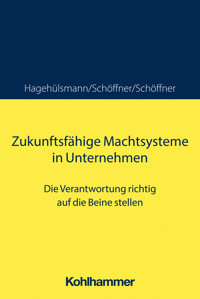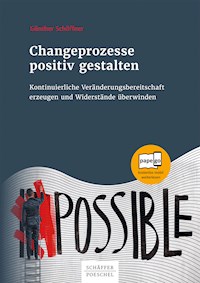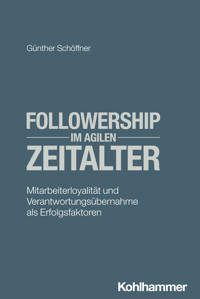
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In der Managementliteratur sind die Themen Führung und Leadership omnipräsent. Erfolgreiche Führung setzt aber voraus, dass sich Mitarbeiter auch führen lassen und die gemeinsamen Ziele mit Eigeninitiative lösungsorientiert verfolgen. Zudem verdrängen agile Ansätze die klassisch-hierarchischen immer mehr. Das erfordert nicht nur zeitgemäße Führung, sondern auch urteilsstarke Mitarbeiter, welche die Führungskräfte tatkräftig und selbstorganisiert unterstützen. Diese Bereitschaft zur Unterstützung und zum zielorientierten Sich-führen-lassen in Verbindung mit der Verantwortungsübernahme für Unternehmen, Mitarbeiter und Führungskräfte wird unter dem Begriff "Followership" zusammengefasst. Das Buch beschreibt die enge Wechselbeziehung von Leader- und Followership sowie die organisationalen und persönlichen Faktoren für Followership in der digitalen und agilen Arbeitswelt. Die Möglichkeiten und Grenzen praxisgerechter Followership-Ansätze schließen die Betrachtungen ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[3]Günther Schöffner
Followership im agilen Zeitalter
Mitarbeiterloyalität und Verantwortungsübernahme als Erfolgsfaktoren
Verlag W. Kohlhammer
[4]Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-044542-0
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-044543-7
epub: ISBN 978-3-17-044544-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
[5]Inhalt
Vorwort
1
Annäherung an Begriff und Inhalt der Followership
1.1
Followership, die unterschätzte und unterbewertete Disziplin
1.2
Die enge Verbindung von Leadership und Followership
1.3
Die Omnipräsenz von Followership: Jeder ist Follower und trägt Verantwortung
2
Follower in Unternehmen
2.1
Die rechtliche Stellung von Arbeitnehmern
2.2
Der Weg zur neuen Followership
2.3
Follower und Followership: Inhalte
2.4
Warum Menschen nur Follower sein wollen – und warum nicht
3
Praktizierte Followership in Unternehmen
3.1
Followership-Stile
3.2
Praktizierte Followership
3.2.1
Akzeptanz
3.2.2
Respekt
3.2.3
Toleranz
3.2.4
Taktik für »Managing up«
3.3
Gelebte Followership-Praxis in Unternehmen
4
Einflussfaktoren auf die gelebte Followership
4.1
Handlungsdeterminanten und Organisationsfaktoren als Ausgangspunkte
4.2
Organisationale Aspekte für die Ausbildung von Followership
4.2.1
Faktoren des »Wollens« und »Sollens«
4.2.2
Machtsysteme
4.2.3
Unternehmenskultur
4.2.4
Einfluss der Unternehmenskultur auf das »Wollen« und »Sollen«
4.3
Persönliche Aspekte
4.3.1
Können: Follower-Kompetenz
4.3.2
Wollen: Das innere Team
4.3.3
Wollen: Haltung und Einstellung
4.3.4
Wollen: Motivatoren
4.3.5
Wollen: Grundpositionen
4.3.6
Wollen: Emotionen
4.3.7
Wollen: Kultur
4.3.8
Wollen: Die Schattenseiten – Menschliche Besonderheiten, Unzulänglichkeiten und Schwächen
4.4
Zeitgenössische und zukünftige Einflussfaktoren
5
Implementierung Followership-orientierter Elemente: Organisation, Kultur, Menschen
6
Anhang: Klärung und Abgrenzung wichtiger Begriffe
[7]Vorwort
Wenn von Erfolg oder Misserfolg einer Organisation oder eines Unternehmens gesprochen wird, steht als Verantwortlicher dafür meist schon der betreffende »Anführer« fest: Der Vorstand, der Unternehmenschef, der Abteilungsleiter. Nur selten erfolgt der Hinweis darauf, dass auch die Mitarbeiter einen gehörigen Anteil daran haben. Wenn diesen eine Mitverantwortung eingeräumt wird, dann überwiegend im Erfolgsfall. Dass Mitarbeiter und deren Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft ebenso einen Anteil am Misserfolg eines Unternehmens ausmachen können, hört man hingegen selten. So ist es aber. Das diesbezügliche Verständnis ist nicht nur in Deutschland immer noch sehr zentriert auf die Führungskräfte. Dabei können diese ohne Mitarbeiter nahezu nichts ausrichten. Dementsprechend bedeutend ist der Anteil der Mitarbeiter an Erfolg und Misserfolg. Daher steht hier im Gegensatz zu vielen anderen Büchern nicht die Führungskraft, der Chef oder ganz allgemein formuliert der Leader im Fokus, sondern die Mitarbeiter, die in der Regel keine Führungsaufgaben haben und sich von den Leadern leiten lassen: Die Follower. Dieser Anglizismus wird verwendet, weil in den USA das Konzept der Followership schon viele Jahrzehnte bekannt ist und angewandt wird. In Europa ist es hingegen nur wenig bekannt und verbreitet. Sie ist aber für den Erfolg von Unternehmen genauso entscheidend wie gute Leadership. Daher wird der Inhalt dieses Ansatzes basierend auf den hierzu wesentlichen Theorien vorgestellt. Da diese überwiegend aus dem englischen Sprachraum stammen, ziehen sich die Anglizismen durch das gesamte Buch hindurch. Im digitalen Zeitalter sollte dies jedoch mittlerweile kein Problem mehr darstellen.
Der Inhalt des Buches fußt im Wesentlichen auf den einschlägigen Theorien zu Followership, Leadership, Führung und Management. Er ist jedoch angereichert durch zwei Dutzend Fallbeispiele aus der Praxis und wird dadurch sozusagen »zum Leben erweckt«. Das soll dem Leser das Verständnis vereinfachen und ihm die Gelegenheit geben, die Inhalte auf das eigene Berufsleben zu übertragen. Denn das Buch soll, wie alle meine bisherigen Bücher, nicht nur zum Lesen anregen, sondern eine Hilfe für die praktische Arbeit sein. Es ist sowohl für Leader als auch für Follower geschrieben, die das Followership-Konzept in ihrem Umfeld einführen oder weiterentwickeln wollen.
Die erwähnten Fallbeispiele entstammen der Realität, sowohl aus meiner eigenen als auch aus der von meinen Kollegen, mit denen ich mich zum Thema ausgetauscht habe. Die Fallbeispiele wurden so verändert, dass die Personen oder Organisationen, die hinter den Beispielen stecken, nicht erkannt werden können. [8]Die Beispiele sind dabei keine speziellen Sonderfälle oder Exoten, sondern können in der beschriebenen oder ähnlichen Form in vielen Unternehmen vorkommen. Das erleichtert die Übertragung in das Umfeld des Lesers. Sollten daher Ähnlichkeiten mit realen Unternehmen bestehen, so ist das zwar ein Hinweis auf die Praxisrelevanz der Inhalte, jedoch reiner Zufall. Denn die Fälle sind, wie beschrieben, so verändert, dass die wirklichen Unternehmen nicht erkennbar sind. Gleichzeitig sind die Fallbeispiele mitunter etwas zugespitzt, um die Inhalte und die Dynamiken der Geschehnisse etwas deutlicher herauszustellen. Dem Leser geht dadurch nichts verloren und ihm werden auch keine »Märchen« erzählt. Die beschriebenen Fälle handeln überwiegend in der produzierenden Industrie, weil ich dort seit vielen Jahren meinen Beratungsfokus habe. Zudem kann man hier die verschiedenen Fraktionen des Zusammenwirkens sehr gut erkennen: Vertriebsmitarbeiter, Finanzleute, Ingenieure, IT-Experten, Techniker, Montagearbeiter, Hilfskräfte etc. Sie alle betrifft Followership und nur wenn alle mitziehen, kann ein Unternehmen prosperieren. Doch die Erkenntnisse sind nahezu auf alle anderen Branchen und Unternehmensformen übertragbar. Die Fallbeispiele sind mitunter auch sehr lang und erstrecken sich teilweise über mehrere Seiten. Das hilft jedoch dabei, die komplizierten Verhältnisse besser zu verstehen und die eigentlichen Aussagen, die mit den Fallbeispielen getroffen werden sollen, besser zu erfassen und einzuordnen. Ich bitte hier den Leser um Verständnis, denn ich weiß, dass lange Fallbeispiele manchmal etwas Geduld und Ausdauer erfordern. Hinsichtlich des Verständnisses muss ich dem Leser empfehlen, das Buch von Anfang bis Ende durchzulesen, denn dafür wurde es konzipiert. Ein Einstieg in der Mitte bringt nicht die Erkenntnis, die sich beim Durcharbeiten von vorne bis hinten erschließen sollte.
Bei diesem Werk haben wie bei meinen anderen Büchern auch wieder viele weitere Personen unterstützt und mitgewirkt, auch wenn sie nicht als Co-Autoren tätig waren. Ihnen allen möchte ich hierfür sehr herzlich danken. Ohne den inhaltlichen Austausch, die Reflexionen zu den Themen oder die Beschreibung schwer zu fassender Konzepte wäre es nicht möglich gewesen, dieses Thema in Buchform zu bringen. Ich verzichte an dieser Stelle auf die namentliche Nennung all dieser Personen, denn sie alle wissen um ihre Unterstützung und um meine Dankbarkeit dafür.
Wie alle meine Bücher und Publikationen ist auch dieser Text im generischen Maskulinum ohne jegliche Gedanken einer Diskriminierung verfasst, weil die einfache Lesbarkeit des Textes im Vordergrund steht. Für mich waren Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit seit jeher Selbstverständlichkeiten, die nicht zur Diskussion stehen.
Ingolstadt, Juli 2024Günther Schöffner
[9]1Annäherung an Begriff und Inhalt der Followership
1.1Followership, die unterschätzte und unterbewertete Disziplin
Der Ausdruck »Follower« ist den meisten Menschen spätestens seit der Existenz sozialer Netzwerke ein Begriff. Er wurde in diesem Zusammenhang maßgeblich von der Social-Media-Plattform »Twitter« (heute »X«) geprägt. Er bezeichnet Personen, die bestimmten Inhalten, anderen Personen, Interessen oder Unternehmen in einer Art und Weise folgen, in der sie die Inhalte der gefolgten Person oder Institution im jeweiligen sozialen Netzwerk abonnieren. Sobald diese Netzteilnehmer neue Inhalte ins Netzwerk speisen, werden die Follower darüber unterrichtet und können diese dann nutzen. Dementsprechend beschreibt der Duden einen Follower als einen »regelmäßigen Empfänger von Informationen einer bestimmten Person oder Institution in sozialen Netzwerken«.1 Durch dieses Folgen sollen den Followern keine Inhalte verloren gehen. Obwohl der Begriff Follower in diesem Verständnis zwar maßgeblich durch Twitter geprägt wurde, hat er sich in vielen anderen sozialen Netzwerken ebenso durchgesetzt.
Übersetzt man den Begriff »Follower« mithilfe diverser Übersetzungsdienste und Fachlexika, resultiert eine Liste mit mehr als zehn verschiedenen Bedeutungen:2 »Anhänger«, »Fan«, »Verfolger«, »Nachfolger«, »Gefolgsmann«, »Getreuer«, »Verehrer«, »Mitläufer«, »Jünger«, »Schüler«, »Begleiter«, »Diener«. Die zuvor erläuterte Bedeutung des »Abonnenten« von Inhalten in sozialen Netzwerken findet sich jedoch in keiner Liste der zu Hilfe genommenen Übersetzungsdienste. Dies macht deutlich, dass eine Abhandlung zum Thema »Followership in Unternehmen« einer genauen Umschreibung der verwendeten Begriffe und einer klaren Abgrenzung des Themas und seines Kontextes bedarf. Das wird noch deutlicher, wenn man den zentralen Begriff dieses Buches, »Followership«, mit denselben Hilfsmitteln wie zuvor übersetzt. Das etwas ernüchternde Ergebnis der verschiedenen Quellen für das einzelne Wort lautet »Gefolgschaft« und »Anhängerschaft«.
[10]Im Kontext von Texten schlagen einzelne Übersetzungsdienste aber auch das Wort »Followerzahl« vor. Letzteres hat mit der Bedeutung von Followership in Unternehmen nur sehr wenig bis nichts zu tun, und die beiden genannten Begriffe umschreiben es nur unzureichend. Zwar hängt das Wort Followership untrennbar mit dem Wort »to follow« zusammen, das intuitiv schnell mit »folgen« übersetzt wird. Jedoch ist nicht nur das Wort »folgen« an sich, wie wir weiter unten noch sehen werden, bereits polyvalent, auch »to follow« kann mit über 20 verschiedenen Bedeutungen aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt werden. Da überrascht es nicht, dass mit einem Wörterbuch oder einem Übersetzungsdienst nicht sofort und eins zu eins mit einem Wort das zusammengefasst und wiedergegeben werden kann, was unter Followership in Unternehmen zu verstehen ist. Oft gehen auch vorgeschlagene Übersetzungen ganzer Texte inhaltlich an dem vorbei, was im angelsächsischen Raum unter Followership im Kontext von Organisationen, zu denen man auch Staat und Gesellschaft zählen kann, verstanden wird. Ein Verständnis des Sinnes von Followership gelingt also nicht durch das reine Übersetzen oder das Finden geeigneter deutscher Begriffe oder Umschreibungen. Das Phänomen der Followership muss daher anhand realer Zusammenhänge verständlich gemacht werden. Hierbei hilft der Umstand, dass Followership nicht nur in Unternehmen, sondern in allen Bereichen menschlichen Lebens und Handelns auftritt: In der Schule, im Verein, in der Familie, auf der Straße. Daher werden wir im weiteren Verlauf Beispiele für Followership aus diesen verschiedenen Bereichen betrachten, um uns der Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang dieses Buches zu nähern.
Neben der beschriebenen Problematik, die Bedeutung des Begriffs »Followership« für den Kontext dieses Buches mit einem eindeutigen Wort oder einer prägnanten Umschreibung darzustellen, kommt noch die erschwerende Tatsache hinzu, dass die oben genannten Übersetzungen des Begriffs sowohl bezüglich der Bedeutung für dieses Buch inhaltlich nur unzureichend zutreffend, als auch allgemein eher negativ konnotiert sind. Dies wird noch durch die Tatsache verschärft, dass das Wort »folgen«, das als eine der Hauptübersetzungen für den Begriff »to follow« verwendet wird, im Deutschen mehr als sieben verschiedene Bedeutungen hat. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, sich der Bedeutung des Begriffs für den Inhalt dieses Buches aus verschiedenen Richtungen Stück für Stück anzunähern. Hierzu sollen zunächst erst einmal kurz die deutschen Übersetzungen des Begriffs »to follow« betrachtet, und daraus dann die für unseren Kontext wichtigen Bedeutungen selektiert werden. Des Weiteren wollen wir aus den verschiedenen Bedeutungen des Wortes »folgen« jene auswählen, welche die Bedeutung für den Kontext des Buches am besten beschreiben. Aus verschiedenen Online-Übersetzungsdiensten lassen sich für das Wort »to follow« folgende deutsche Bedeutungen gewinnen, die der Bedeutung von »to follow« in unserem Kontext voll oder zumindest in einem gewissen Sinn entsprechen oder ihr in etwa nahekommen: »folgen«, »befolgen«, »verfolgen«, »beachten«, »nachfolgen«, »anschließen«, »einhalten«, »nachkommen«, »gehorchen«, »nachziehen«, »sich anschließen«, »mitkommen«, »sich richten nach«, »sich anhängen«, »sich anlehnen« und »sich halten [11]an«. Ferner lassen sich auch noch andere Bedeutungen identifizieren: »erfolgen«, »einschlagen«, »verstehen«, »sich ergeben«, »nachspüren«, »nachstellen«, »hinterherkommen« und »hervorgehen aus«. Diese markierten Punkte zusammenfassend lässt sich herausdestillieren, dass »to follow« nicht mit dem eingangs genannten Begriff des Abonnenten in Verbindung steht.
Denn es geht darum, einer Sache, einem Thema, einer Institution oder einer Person nachzufolgen, sich ihr anzuschließen, die eigenen Handlungen danach auszurichten oder sich den Erklärungen, Regeln und Weisungen einer Person oder Institution im Sinne von »befolgen« in einem gewissen Rahmen zu fügen.
Laut Duden hat das deutsche Wort »folgen« u.a. folgende inhaltliche Bedeutungen, die dem Begriff der Followership im Kontext des Buches nahekommen:3 »nachgehen; hinter jemandem, etwas hergehen«, »in der gleichen Weise oder ähnlich wie jemand handeln; sich nach jemandem, etwas richten; etwas mitmachen«, »einer Aufforderung o. Ä. entsprechend handeln, sich von etwas leiten lassen« und »gehorchen«. Auch hier gibt es weitere Bedeutungen, wie etwa »(später) nachkommen«, »zeitlich nach jemandem, etwas kommen, sich anschließen« oder »sich mit logischer Konsequenz ergeben«. Die beiden Begriffe »gehorchen« und »sich von etwas leiten lassen« stellen dabei die Extrempole eines gewissen Spannungsbogens dar, in dem die verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Begriffe verortet sind. Gehorchen bedeutet dabei, dass man den Weisungen eines Dritten folgt oder sie befolgt und dies u.U. dem eigenen Willen oder der eigenen Meinung zuwiderläuft. Gehorchen impliziert auch Gedanken der eingeschränkten persönlichen Handlungsfreiheit und kann somit negative Emotionen evozieren. Darauf werden wir später wieder zurückkommen.
Betrachten wir die Bedeutung der beiden Übersetzungsbegriffe von Followership, Gefolgschaft und Anhängerschaft etwas näher, so wird die fehlende Passung dieser Begriffe mit der zuvor beschriebenen Bedeutung von »to follow« oder »folgen« deutlich. Laut Duden haben die beiden Begriffe sowie der in diesem Zusammenhang wichtige Begriff »Anhänger« jeweils folgende Bedeutungen: Gefolgschaft4 (»Gehorsam und unbedingte Treue«, »Gesamtheit der treuen Anhänger, Anhängerinnen; Anhängerschaft«), Anhängerschaft5 (»Gesamtheit der Anhängerinnen und Anhänger«) und Anhänger6 (»Person, die entschieden, überzeugt für jemanden, eine bestimmte Sache, politische Richtung, Partei o. Ä. eintritt«).
Man kann im Begriff »Anhänger« noch Parallelen zur obigen Eingrenzung von »folgen« finden, wenn man das Eintreten für eine Sache darunter einordnet. [12]Insofern kann man die Gesamtheit der Anhänger, laut Duden eine Bedeutung von »Gefolgschaft«, noch in einer gewissen Nähe zu »Followership« sehen. Das Attribut »treu« entfernt jedoch den Begriff »Gefolgschaft« spätestens dann sehr weit von »Followership«, wenn man das Attribut »unbedingt« zur Treue hinzufügt und in einem Atemzug noch den Begriff »Gehorsam« nennt. Dies ist der Kern des Verständnisses von Gefolgschaft: Gehorsam und Treue, ohne Wenn und Aber. Und obwohl »to follow« eben auch »gehorchen« beinhaltet, kann inhaltlich gesehen »Gehorsam und unbedingte Treue« nicht als Hauptübersetzung von »Followership« gelten. Denn in unserem Kontext hat es eher die Bedeutung des sich nach etwas oder jemandem Ausrichtens, des Nachfolgens und auch des Befolgens, was mitunter auch einmal in Gehorsam enden kann, jedoch nicht primär Gehorsam bedeutet. Zudem rückt das Wort »bedingungslos« die Gefolgschaft sehr weit vom Begriff der modernen Followership weg, die, wie wir noch sehen werden, ethisches und moralisches Verhalten als expliziten Bestandteil ihres Selbstverständnisses sieht und daher für bedingungsloses Verhalten keinen Platz lässt. Auch wenn man den Begriff der Treue mit dem im Zusammenhang von Followership durchaus bedeutsamen Wort »Loyalität« umschreibt, gibt moderne Followership die Übersetzung mit Gefolgschaft in oben genannter Bedeutung von »Gehorsam und unbedingter Treue« letztlich nicht her. Loyal bedeutet laut Duden »eine Instanz respektierend«, »vertragstreu, redlich« und »anständig«.7 Doch dies kann nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht mit »Gehorsam und unbedingter Treue« gleichgesetzt werden, auch wenn eine loyale Anhängerschaft, die für eine Person oder eine Sache eintritt, als Gefolgschaft bezeichnet werden mag. Auch wenn in einem gewissen Zusammenhang diese »loyale Anhängerschaft« als Bedeutung für Gefolgschaft verstanden wird, so haften dem Begriff der Gefolgschaft doch nicht selten ein gewisser Makel und ein negativer Beigeschmack an. Man bringt damit Inhalte wie Meinungs- und Machtlosigkeit in Verbindung, sodass Gefolgschaft auch mit einer Masse willen- und ambitionsloser Menschen in Zusammenhang gebracht werden kann, die mangels Alternativen dem Anführer blindlings folgen, auch wenn ihnen dies nicht immer Spaß bereitet. Im großen Kontext lassen sich damit auch die Massen in Verbindung bringen, die einer Sache, einer Meinung oder einer gewissen Führungselite einfach hinterherlaufen, weil es eben alle machen. Dieser Makel haftet ganz allgemein vielen Begriffen an, die entweder wirklich jene scheinbar willen- oder meinungslosen Menschen beschreiben, die nur der Masse hinterherrennen, oder die tatsächlich in voller Absicht und mit Verstand, Ambition und Überzeugung einer Führungskraft oder einer Institution nachfolgen und sich in diesem Sinne als bekennende Follower und nicht als Leader oder Anführer verstehen: »Einfache« Mitarbeiter (d.h. solche ohne Führungsaufgaben), Erfüllungsgehilfen, Mitläufer, Getreue, Diener, Jünger, Assistenten, »Untergebene«, »Unterstellte« etc. Die in Anführungszeichen gesetzten Begriffe finden sich leider auch im Jahre 2024 noch in vielen Unternehmen im täglichen Sprachgebrauch wieder. Diese sind meiner persönlichen [13]Meinung nach schon seit vielen Jahren nicht mehr zeitgemäß und lassen nach modernem Verständnis von Sprache und Zusammenarbeit in Unternehmen zu viel Raum für ein abwertendes Verständnis hinsichtlich arbeitender Menschen. Dementsprechend sind Begriffe wie Follower (nicht im Zusammenhang sozialer Netze), Followership, Mitarbeiter ohne Führungsaufgaben oder Mitarbeiter ganz allgemein unter dem Schatten der »Gefolgschaft« je nach Begriff mehr oder weniger negativ konnotiert. Ganz anders sieht dies hinsichtlich der Begriffe Führungskraft, Leiter, Vorsitzender, Leader oder Boss/Chef aus. Auch wenn dieser Gruppe nicht selten gewisse negative Attribute zugeschrieben werden, so genießen sie doch überwiegend noch höheres Ansehen als beispielsweise »einfache« Mitarbeiter oder Mitglieder (eines Vereins oder einer Gesellschaft beispielsweise). Dies werden wir später noch etwas näher betrachten.
Im englischen Sprachraum bestehen die zuvor erklärten Übersetzungs- und Begriffsprobleme nicht. Dennoch werden dort die Begriffe Follower und Followership häufig auch negativ konnotiert. Sie haben durchaus auch den zuvor beschriebenen Beigeschmack von Schwachheit, Unterlegenheit oder willenlosen Mitläufertums. Dies gilt auch noch häufig im Zusammenhang mit Unternehmen, in dem der Begriff Follower im Vergleich zu den anderen Lebensbereichen des Menschen öfter und noch einmal stärker zugespitzt verwendet wird. Auch wenn sich dieses Verständnis seit vielen Jahren verändert, hat Followership im Bereich der Wirtschaft nicht den gleichen Stellenwert wie Leadership. Das lässt sich ganz einfach an der Zahl von Business Schools, Studiengängen, Weiterbildungen oder Abschlüssen ablesen, die es hinsichtlich Leadership und allen damit in Verbindung stehenden Begriffen wie Management oder Manager, Leader, Head of etc. gibt. Kurse für Followership sind Mangelware, sowohl im englischen wie im deutschen Sprachraum. Sowohl in den USA als auch in Europa oder in anderen Teilen der Welt. Dabei ist Followership, wie wir noch sehen werden, definitiv eine Kompetenz, die man erlernen kann und für das professionelle Arbeiten im agilen Zeitalter auch erlernen soll. Dennoch spielt sie bislang in den Wirtschaftswissenschaften nur eine untergeordnete Rolle. In den USA ist das Thema Followership vor gut 35 Jahren erstmals explizit aufgegriffen worden. In seinem Artikel »In Praise of Followers« aus dem Jahre 1988 spricht Robert Kelley, Professor an der Carnegie Mellon University, davon, dass »Organisationen teilweise damit stehen und fallen, wie gut ihre Führungspersönlichkeiten führen, aber auch damit, wie gut ihre Gefolgsleute folgen«.8 Seitdem ist sehr viel Forschungsarbeit in das Thema Followership investiert worden. Dennoch findet es wie erwähnt noch immer nicht den Raum in den Wirtschaftswissenschaften, den es verdient. Sogar in den USA, die bei den Wirtschaftswissenschaften als global führend angesehen werden und die überwiegende Zahl der Nobelpreisträger für Wirtschaft aufweisen, gibt es in vielen Bibliotheken zwar explizite Kategorien zu den Themen Führung, Leadership und Management, jedoch nahezu keine zum Thema Followership, und die verfügbaren Bücher und Artikel reihen sich bis heute meist irgendwo in den zuvor genannten [14]Kategorien ein.9 Das liegt vielleicht daran, dass auch im englischen Sprachraum wie erwähnt der Begriff der Followership wie im Rest der Welt noch immer einen gewissen negativen Touch hat. Dass dies vor mehr als 30 Jahren definitiv der Fall war, zeigt das Buch »The Power of Followership« von Kelley aus dem Jahr 1992, in dem der Autor aus der Anfangszeit seiner Followership-Forschung berichtet. Angesprochen auf die Inhalte seiner Arbeit erhielt er auf die Aussage, dass er sich mit Followership beschäftige, mehrmals folgende sinngemäße Aussage: »Oh, Sie meinen die Leute, denen man sagen muss, was sie zu tun haben? Die Schafe?«10 Auch im englischen Sprachraum verband man mit dem Begriff »Follower« im Kontext von Mitarbeitern in Unternehmen viele Jahre Bilder von Fügsamkeit, Konformität, Schwäche und mangelnder Leistung,11 und dieser Umstand besteht trotz vieler Umwälzungen und Verbesserungen zum Teil auch heute noch. »Lead, don’t follow«, so lautet der Slogan eines Anbieters von Reitsportzubehör im deutschen Sprachraum. Hier drückt sich in einem völlig anderen Kontext genau dieselbe Konnotation des Begriffs »Follower« aus wie in den Sätzen vorher. Und er drückt auch das aus, was zuvor bereits angesprochen wurde: Sobald von Leadern, Chefs oder Führungskräften die Rede ist, wird mit diesen Personen Stärke, Tatkraft und Ansehen in Verbindung gebracht. »Unabhängig davon, ob ihr Fachgebiet Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Kunst ist, stehen Führungspersönlichkeiten im Mittelpunkt des Geschehens, die beneideten, wenn nicht sogar beneidenswerten Stars, deren Leben etwas heller zu brennen scheint als unseres«, wie es Warren Bennis, einer der renommiertesten US-Gelehrten zu den Themen Organisationsentwicklung, Führungstheorie und Change Management im Zuge der Diskussion um Followership einst ausdrückte.12 Mit der Übernahme einer Führungsaufgabe ist meist ein gewisses Prestige verbunden. Man hat etwas erreicht, man hat es geschafft. Dies hat mit der Kultur zu tun, die über Jahrzehnte in großen Teilen von Gesellschaft und Wirtschaft präsent war. Amtsträger haben eine gewisse »Würde«, die sie nicht selten mit gewissen Utensilien zur Schau stellen, wie etwa Amtskette oder einem prächtigen Büro, völlig unabhängig davon, ob sie persönlich der mit dem Amt verbundenen Verantwortung gewachsen sind oder nicht. Von dieser Würde, welche diverse Ämter (z.B. das Richteramt) und Positionen (z.B. Bürgermeister) definitiv verdienen, geht jedoch häufig ein gewisses Ansehen auf die die Ämter ausfüllenden Personen über, unabhängig davon, ob sie ihr Amt gut oder schlecht ausfüllen. Ein ähnliches Denken hat sich viele Jahrzehnte in Wirtschaft und Unternehmen etabliert, bei dem das Ansehen der Person mit ihrer Stellung in [15]der Hierarchie direkt in Verbindung gebracht wurde. Auch hier hat sich diese automatische Verbindung von hohem Ansehen mit der jeweiligen Position im Denken der Menschen etabliert, sogar wenn die Personen ihre Positionen vielleicht sehr schlecht ausfüllen. Das verwundert nicht, denn jede verantwortungsvolle Position ist meistens mit einer gewissen Fülle an Macht ausgestattet, wenn auch je nach Position in der Hierarchie mal mit mehr, mal mit weniger. Macht verschafft aber Anerkennung und Prestige.13 Dementsprechend fällt diesen Personen ein gewisses Ansehen zu, das von der Position und nicht von ihnen selbst ausgeht. Aus einer gewissen Position in der Hierarchie resultiert somit auch eine entsprechende Fülle an Ansehen. Mit diesem hierarchisch geprägten Denken sind viele Generationen persönlich und beruflich sozialisiert werden, was in den letzten Jahren bei zahlreichen Unternehmen große Probleme beim Einstieg ins digitale und agile Zeitalter verursacht hat. Hierzu später mehr. Durch dieses hierarchische Denken war der Fokus in vielen Unternehmen lange Zeit überwiegend auf Führungskräfte und weniger auf »einfache« Mitarbeiter gerichtet. Wer »etwas werden« wollte, sprich wer Karriere machen, d.h. seine berufliche Verantwortung und sein Einkommen erhöhen wollte, musste »aufsteigen«. Dieses Aufsteigen gibt bildhaft das Hochklettern in der Hierarchie wieder, das oft mit dem geflügelten Wort des »Hochkletterns auf der Karriereleiter« umschrieben wird. Damit wird auch automatisch höheres Ansehen in Verbindung gebracht. Wer hingegen »unten« bleibt, hat häufig nur geringes Ansehen. Denn wie zuvor die »höheren Positionen« mit entsprechender Macht ausgestattet sind, ist es bei den »niedrigeren Positionen« meist genau andersherum. Daher wird diesen Positionen meist auch weniger Ansehen zugebilligt. Über Macht zu verfügen, stärkt das Selbstwertgefühl und ruft positive Emotionen hervor.14 Im umgekehrten Fall verhält es sich erneut andersherum.15 Keine oder geringe Macht gepaart mit wenig Ansehen auf den »unteren Rängen«: Es ist wenig verwunderlich, dass solche Positionen trotz ihrer hohen Bedeutung für die jeweilige Institution oft nur wenig attraktiv sind und Menschen aufsteigen wollen. Wer hingegen als Fachexperte ebenso seine berufliche Verantwortung und sein Einkommen zu erhöhen versucht, jedoch keine Führungsposition einnimmt und somit keinen bildhaften Aufstieg im Organigramm vornimmt, macht zwar für sich selbst Karriere. Das Ansehen bleibt in vielen Fällen jedoch aus, obwohl solche Fachexperten für Unternehmen oft wesentlich unentbehrlicher sind als Führungskräfte. Denn deren Führungsexpertise ist in Unternehmen viel häufiger anzutreffen, sodass sie häufig einfacher auszutauschen sind. Ich kenne mehrere Großunternehmen, in denen Versuche, derartige Fachkarrieren zu etablieren, damit leistungsfähige Mitarbeiter nicht nur auf Führungskarrieren schie[16]len sollten, gescheitert sind. Dies lag in allen mir bekannten Fällen schlichtweg daran, dass Ansehen und Dotierung der Fachpositionen nicht mit der jeweiligen Bedeutung für das Unternehmen in Einklang gebracht werden konnten. In vielen Fällen ist es auch heute noch so, dass eben nur eine Führungskraft hohes Ansehen genießt, und das Maß des Ansehens oft auch noch mit der Anzahl geführter Mitarbeiter steigt. Andere Faktoren bleiben dabei oft außen vor.
Bei einer solchen Fokussierung auf Führungskräfte überrascht es wenig, dass Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens, einer Abteilung, einer Arbeitsgruppe, eines Vereins oder einer Fußballmannschaft sehr häufig zuerst und hauptsächlich mit der jeweils zuständigen Führungskraft in Verbindung gebracht werden. Gewinnt die Fußballmannschaft, wird sie gefeiert, der Trainer wird jedoch meist als Vater des Erfolges geehrt. Verliert die Mannschaft oder steigt sie ab, steht primär der Trainer im Kreuzfeuer. Konsequenzen für Spieler folgen in solchen Fällen kaum. So auch das typische Bild in vielen Unternehmen. Feiert das Unternehmen Erfolge, steht meist der oberste Manager im Rampenlicht. Ähnlich, wenn einzelne Abteilungen oder Sparten Erfolge feiern. Meist rückt der Anführer dieser Gruppen in den Fokus des Lobes, obwohl er ohne die Mitarbeiter den Erfolg nicht hätte erzielen können. »Am Ende des Tages hat die Führungsrolle den Glamour und die Aufmerksamkeit«, schrieb Kelley 1988 zu Beginn seiner Forschungsarbeiten zum Thema Followership.16 Seither hat sich zwar diesbezüglich einiges getan und in den geschätzt zurückliegenden 20 Jahren hat sich dieses Verständnis spürbar gewandelt. Mehr und mehr Chefs weisen im Erfolgsfall auf ihre Teams und deren entscheidende Beiträge zum Erfolg hin. Dennoch sind sie es, die nach wie vor überwiegend im Rampenlicht stehen. Die breite Etablierung agiler Ansätze seit Ende der 2010er-Jahre hat der Würdigung der Teamleistung noch einmal stärkeren Schub verliehen. Doch es bleibt dabei: Führungskräfte stehen deutlicher im Rampenlicht als Mitarbeiter des Teams. Auch im Jahr 2024 gibt es nach wie vor unzählige Aus- und Fortbildungen für Führungskräfte, Bücher, Artikel, Fortbildungsinstitute etc. Natürlich gibt es auch Fortbildungen, wie man ein guter Teamplayer wird oder in agilen Organisationen arbeitet. Doch einen Fokus auf gute Followership und darauf, welch entscheidenden Anteil am Erfolg diese hat, gibt es nicht oder kaum.
Die im vorherigen Abschnitt gemachte Einschätzung lässt sich insofern nachvollziehen, wenn man die Wirtschaftsteile einschlägiger Zeitungen und Medien im Zeitraum zwischen 2020 und 2023 durchforstet. Besonders während der Pandemie, aber auch jenseits der großen Herausforderungen dieser Zeit schienen sich die einzelnen Redaktionen darin übertrumpfen zu wollen, über die schlechten Leistungen von Chefs und Führungskräften zu berichten. Toxische Chefs, toxische Leader, Führungskräfte, die nichts dazu gelernt hätten etc. Das waren und sind auch heute noch Schlagwörter und Begriffe, die regelmäßig fallen. Es sind auch viele Bücher dazu erschienen, die anhand zahlreicher Beispiele aufzeigen, wie mangelhaft die Führungskräfte in deutschen Unternehmen zu agieren scheinen, und dass es kaum richtige Besetzungen der Chefetagen für die neue Zeit von New Work gibt. Ich [17]möchte dies hier gar nicht mit einzelnen Beispielen aus Online-Artikeln oder Büchern belegen. Der geneigte Leser kann sich selbst davon überzeugen. Er muss nur mit den passenden Suchbegriffen nach diesbezüglichen Online-Artikeln oder Büchern suchen. Darin werden die unfähigen, selbstherrlichen, narzisstischen, toxischen und weiteren Chefs für nahezu alle Fehlentwicklungen verantwortlich gemacht, die seit dem Beginn des neuen Jahrzehntes in vielen Unternehmen entstanden sind: Personalmangel, stark zunehmende Zahl von Krankschreibungen aufgrund psychischer Belastungen, hohe Anzahl von Burnouts, Kündigungen ohne Alternativjobs, Mangel an Nachwuchs von Fachkräften und Naturwissenschaftlern, schlechte Allgemeinstimmung in der Wirtschaft, Zurückfallen der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich und vieles mehr. An fast allem seien, ausgedrückt in einer im deutschen Sprachgebrauch sehr beliebten Formulierung, die Chefs und Führungskräfte »schuld«. Mitarbeiter, Teammitglieder, Follower, oder wie man auch immer die Mitarbeiter jener argen Führungskräfte bezeichnen mag, scheinen demnach an der Verantwortung für die erwähnten Entwicklungen annähernd keinen Anteil zu haben. Diese scheinbare Schuldzuschreibung an die Chefs und der Freispruch für die Mitarbeiter wird zumindest etwas verständlich, wenn man sich das in den vorherigen Abschnitten beschriebene Mindset vergegenwärtigt. Es sind die Chefs, die für alles verantwortlich gemacht werden, und nicht die Mitarbeiter. Auch wenn zunehmend gefordert wird, dass der Anteil der Mitarbeiter am Erfolg stärker hervorgehoben werden muss, was meines Erachtens absolut richtig ist. Nur am Misserfolg und an schlechten Entwicklungen scheint man die Mitarbeiter dann nicht beteiligen zu wollen. Hier scheinen einzig und allein die Chefs die Verantwortung zu haben. Und genau dies ist eine für die Zukunft vieler Unternehmen gefährliche Entwicklung. So wie Chefs und Führungskräfte nicht allein für den Erfolg verantwortlich gemacht werden können, so können sie auch nicht allein für Misserfolge verantwortlich sein. Daran haben die Mitarbeiter genauso ihren Anteil. Denn, wie wir noch sehen werden, kann durch schlechte Followership auch die beste Führungskraft nur mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Durch dieses Verdrängen der Mitverantwortung der Mitarbeiter an Misserfolgen und schlechten Entwicklungen rückt das Thema Leadership bzw. Führung wiederum stärker in den Mittelpunkt und die Bedeutung der Followership gerät wieder ins Abseits. Man kann diese Verdrängung verstehen, denn niemand möchte gern die Rückmeldung bekommen, dass er am Misserfolg einen persönlichen Anteil hat. Followership ist nicht beliebt, weil sie mit den oben beschriebenen negativen Konnotationen belegt ist. Sie wird aber auch dramatisch unterschätzt, weil eben nicht stark genug herausgestellt wird, welch großen Anteil sie am Erfolg und am Misserfolg in Unternehmen hat. Denn ohne Follower kann keine Führungskraft etwas ausrichten. Followership und Leadership sind untrennbar miteinander verbunden. Dies werden wir im nächsten Kapitel genauer betrachten.
Über die zuvor dargestellten Zusammenhänge hinaus gibt es noch einige weitere erwähnenswerte Punkte, die erklären, weshalb Followership vor allem in Unternehmen bislang unterschätzt und unterbewertet wird. Diese sind aus meiner mehr als 37-jährigen Erfahrung u.a.:
[18]Konzept und Inhalte der Followership und ihr Zusammenhang mit Führung und Leadership sind häufig unbekannt oder nicht hinreichend klar. Dementsprechend fällt es vielen schwer, deren Bedeutung einzuschätzen.
Das Konzept der Followership ist wie im vorherigen Abschnitt erwähnt bislang nur sehr gering verbreitet. In den USA 1988 durch Kelley erstmals wissenschaftlich aufgegriffen, hat es sich auch nach mehr als 35 Jahren noch nicht auf breiter Ebene etabliert. Dementsprechend gering sind die Möglichkeiten der Wissensvermittlung.
Followership ist zwar eine Kompetenz,17 die Fähigkeiten erfordert und daher auch erlernt werden muss.18 Jedoch findet man sie in den breit etablierten Kompetenzmodellen nicht, auch wenn dort Kompetenzen wie Kooperation oder Engagement genannt sind.19 Auch das nicht unumstrittene, aber sehr umfangreiche Kompetenzmodell »KODE« von Heyse und Erpenbeck führt Followership nicht explizit auf. KODE enthält zwar die für Followership wichtigen Themen Loyalität und Eigenverantwortung, und naturgemäß wie die meisten Kompetenzmodelle auch Führungskompetenz.20 Follower-Kompetenz ist darin jedoch ebenfalls nicht explizit enthalten.
Bei einem großen Teil der (mir bekannten) Personen, die um die Notwendigkeit der Followership wissen und einige Inhalte davon kennen, herrscht die Meinung vor, dass Followership keine Kompetenz sei, die explizit erlernt werden müsse. Das gehe doch, so der Tenor, »wie die Hausarbeit nebenbei«.
Followership hat im Zusammenhang mit dem eingangs beschriebenen Verständnis von Gefolgschaft nicht nur etwas wenig Glamouröses an sich. Dem Begriff haftet nicht selten auch etwas Minderwertiges, Unterwürfiges an, was noch nie gerne gesehen war (z.B. Begriffe wie Ja-Sager, Duckmäuser, Kriecher etc.). Dies hat sich im Zuge der Agilisierung zwar verbessert, ist jedoch noch weit von der realen Notwendigkeit entfernt.
Das praktizierte Führungsverständnis ist wie lange Zeit üblich bis heute noch häufig stark führungszentriert. Ein Großteil der Belegschaft vieler Unternehmen ist in einer hierarchischen Welt sozialisiert worden. Die ging von einer starken Führung aus, bei der der Löwenanteil der Verantwortung und der Handlungsimpulse lag, und die Follower nur wenig Verantwortung hatten. Spätestens mit [19]Beginn der Digitalisierung in den 2010er Jahren hat sich dies gewandelt, initiiert durch den digitalen Wandel und Industrie 4.0, gefördert durch New Work und den großflächigen Eintritt der Gen Z ins Arbeitsleben Anfang der 2020er. Dennoch besteht noch viel Nachholbedarf, das Thema Followership im Führungsverständnis angemessen zu verankern. Dies lässt sich fördern, wenn man den eigenen Führungsansatz einmal auf den Kopf stellt, dabei das Thema Followership ins Zentrum rückt und die Führungsaktivitäten vom Follower aus betrachtet.21
Bislang war immer die Rede von Führung, Führungskräften, Leadern, Chefs, Bossen etc. Diese wurden mehr oder weniger ohne weitere Differenzierung synonym benutzt. Das war bislang in Ordnung, weil zunächst nur die beiden Pole Leadership vs. Followership gegenübergestellt werden sollten. Wenn wir uns jedoch in den folgenden Kapiteln wie beschrieben mehr und mehr dem Thema »Followership in Unternehmen« annähern wollen, so ist es opportun, diese sprachliche Verallgemeinerung zu präzisieren. Dadurch lässt sich die weitere inhaltliche Betrachtung so fokussieren, dass keine Konfusion hinsichtlich der verwendeten Begriffe mehr besteht, sondern nur inhaltliche Themen eine Rolle spielen. Daher sind die zuvor verwendeten und einige weitere in diesem Kontext häufig vorkommenden Begriffe im Anhang am Ende des Buches in jener Weise erklärt, wie sie für den Kontext des Buches verstanden und verwendet werden sollten. Einheitliche Definitionen dieser Begriffe gibt es nicht, weshalb sie eben hier mit unserem eigenen Verständnis belegt werden. Ein einfaches Beispiel ist das Wort »Chef«. Umgangssprachlich wird dies im deutschen Sprachraum zum einen sehr häufig mit der direkten Führungskraft in einem Unternehmen oder einer Institution, also auch einem Amt, gleichgesetzt. Zum anderen wird mit dem Begriff häufig auch direkt die oberste Leitungsperson eines Unternehmens damit verbunden, und nicht die direkte Führungsperson (sofern diese nicht gerade die direkte Führungsperson ist). Im englischen Sprachraum wird unter einem »Chef« hingegen eher ein »Küchenchef« verstanden, auch wenn sich das zuvor beschriebene Verständnis dort auch immer wieder findet. Dadurch kommt es nicht selten vor, dass es im internationalen Kontext diesbezüglich zu Konfusionen kommt. Schon allein dies zeigt die Notwendigkeit der sprachlichen Regelung. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist in diesem Zusammenhang ist das Duo Manager und Leader. Auch darauf wird im Anhang des Buches nach der Definition der verwendeten Begriffe eingegangen.
Die im Anhang beschriebenen Begriffe geben das Verständnis wieder, mit dem sie in diesem Buch gebraucht werden. In einem anderen Zusammenhang können diese Begriffe durchaus anders belegt sein, sodass man etwas anderes darunter verstehen kann. Da dieses Buch jedoch das Thema Followership und nicht irgendwelche Management- oder Organisationsthemen zum Fokus hat, werden einzelne [20]Begriffe teilweise wenig trennscharf und auf einer höheren Abstraktionsebene austauschbar und gleichwertig verwendet, wohl wissentlich, dass sie eben in anderen Kontexten zu trennen sind. Dies dient schlichtweg der Vereinfachung sowie dem Zweck der besseren Lesbarkeit. So müssen nicht einzelne Begriffe ständig wiederholt werden, sondern können dem angenehmeren Lesen dienend auch durch andere ersetzt werden. Ich bitte den Leser hier um Verständnis. Inhaltlich geht dadurch bezüglich des Textes nichts verloren. An jenen Stellen, an denen eine genaue Beschreibung notwendig ist, findet die Begriffsfokussierung jeweils explizit statt. Wer an dieser Stelle gerne mit den Inhalten fortsetzen möchte, kann die erwähnten Begriffsfestlegungen im Anhang auch überspringen und mit den weiteren Kapiteln fortfahren. Die Begriffe können bei Bedarf auch im Anhang nachgeschlagen werden. Es ist jedoch dem schnellen Verständnis im Text förderlich, erst die Bedeutungen der Begriffe zu kennen, bevor man sich an deren Anwendung im Text macht. Dann gibt es auch kaum eine Möglichkeit der Konfusion oder Doppeldeutigkeit, die ein Begriff auch einmal haben kann. Es ist verständlich, dass ein anfängliches Durcharbeiten von Begriffsfestlegungen dröge sein kann. Daher sollte jeder Leser für sich entscheiden, wie er weiter vorgeht.
1.2Die enge Verbindung von Leadership und Followership
Nach der etwas allgemeinen Annäherung an das Thema Followership ist es jetzt opportun, die Beziehung zwischen Leadern und Followern näher zu betrachten. Dabei müssen wir an dieser Stelle bereits eine wichtige Unterscheidung treffen. Wir müssen unterscheiden zwischen Leadern, denen wir freiwillig folgen, und solchen, denen wir in einer gewissen Weise folgen müssen. Freiwillig folgen wir beispielsweise Vorbildern, von denen wir uns leiten lassen. In vielen Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die großartige Arbeit leisten und eine tolle Karriere gemacht haben. Lassen sich andere Mitarbeiter von deren Verhalten leiten, so sind sie in einer gewissen Weise deren Follower. Hier handelt es sich um eine freiwillige Followership, denn die Mitarbeiter müssten es ja nicht tun. Anders verhält sich die Sache, wenn es sich um eine weisungsbefugte Führungskraft handelt. Deren Bitten und Anweisungen, ihrem Verhalten und ihrer Leadership müssen die Mitarbeiter eine gewisse Followership zeigen, weil sie sich durch ihren Arbeitsvertrag dazu verpflichtet haben. Dieser Umstand schafft zwei verschiedene Arten von Followership: Der freiwilligen, und der quasi freiwilligen. Quasi freiwillig nur deshalb, weil der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen kann, wenn er sich aus irgendwelchen Gründen nicht dauerhaft an die Leadership der Führungskraft halten will. Daneben gibt es eine dritte Kategorie der Followership: Die unfreiwillige. Hier ist man dazu gezwungen, in einem gewissen Rahmen Followership zu zeigen, wenn man für sich selbst ernsthafte Konsequenzen vermeiden möchte. Ein Beispiel hierzu sind Anordnungen staatlicher Stellen und Behörden, denen man zur Vermeidung rechtlicher Konsequenzen folgen muss. Hier handelt es sich also mehr um ein Befolgen als um ein Nachfolgen.
[21]Bisher haben wir im Kontext von Followership immer auch von Leadership gesprochen. Diese beiden Punkte sind untrennbar miteinander verbunden. Zunächst stellt sich dabei vielleicht die Frage, weshalb es denn überhaupt Leadership geben muss. Wir haben ja festgestellt, dass es ohne Leadership keine Followership geben kann. Wenn es aber keine Leadership gibt, dann müsste es auch keine Followership geben. Daher ist es opportun und legitim, zunächst die Frage nach der Notwendigkeit von Leadership zu beantworten. Dies hilft dabei, die Notwendigkeit guter Followership zu verstehen.
Zur zielgerichteten und sinnvollen Gestaltung seines Lebens benötigt der Mensch einen stabilen Handlungsrahmen, in dem eine verlässliche Ordnung herrscht.22 Diesen bildet in erster Linie der Staat mit seinen Gesetzen und Institutionen, der für ein geordnetes Miteinander der Menschen ohne ein Recht des Stärkeren sorgt. Die Ordnung stellt der Staat vor allem durch seine Verfügungsmacht sicher.23 Auch in anderen Bereichen menschlichen Zusammenlebens, z.B. Familie, Kirchen oder Vereinen, ist für die Ordnung Macht notwendig. Es gibt kein funktionierendes Sozialgebilde, das ohne eine differenzierende Zuweisung von Macht auf Dauer lebensfähig wäre.24 In Anlehnung an die österreichische Macht-Autorin Christine Bauer-Jelinek legen wir daher sog. »Machtschauplätze« fest: Staat, Gesellschaft, Familie, Wirtschaft.25 Jeder dieser Schauplätze hat seine eigenen Spielregeln und Wertesysteme und die verschiedenen Machtinstrumente (z.B. Belohnung, Bestrafung, Lob, Tadel etc.) zeigen darin jeweils unterschiedliche Wirkungen. In diesen Machtschauplätzen bilden sich unterschiedliche Machtsysteme aus, die den erwähnten Handlungsrahmen schaffen. Menschen benötigen darin zur Bewältigung und Gestaltung ihres Lebens ebenfalls Macht. Damit aber die Gestaltung der Lebensumwelt durch Einzelne nicht zu Lasten anderer oder des Gemeinwohls geht, muss es Grenzen, d.h. den Ordnungsrahmen geben. Zur Stabilität solcher Strukturen ist Macht unverzichtbar.
Die Ausübung von Macht beinhaltet das Treffen und Umsetzen von Entscheidungen. Das bedeutet letztendlich Führung, denn Führung ist das praktizierte Ausüben von Macht. Dementsprechend befinden sich Macht ausübende Personen automatisch in einer Führungsrolle und sind somit Leader. Überall, wo Macht ausgeübt wird, gibt es daher Leadership. Wer Macht hat und diese ausübt, muss die Verantwortung für die daraus resultierenden Konsequenzen übernehmen. [22]Denn Macht und Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. Dies gilt in allen Schauplätzen der Macht. Dasselbe gilt für Macht und das Treffen von Entscheidungen.26 Sobald Entscheidungen getroffen und wirksam umgesetzt werden, ist Macht im Spiel. Dementsprechend agieren Menschen, die Entscheidungen mit für andere Personen wirksamen Konsequenzen treffen, als Leader. Ohne Leadership fallen somit Gesellschaft und Institutionen auseinander,27 denn dies würde u.a. das Fehlen der nötigen Ausübung von Macht bedeuten.
Wie zuvor erwähnt unterscheiden sich die Machtsysteme und die verschiedenen Ausprägungen der Machtausübung in den verschiedenen Machtschauplätzen. So wie sich dort folglich auch die praktizierte Leadership unterscheidet, so unterscheiden sich auch die jeweiligen Formen der Followership. Wenn wir auf die in Kapitel 1.1 aufgelisteten Begriffe der Übersetzungen von »to follow« beziehungsweise die verschiedenen Bedeutungen des Wortes »folgen« blicken, so stellt man fest, dass sich die Followership im Staat mehr in der Bedeutung von »befolgen«, »beachten«, »einhalten« oder »bei etwas mitmachen« gestaltet. Auch wenn in Unternehmen Followership in der Bedeutung von »befolgen«, »beachten« und auch »gehorchen« auftritt, so kommt es im Vergleich zum Staat hier wesentlich häufiger vor, dass Followership im Verständnis von »nachfolgen«, »sich anschließen«, »sich nach etwas richten«, »in der gleichen oder ähnlichen Weise wie jemand handeln«, oder »sich von etwas leiten lassen« gestaltet ist. In Familien gibt es auch Followership im Sinne von »gehorchen« und »befolgen«, aber auch sehr häufig im Sinne von »sich anhängen«, »sich anlehnen«, »sich nach jemandem richten« oder »sich jemandem anschließen«. Im gesellschaftlichen Leben wird Followership wesentlich weniger unter dem Gesichtspunkt des Gehorchens oder Befolgens gelebt und mehr in der Bedeutung von »beachten« und »einhalten« (der gesellschaftlichen Normen und Regeln), bzw. im Sinne von »in der gleichen Weise oder ähnlich handeln wie«. Was sich letztendlich als jeweils akzeptable Followership in den einzelnen Schauplätzen etabliert, hängt häufig von der Historie und der jeweiligen Kultur ab. Stand in vielen Unternehmen für lange Zeit Pflichterfüllung als Ausprägung der Followership im Zuge eines vorherrschenden Führungsverständnisses von Befehl und Gehorsam hoch im Kurs, so ist dies seit vielen Jahren durch einen geänderten Führungsansatz einem anderen Follower-Verständnis gewichen. Daran zeigt sich wiederum, wie eng Leadership und Followership verbunden sind.
In den vorherigen Abschnitten haben wir gesehen, dass überall, wo Macht ausgeübt wird, Führung und dementsprechend Leadership stattfindet. Wer Macht ausübt, ist ein Leader. Dies gilt aber auch umgekehrt, denn wer als Leader agiert, der benötigt Macht. Ohne Macht können Leader und Manager nicht wirksam [23]sein.28 Macht ist daher auch im agilen Zeitalter für das Funktionieren und die langfristige Existenz eines Unternehmens unverzichtbar. Unternehmen hören auf zu existieren, wenn es darin keine Macht mehr gibt und dadurch keine Entscheidungen mehr getroffen werden. Ein machtfreies Unternehmen ist aus systemtheoretischer Betrachtung nicht lebensfähig.29 Daher kann es kein Unternehmen ohne Leadership geben. Da aber Leadership nicht nur ohne Followership nicht funktionieren kann, sondern bei unzureichender Followership auch zu suboptimalen Ergebnissen führt, ist gute, zeitgemäße Followership ein entscheidender Faktor für das Prosperieren von Unternehmen im agilen Zeitalter. Ohne den nachfolgenden Kapiteln vorzugreifen, sei bereits an dieser Stelle angemerkt, dass Selbstorganisation keinen machtfreien Raum bedeutet.30 Selbstgesteuerte Teams sind nicht machtfrei und auch in agilen Teams wird es zukünftig Leadership und Followership geben müssen.
Zum besseren Verständnis der engen Verbindung zwischen Leadership und Followership in der Praxis soll ein kurzes gedankliches Experiment dienen. Stellen wir uns einen Staat vor, in dem es nur Parlamentarier, Regierungsmitglieder und deren Vollzugsbeamte sowie Verantwortliche der Justiz gäbe. Es gebe aber in diesem Staat kein Volk. Die Staatsorgane könnten somit Gesetze erlassen, umsetzen sowie deren Einhaltung verfolgen und ahnden, jedoch hätten sie kein Volk, welches die Gesetze zu beachten hätte. Der Staat wäre dann nur Selbstzweck und würde keinen Sinn machen. Nehmen wir einen anderen Staat an, der zwar funktionierende Staatsorgane und ein funktionierendes Rechtssystem hat, dessen Volk sich aber nicht an Recht und Gesetze halten will. Das Ergebnis wäre die Anarchie. Ähnlich sähe es aus, wenn sich das Volk zwar an Gesetze halten würde, nicht jedoch an die Entscheidungen von Personen, die gerade im exekutiven Amt sind, d.h. die Leader. Dann wäre die Machtausübung dieser Personen, d.h. ihre Leadership, wirkungslos. Auch dieser Staat würde nicht funktionieren. Ähnlich verhält es sich in Unternehmen. Leader haben nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn es Follower gibt, die ihnen durch gelebte Followership folgen. Führungskräfte bzw. Leader sind nur dann wirksam, wenn sie Follower haben, die Followership zeigen. Dass Unternehmen Leadership brauchen, haben wir vorher festgestellt. Eine Vorstellung von Leadern ohne Follower ist wie eine Vorstellung von Lehrern ohne Schüler.31 Denn Leadership und Followership sind zwei Seiten derselben Medaille.32 Es gibt unzählige [24]Definitionen von Leadership, die teilweise sehr wenig gemein haben,33 und Leadership scheint eines der am wenigsten verstandenen Phänomene der Erde zu sein.34 Aber alle Ansätze von Leadership gehen davon aus, dass Leader auch Follower brauchen. Ohne Nacheiferer sind Vorbilder eben auch keine Vorbilder mehr.
Jenseits der vorherigen Erklärungen und der begrifflichen Dualismen lässt sich die untrennbare Verbindung von Leadership und Followership speziell in Unternehmen auch anhand mehrerer praktischer Notwendigkeiten verdeutlichen. Diese sind u.a.:
Führungskräfte sind nicht notwendig, wenn es niemanden gibt, den sie führen könnten oder der sich von ihnen führen ließe. Ihre Führungsarbeit wäre wirkungs- und damit sinnlos. Reines Selbstmanagement einzelner Personen ist nicht mit Leadership bzw. Führungsaufgaben zu verwechseln. Darum hat der große Management-Vordenker Peter Drucker bereits vor vielen Jahrzehnten klar und deutlich festgestellt: »Die einzige Definition eines Leaders ist jemand, der Follower hat«.35 Ein Leader ohne Follower kann bestenfalls sich selbst führen. Dies ist aber nicht als Leadership, sondern als Selbstmanagement geläufig.36
In Unternehmen sind es überwiegend die Follower, die den Großteil der geleisteten Arbeit verrichten. Für die mit der Arbeit erzielten Ergebnisse wird zwar der Leader zur Verantwortung gezogen. Die Arbeit machen aber die Follower.37 Hier muss man richtigstellen, dass dies nur für jene Leader oder nur für jenen Teil der Arbeit der Leader zutrifft, der sich auf die Leadership-Aufgabe bezieht. Gerade im Mittelstand haben Leader häufig eine Doppelfunktion, in der sie ihre Mitarbeiter führen und gleichzeitig wie diese operativ an den Ergebnissen arbeiten. Bei Aufgaben, die mehrere Personen oder ein Team erfordern, führt sich der Ansatz von Leadership ohne Followership aber sehr schnell ad absurdum, denn der Leader könnte die Aufgaben allein nicht bewältigen. Ohne Follower in Form seiner Armee hätte auch Napoleon schlicht nur seine Ideen und Ambitionen gehabt, er hätte davon aber nichts realisieren können.38
Betrachtet man den Leader nicht nur als Anführer eines Teams oder einer Gruppe, sondern auch in der viel zitierten Rolle eines Vorbildes, so macht diese [25]Rolle wie im vorherigen Absatz kurz erwähnt nur dann Sinn, wenn sich die Leute an ihm auch ein Vorbild nehmen. D.h. wenn sie in der Praxis seinem Tun, Handeln und Reden mit ihren eigenen Aktivitäten nachfolgen oder nacheifern. Diese Leadership-Rolle wird also nur dann zur Rolle, wenn es Follower gibt. Zugehörigkeit ist ein wichtiges und starkes Motiv menschlicher Handlungen, vor allem im Berufsleben. Zugehörig fühlt man sich u.a. dann, wenn man anderen ähnlich ist, weshalb Follower oft ihren Leadern nacheifern. Aber nur wenn sie das tun, ist der Leader in dieser Rolle auch ein Leader. Ohne Follower nicht.
Die Autorität eines Leaders hängt davon ab, ob Follower diese Autorität akzeptieren. Mächtige und somit Leader haben eine persönliche Autorität (Beeinflussungsnacht) und qua Position häufig auch eine sog. institutionelle Autorität (Verfügungsmacht). Kommen aber die einzelnen Personen den Führungsaktivitäten eines Leaders nicht nach, weil sie dessen Autorität nicht akzeptieren, so wird die Führung des Leaders wirkungslos und er ist kein Leader mehr. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Chester Barnard diese Grundlagen in seiner Akzeptanztheorie der Autorität formuliert.39 Damit Macht ausübende Personen über die nötige Autorität verfügen können, muss die Autorität erst einmal Akzeptanz finden. Demnach liegt die Entscheidung, ob die Anweisung eines Leaders Autorität hat oder nicht, nicht bei der Macht ausübenden Person, sondern beim Adressaten der Anweisung.40 Ohne hinreichende Akzeptanz durch die Follower verliert die Autorität ihre Wirksamkeit. Der Leader ist dann kein Leader mehr. Eine »Stand Alone Leadership« funktioniert also nicht.
Laut Kelley stammt das Wort »follow« aus dem althochdeutschen Wort »follaziohan«, welches seiner Beschreibung nach die Bedeutung von »helfen«, »beistehen« oder »kümmern« hatte.41 Laut Duden geht das Wort »vollziehen« auf das althochdeutsche Wort »follaziohan« zurück, und hat u.a. die Bedeutung von »in die Tat umsetzen«, »Anweisungen oder Erfordernisse erfüllen«.42 Demnach sind Follower diejenigen, die die Entscheidungen der Leader vollziehen, d.h. die Anweisungen oder Erfordernisse des Leaders verwirklichen und in die Tat umsetzen. Das passt zur zuvor unter Punkt 2 gemachten Erklärung, weshalb Leadership nicht ohne Followership funktionieren kann: Es sind überwiegend die Follower, die die Arbeit machen. Sie setzen um. Erst durch Followership passiert etwas. Solange durch die Follower nichts umgesetzt bzw. vollzogen wird, ist Leadership unwirksam.
[26]So unzertrennlich, wie Leadership und Followership sind, so eng verbunden ist auch das Ergebnis eines Teams damit, wie gut Leader und Follower jeweils ihre Aufgaben erfüllen. Eine schlechte Führungskraft kann mit seinem Team meist nur schlechte oder mittelmäßige Ergebnisse erzielen. Diese Erkenntnis hat sich im allgemeinen Verständnis etabliert. Dass aber schlechte Followership auch beim besten Leader zu schlechten oder nur mittelmäßigen Ergebnissen führt, ist in diesem Verständnis jedoch bislang kaum zu finden. Das Gesamtergebnis eines Teams hängt von der jeweiligen Leistung von Leadern und Followern und ihrem Zusammenspiel ab. So wie der beste Musiklehrer mit nur wenig begabten und lernunwilligen Schülern kein Spitzenorchester aufbauen kann, so gelingt auch einem Spitzenmanager kein Top-Ergebnis, wenn das Team nicht die entsprechende Followership-Leistung zeigt. Gute Followership hat entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis eines Teams. Dass es mittelmäßige oder schlechte Führungskräfte gibt, ist eine Tatsache. Manche von ihnen, so drückt es Kelley bildhaft aus, könnten nicht einmal ein Pferd ans Wasser führen.43 Aber viele Mitarbeiter, so Kelley weiter, könnten nicht einmal einer Parade folgen.44 Diese etwas überspitzte Formulierung macht es aber noch einmal klar: Nicht nur Führungskräfte bzw. Leader haben durch ihre Leadership entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis eines Teams, sondern auch dessen Mitglieder durch ihre Followership. Dementsprechend haben nicht nur die Leader Verantwortung für die Ergebnisse, sondern auch die Follower.
1.3Die Omnipräsenz von Followership: Jeder ist Follower und trägt Verantwortung
Für den Inhalt dieses Buches gilt die Konvention, dass Chefs, Manager, Vorstände, Anführer, Mächtige, Einflussnehmer, Führungskräfte etc. ganz allgemein als Leader bezeichnet werden, sofern sie auf Menschen dahingehend Einfluss nehmen, dass sie diese zu einer gewissen Handlung bewegen und/oder sie in eine gewisse Richtung leiten wollen. Das gilt nicht nur im Rahmen von Wirtschaftsunternehmen, sondern ganz allgemein überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten oder -wirken. Unter diesem Verständnis ist beispielsweise auch ein Polizist ein Leader, wenn er im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer zum Halten bewegt. Sein Amt und seine Persönlichkeit verleihen ihm diesbezüglich Macht, und durch entsprechende Handzeichen oder Gesten führt er die entsprechenden Handlungen des Autofahrers herbei. Sofern dieser die Autorität des Polizisten akzeptiert, kommt er dessen Einfluss auch nach und folgt den Anweisungen des Polizisten. Dies ist ein sehr einfaches Beispiel von Followership.
Situationen von Leadership und Followership gibt es aber auch in den anderen drei Machtschauplätzen Gesellschaft, Familie und Wirtschaft. In diesen laufen [27]Leadership und Followership jeweils unterschiedlich ab, da in diesen Machtschauplätzen wie erwähnt unterschiedliche Regeln und Wertevorstellungen gelten und weil in allen vier Machtschauplätzen Macht jeweils unterschiedlich ausgeübt wird. Die Ausgestaltung der Machtausübung und somit der Leadership in einem Machtschauplatz beeinflusst jedoch auch die Machtausübung in den anderen Machtschauplätzen. Denn bei den Menschen bildet sich ein gewisses Machtverständnis aus, das sie in allen Machtschauplätzen anwenden. Verändert sich daher die Machtausübung in einem der vier Schauplätze, so führt das dadurch veränderte Machtverständnis auch zu einer anderen Form der Machtausübung in den anderen drei Schauplätzen.45 Dasselbe geschieht mit der Akzeptanz von Macht und deren Ausübung, d.h. der Followership. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Followership in einem der vier Schauplätze gelebt und ausgeübt wird, zwangsläufig Einfluss auf die praktizierte Followership in den anderen Schauplätzen hat und umgekehrt. Die verschiedenen Formen der Followership beeinflussen sich also gegenseitig. Wenn wir daher Followership in Unternehmen als Teil des Machtschauplatzes Wirtschaft verstehen und gestalten wollen, so müssen wir uns zumindest rudimentär damit auseinandersetzen, was Followership in den anderen Machtschauplätzen bedeutet und wie sie sich dort häufig gestaltet.
Für den Schauplatz »Staat« haben wir zuvor bereits ein einfaches Beispiel gesehen. Followership bedeutet aber auch dort nicht nur ein reines Gehorchen und Akzeptieren aller Vorgehensweisen, Prozesse oder amtlichen Bescheide. Auch hier ist Followership kein reines Befolgen, wie beispielsweise die Schafe einfach dem Hirten folgen. Followership ist kein roboterartiges Schlucken und Befolgen von Befehlen ohne Abweichung von der Norm, egal wie eigenartig und unpassend die Norm sein mag.46 Im Machtschauplatz »Familie« wird ebenso regelmäßig Macht ausgeübt, wenn auch meistens auf deutlich andere Weise als im Schauplatz »Staat«. Im gegenseitigen Miteinander des Familienlebens üben die Eltern regelmäßig gegenseitig Beeinflussungsmacht aus und befinden sich somit laufend abwechselnd sowohl in der Rolle des Leaders als auch des Followers. Wegen der bestehenden Aufsichts- und Fürsorgepflicht haben Eltern gegenüber Kindern auch Weisungsrechte, die ihnen Macht verleihen. Dass ihre diesbezüglichen Entscheidungen aus der Leader-Rolle von den Followern, den Kindern, nicht immer nur konfliktfrei angenommen werden, ist eine allgegenwärtige Tatsache. Die Eltern sind aber je nach Familienverhältnissen nicht nur Leader, sondern gegebenenfalls auch Follower. Leben deren Eltern noch, besteht ein größerer Familienverbund, der sich gegenseitig unterstützt, oder besteht ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis zu den Geschwistern, das denen eine gewisse Macht über die betrachteten Eltern [28]verleiht, so sind diese eben auch Follower, sowohl als Familienmitglieder als auch als Staatsbürger. Da leuchtet schnell ein, dass Erfahrungen aus der einen Follower-Rolle nicht ohne Auswirkungen auf die andere bleiben werden. Das gilt auch für die zwei anderen Machtschauplätze »Wirtschaft« und »Gesellschaft«, sofern sich diese Personen auch in diesen Schauplätzen tummeln. Die zuvor beschriebenen Zusammenhänge wollen wir anhand eines Fallbeispiels kurz betrachten.
Fallbeispiel 1: Beleidigtsein behindert Followership
Ein technisch sehr kompetentes Mitglied eines Luftsportvereins wäre bei den nächsten Vorstandswahlen gerne Vorstand geworden. Er sah sich wegen seiner fliegerischen Erfahrung, seiner technischen Expertise und nicht zuletzt wegen seiner langen Vereinszugehörigkeit als dafür prädestiniert. Doch bereits vor den Wahlen stand fest, dass er keine Chance hatte, gewählt zu werden. Viele Mitglieder wollten eine jüngere Person an der Vereinsspitze sehen, da sie ihnen eher zutrauten, geeignete Rezepte für die Lösung des Nachwuchsproblems identifizieren und umsetzen zu können. Technische Expertise und fliegerisches Können sahen viele Mitglieder hierfür als nicht hinreichend an. So kam es dann schließlich bei den Wahlen auch. Besagtes Vereinsmitglied lag bei den Wahlen weit abgeschlagen an letzter Stelle. Dennoch schätzten ihn die meisten Mitglieder als Vereinskameraden sehr, denn der Verein profitierte stark von seiner Expertise und seiner Erfahrung. Nach der verlorenen Wahl ließ er sich jedoch jedes Mal anbetteln, wenn es etwas zu tun gab und seine Hilfe wichtig oder nützlich war. Regelmäßig kritisierte er dabei den gewählten Vorstand, bevor er schließlich seine Hilfsbereitschaft signalisierte. Die Kritik geschah teilweise aus fadenscheinigen Gründen nur der Kritik willen. Er wollte damit zum Ausdruck zu bringen, dass er nach wie vor eigentlich nur sich selbst als geeigneten Vorstand sah. Manchmal ließ er sich für Wartungsarbeiten am Flugplatz beabsichtigt übermäßig viel Zeit, was den Flugbetrieb im Verein behinderte. Dadurch wollte er möglichst vielen Mitgliedern möglichst oft und lange vor Augen führen, dass der Vorstand eine falsche Entscheidung bei der Beschaffung des zu wartenden Gerätes getroffen hatte. Er stellte nicht das gemeinsame Ziel von Vorstand und Mitgliedern, nämlich den Verein voranzubringen und die luftsportlichen Aktivitäten zu fördern, in den Fokus seiner Mitwirkung, sondern mehr seine eigene Person, seine persönlichen Vereinsinteressen und das vermeintliche Unrecht, das ihm seiner Meinung nach mit der nicht erfolgten Wahl zum Vorstand widerfahren war. Er opponierte dermaßen häufig, dass Vorstand und andere Mitglieder viel Mühe hatten, ihn zur zielorientierten Mitarbeit zu bewegen. Er folgte mehr seinen eigenen Vorstellungen als der Räson und der Meinung des Vereins und zeigte somit keine gute Followership. Dies ging so weit, dass schon einzelne Mitglieder hinter vorgehaltener Hand sagten, man müsste über seinen Ausschluss aus dem Verein nachdenken.
Diese Aufmüpfigkeit des Mitglieds hielt auch nach einem Jahr fast ungemindert. Seine Verbitterung zeigte sich auch in anderen Lebensbereichen. An seinem [29]Arbeitsplatz wurde er zunehmend aufmüpfig, weil ihm trotz seiner Erfahrung mit Mitte 50 ein junger Chef »vor die Nase gesetzt« worden war, wie er es formulierte, und er sich um seine Beförderung betrogen fühlte. Dementsprechend zeigte er auch bei seinen Kollegen ein sehr ähnliches Verhalten des sich ständig anbetteln Lassens gepaart mit einer nicht abreißenden Kritik an seiner neuen Führungskraft. Von den genervten Kollegen alarmiert, nahm nach etwa drei Monaten der zuständige Personalleiter Kontakt zu ihm auf. In einem Gespräch sprach er den Mittfünfziger auf die Wahrnehmungen seines Verhaltens an und forderte ihn zu einer umgehenden Rückkehr zu einer akzeptablen Followership auf. Ansonsten solle er eine eventuelle Versetzung ins Auge fassen oder über die Option der Altersteilzeit für den vorgezogenen Ruhestand nachdenken.
Das Followership-Verhalten im Verein war nach einer gewissen Zeit auf den Berufsalltag des Mitglieds übergeschwappt. Seiner Meinung nach hatte es einen berechtigten Anlass für sein Verhalten gegeben. Jedoch war dieser Anlass kein zwingender Grund dafür, sich an seiner Arbeitsstelle so unkooperativ zu verhalten wie im Verein und dies auch für eine lange Zeit zu praktizieren. Während sich das seine Vereinskameraden aufgrund geringer Handlungsmöglichkeiten mehr oder weniger gefallen lassen mussten, war sein Arbeitgeber dabei weniger kompromissbereit. Dazu trugen die Entschlossenheit der Führungskräfte, also deren Leadership, und die breiteren Handlungsmöglichkeiten, die das Unternehmen zur Lösung des Problems hatte, bei. Dieses Fallbeispiel zeigt, welche Auswirkungen schlechte Followership haben kann. Die Zufriedenheit im Team, der Eifer am Mitwirken und somit letztendlich die Ergebnisse des gemeinsamen Tuns und Arbeitens bleiben hinter dem zurück, was mit denselben Ressourcen erzielt werden könnte. Zeigt ein Teammitglied nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern dauerhaft solch ein Followership-Verhalten, hat dies tiefgreifende und langanhaltende Auswirkungen auf die dauerhafte Leistung eines Teams. Stellt es sich ein, dass nicht nur ein, sondern mehrere, im Extremfall alle Teammitglieder ein weniger gutes Followership-Verhalten zeigen, kann man sich ausrechnen, wie es um Zusammenarbeit zwischen Leadern und Followern und um die zielgerichtete Leistung des Teams bestellt ist. Auch eine gute Führungskraft und ein guter Leader können hier im Alltag mit großen Problemen zu kämpfen haben. Gute Followership lebt auch vom Miteinander. Das bedeutet, dass sich der Einzelne mit seinen persönlichen Interessen auch an der einen oder anderen Stelle zugunsten des Teams zurücknehmen muss.
Schlechte Followership führt in der Regel wie zuvor beschrieben zu suboptimalen oder schlechten Ergebnissen und reduziert die Zufriedenheit im Team. Beides kann auch der beste Leader nur zu einem gewissen Punkt ausgleichen, so dass hier schnell klar wird, dass die gesamte Leistung beziehungsweise der Erfolg eines Teams, einer Gruppe, einer Abteilung oder einer sonstigen Einheit von zusammenwirkenden Menschen immer sowohl von der Leadership als auch der gelebten Followership abhängt. Wie wir noch sehen werden, ist Machtausübung und somit [30]Leadership ein Wechselwirkungsprozess zwischen Menschen.47 Die Wirkung dieser Macht ist von der Kooperationsbereitschaft der Beeinflussten abhängig, d.h. die Wirksamkeit der Leadership hängt von der jeweiligen Followership ab. Im Extremfall kann dies dazu führen, dass Macht einfach »durchgedrückt« und die Mitwirkung der Follower erzwungen wird. Das kann in einem System von Befehl und Gehorsam enden, in dem ein nicht geleisteter Gehorsam entsprechend geahndet wird. In Machtschauplätzen, die leicht verlassen werden können, wie beispielsweise Unternehmen, stellt sich dann häufig ein gewisser Schwund ein und Mitarbeiter wandern zu anderen Unternehmen ab. Gerade größere Veränderungen wie die Einsetzung eines neuen Geschäftsführers in einem Unternehmen nach Jahrzenten stabiler Entwicklung bergen Potential dafür. Denn häufig prallen hier unterschiedliche Leadership- und Followership-Ansätze aufeinander, die sich erst aneinander anpassen müssen. Gelingt dies nicht oder nicht hinreichend, kann eben die gezeigte Entwicklung ihren Lauf nehmen. Dies kann bis an die Grenzen der Akzeptanz des Machtsystems gehen. Ob gute oder schlechte Followership vorliegt und ob die dadurch entstehenden Konsequenzen gut oder schlecht sind, liegt somit abhängig von jeweiligem Machtschauplatz und Kontext auch von der Betrachtungsweise und der Einschätzung des Einzelnen ab. Welche Folgen schlechte Followership in Unternehmen haben kann, betrachten wir anhand eines weiteren Fallbeispiels.
Fallbeispiel 2: Mangelnde Followership macht Führung schwierig
Ein Maschinenbauunternehmen mit langer Tradition war über Jahrzehnte fest am Markt etabliert. Das Unternehmen zahlte gut und die Verhältnisse waren stabil, sodass die Belegschaft zufrieden war. Mit Einsetzen der Digitalisierung verlor das Unternehmen jedoch Marktanteile. Es konnte sich nicht schnell genug an die veränderten Marktverhältnisse anpassen, so dass es in die roten Zahlen rutschte. Daher wurde das Unternehmen von einem großen Industriekonzern aufgekauft. In den Folgejahren wurde versucht, das Unternehmen in die Konzernwelt zu integrieren. Um hierfür Stabilität zu bieten, wurde das bisherige Top-Management weitgehend beibehalten. Im mittleren Management hingegen wurden zahlreiche Positionen neu besetzt, weil die bisherigen Manager im Konzern Möglichkeiten für ihre berufliche Weiterentwicklung wahrgenommen hatten. Dem Unternehmen wurde eine »Schlankheitskur« in Form eines Prozessverbesserungsprojektes verordnet. Die Abläufe sollten dadurch schneller, effektiver und effizienter werden. Die neuen mittleren Manager, die teilweise aus anderen Teilunternehmen des Konzerns stammten, kannten diese Art von Veränderungsprojekten bereits und arbeiteten eifrig an der Umsetzung mit. Das alte und neue Top-Management unterstützte dieses Projekt zwar [31]