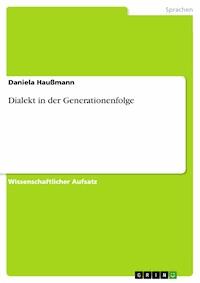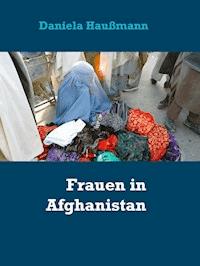
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Afghanistan zählt für Frauen noch immer zu einem der gefährlichsten Länder weltweit. Ehrenmorde, Zwangsverheiratungen, Kinderehen, Vergewaltigungen - die Liste der Gewalt, der afghnanische Frauen ausgesetzt sind, ist lang. Obwohl Gesetze zu ihrem Schutz erlassen wurden, kommen ihre Peiniger meist ungestraft davon. Daniela Haußmann sprach mit Männern und Frauen, die am Hindukusch leben, über die Situation der weiblichen Bevölkerung. Anhand ihrer Geschichten und Sichtweisen eröffnen sich Einblicke in die Lage der Frauen vor Ort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauen in Afghanistan
VorwortDer Kampf ums ÜberlebenLeben mit BehinderungEine kleine Geschichte der FrauenrechteVon der Fallschirmspringerin zur GeneralinProstituierte – Die vergessenen Frauen AfghanistansDie Frau im RückkehrerlagerVon der arrangierten Ehe zur ScheidungVon der Familie verstoßenMit kleinen Schritten in die ZukunftImpressumVorwort
Im Grunde wollen wir alle nur das Eine: glücklich und zufrieden leben – gleichgültig, ob wir in Afghanistan, Deutschland oder irgendeinem anderen Teil der Welt zuhause sind. Doch was braucht es, damit wir erwartungsfroh in den Tag starten und abends mit einem Lächeln auf den Lippen ins Bett fallen? Niemand braucht Koffer voller Geld, steinerne Paläste, das trendigste Smartphone oder die teuerste Luxuskarosse. Es sind, wie so oft, die kleinen Dinge im Leben, die uns vor Freude an die Decke springen lassen und uns so großen Reichtum bescheren. Klingt das abgedroschen? Vielleicht. Aber wie würde das Leben ohne eine liebevolle Familie, treue Freunde, erfüllende Beziehungen, glückliche Erlebnisse und unbekümmerte Erfahrungen aussehen? Wäre das überhaupt noch ein Leben? Natürlich: Von der Hand in den Mund – so kommt keiner über die Runden. Das macht weder satt, noch zufrieden - und schon gar nicht glücklich. Kein Zweifel, es braucht ein gewisses Maß an materieller Grundsicherheit, um sich in seiner Haut wohlzufühlen und die ideellen Dinge des Lebens genießen zu können. Wer allein auf weiter Flur Tag für Tag ums Überleben kämpft, wird kaum frohgemut in die Zukunft blicken. Wo auch immer wir auf der Welt zuhause sind - das Streben nach Glück macht uns alle gleich – unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Hautfarbe, Sprache, Religion oder sozialer Zugehörigkeit. Was selbstverständlich klingt, liegt für viele Afghanen in weiter Ferne. Die Männer und Frauen, die am Hindukusch zuhause sind, haben eine Menge Probleme. Nach Jahrzehnten des Kriegs wünschen sie sich ein friedliches und sorgenfreies Leben. Doch Terror, Gewalt, Zerstörung, Arbeitslosigkeit und Armut stellen viele Afghanen im Alltag auf eine harte Probe. Es sind gerade Frauen, die gefangen im Korsett der Tradition, nach einem Hoffnungskeim suchen. Zwangsheiraten, Kinderehen, Vergewaltigungen, Ehrenmorde, Misshandlungen – die Liste der Gewalt, der afghanische Frauen ausgesetzt sind, ist lang. Trotz Gesetzen, die zu ihrem Schutz erlassen wurden, kommen ihre Peiniger meist ungestraft davon. Für viele Afghaninnen sind die eigenen vier Wände noch immer der gefährlichste Ort. Im Verlauf mehrerer Reisen, die mich an den Hindukusch führten, traf ich Männer und Frauen, mit denen ich über die Situation der weiblichen Bevölkerung sprach. Anhand ihrer Schicksale und Lebenswege eröffnen sich Einblicke in Meinungen, Sorgen, Nöte, Hoffnungen und Ängste, die den Alltag afghanischer Frauen beschreiben. Ziel dieses Buches ist es ausdrücklich nicht dem Leser eine vorgefertigte Meinung anzubieten. Im Gegenteil: Es versteht sich als Impuls für eine weitergehende Auseinandersetzung mit Afghanistan und seiner Gesellschaft, aber auch den Folgen, die der westliche Einfluss losgetreten hat und noch immer lostritt. Es liegt meiner Überzeugung nach in der Verantwortung jedes einzelnen auf Basis verschiedenster Informationen eine eigene Sicht der Dinge zu entwickeln. Meinungsbildung ist keine Einbahnstraße, sondern eine Aufgabe, deren Bewältigung hilft eine umfassende, bodenständige und adäquate Debatte über Afghanistan, den westlichen Einsatz und die vom Hindukusch ausgehenden Fluchtbewegungen zu führen. Dieses Buch bietet eine ganze Reihe vielfältigster Informationen die den Meinungsbildungsprozess nachhaltig unterstützen. Die wiedergegebenen Eindrücke, Aussagen und Schicksale sind nebst der aufgegriffenen Themen zwangsläufig subjektiv. Einerseits durch meine Auswahl als Autorin, andererseits bedingt durch die persönliche Betroffenheit der interviewten Personen. Umso wichtiger ist es meines Erachtens, dass es trotzdem Aufgabe und Chance des Lesers bleibt, eigene Vorstellungen und Aufassungen zu hinterfragen, zu ergänzen oder weiterzuentwickeln.
Frickenhausen, Oktober 2017
Der Kampf ums Überleben
„Wenn der Grundstein schief liegt, kann die Mauer nicht gerade werden“, besagt ein afghanisches Sprichwort. Und das trifft auch auf die Situation der Frauen in der Islamischen Republik Afghanistan zu. Nach fünfzehn Jahren ist von der Aufbruchsstimmung, die 2001 am Hindukusch herrschte, nicht mehr viel übrig geblieben. Wirtschaftlicher Aufschwung, Demokratie, Gleichberechtigung und eine medizinische Grundversorgung für breite Schichten – Versprechungen, die viele Afghanen nach Jahrzehnten des Kriegs auf eine bessere Zukunft hoffen ließen. Der Wunsch nach Frieden und der Glaube an eine bessere Zukunft, an einen Ausweg aus der Armut, ist für viele nur noch eine entfernte Hoffnung. Für die Menschen in Afghanistan ist jeder Tag eine Bewährungsprobe, wie ein Beispiel aus einem kleinen Dorf bei Imam-Sahib, in der Provinz Kunduz, zeigt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt Samira am Boden. Sie atmet schwer, windet sich und wirft den Kopf weinend zur Seite. Das Kleid, das ihren schwangeren Bauch bedeckt, ist nass vom Schweiß. Die Decke, auf der sie liegt, hat sich mit Blut vollgesogen. Verkrampft hält sie die Hand ihrer Mutter, die mit einem feuchten Tuch ihre Stirn kühlt. Seit Stunden liegt die Fünfzehnjährige in den Wehen. Längst hat die Hebamme aufgehört, Geburtshilfe zu leisten. „Ich kann ihr nicht helfen, wahrscheinlich liegt das Kind falsch“, sagt sie und bittet mich, das Mädchen ins Krankenhaus nach Kunduz zu bringen. Samira schreit, als die Frauen versuchen, ihr auf die Beine zu helfen. Aus eigener Kraft kann die Fünfzehnjährige nicht stehen. Die Hebamme ruft nach dem Ehemann, Hamid. Der trägt das Mädchen zum Auto und legt es auf die blutverschmierte Matratze, die die Frauen in den Kombi geschoben haben. Hamid setzt sich zu Samira auf die Ladefläche. Die Mutter streicht ihrer Tochter durchs Haar. „Du bekommst Hilfe, die Frau bringt dich ins Krankenhaus“, sagt sie. Samira nickt. Ich schließe die Heckklappe, steige in den Wagen und fahre los. Die Straßen abseits der Städte sind nichts weiter als Feldwege. Oft genug gibt es nicht einmal die. Wer entlegene Dörfer erreichen will, fährt querfeldein. Regen oder Schnee machen die Wege unpassierbar. Fahrzeuge und Fuhrwerke fahren sich im aufgeweichten Boden fest, Bedingungen, die eine Fahrt von nur wenigen Kilometern zu einem Stunden dauernden Abenteuer machen. Gebirgsstraßen oder vielmehr die Pistenwege, die in den ländlichen Gebieten abseits der Städte und Hauptverkehrswege als solche gelten, befährt im Winter niemand. Das Risiko, dass auf den ungesicherten Strecken ein Unfall passiert oder dass ein Fahrzeug, das auf vereisten Untergrund gerät, abstürzt, ist groß. Ganze Dörfer sind deshalb, insbesondere im Winter und zur Schneeschmelze, von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst im Sommer stellen lange Wegstrecken die Menschen vor große Herausforderungen. Die Berg- und Passstraßen, die ich während meiner Aufenthalte in Afghanistan immer wieder befahren habe, waren häufig nur so breit, dass sie gerade einmal einem Fahrzeug Platz boten. Meine Begleiter und ich waren deshalb oft gezwungen, das Auto dicht am Abgrund entlang zu bugsieren. Hier und da gab es in den Fels geschlagene Einbuchtungen, in die wir und andere Fahrer ausweichen konnten, wenn es Gegenverkehr gab. In solchen Fällen mussten wir, die Felskanten und den Abgrund immer vor Augen, den Wagen bis zur nächsten Einbuchtung langsam rückwärts rollen lassen. Meine afghanischen Freunde hatten mir oft von Fahrern erzählt, die bei derartigen Manövern mit ihren Fahrzeugen in die Tiefe stürzten. Übriggeblieben sei nicht mehr als ein Haufen zertrümmertes Blech. Die Insassen konnten nur schwer verletzt oder tot geborgen werden. Dabei habe es an ein Wunder gegrenzt, wenn die Opfer den Transport in die nicht selten weit entfernten Krankenhäuser überlebten. Jeder riet mir deshalb, die Berg- und Passstraßen nach Regen zu meiden, gerade im Winter. Der aufgeweichte Untergrund der unbefestigten Straßen kann sich jederzeit lösen und wegbrechen. Warnschilder, Leitplanken, Straßenbeleuchtungen oder einen asphaltierten Untergrund - all das sucht man hier vergebens. An das unermüdliche Knarren der Türen des klapprigen Kombis, in dem ich sitze, habe ich mich schon gewöhnt. Dem fortwährenden Quietschen des Fahrwerks messe ich schon lange keine Bedeutung mehr bei. Einzig und allein die Schlaglöcher und Bodenwellen, die den Wagen ordentlich durchrütteln, machen mir Sorgen. Denn jeder weitere Stoß kann der letzte für die Achse sein. Ich schaue nach vorn. Hügel, grüne Weideflächen und Ackerland liegen vor uns. Langsam rollt der Kombi aus dem kleinen Dorf hinaus. Samira wimmert. Die Fahrt ist für die Fünfzehnjährige eine Tortur. Hamid hält seine Frau in den Armen. Ihr Kopf ruht an seiner Schulter. Er streicht ihr wieder und wieder über das Haar. Der Dreiundzwanzigjährige ist Bauer, genau wie seine Eltern und deren Eltern vor ihm. Ein Auto kann sich weder Hamid noch sonst jemand im Dorf leisten. In Notfällen wie diesem ist das eine Katastrophe. „Wenn du Hilfe brauchst, musst du entweder laufen oder Kranke und Verletzte mit dem Esel zum Arzt bringen“, sagt er. Überall im Land wurden mit internationalen Hilfsgeldern Krankenstationen eingerichtet. Doch die sind laut Hamid nicht gut ausgerüstet. „Bei kleineren Verletzungen, einer Grippe oder einem Schnupfen können die Ärzte helfen“, erzählt er. „Aber größere Operationen können sie in den Stationen nicht durchführen.“ Dafür fehle die technische und medizinische Ausrüstung. Als ich zwei dieser Stationen besuchte, bestätigten mir die Ärzte Hamids Schilderungen. Wer ernsthaft erkrankt ist oder schwere Verletzungen aufweist, wird von ihnen nach Kabul geschickt. Die Patienten legten dann die weiten Strecken zu Fuß oder mit dem Esel zurück. Häufig seien sie deshalb tagelang unterwegs. Eine Frau, die ich in einem neu eingerichteten Krankhaus in der Landeshauptstadt traf, erzählte mir, dass sie eine einwöchige Reise auf sich nehmen musste, um die Klinik zu erreichen. Weit und breit habe es keinen Arzt gegeben, der den Jungen behandeln konnte. Und so blieb ihr nichts anderes übrig als den Zehnjährigen auf einen Esel zu setzen und mit ihm nach Kabul zu laufen. „Kannst du dir vorstellen, was das für meine Frau in ihrem Zustand bedeutet?“, fragt mich Hamid. Ich sehe in den Rückspiegel, in dem sich unsere Blicke treffen. Hilflos suche ich nach einer Antwort. Soll ich ihn trösten, ihn bitten, Hoffnung und Zuversicht zu bewahren, ihm Mut zusprechen? Afghanistan verzeichnet eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten weltweit. Der Tod während einer Geburt ist die häufigste Todesursache bei afghanischen Frauen und Mädchen. Aus dem Bericht „World Health Statistics 2016“ geht hervor, dass in Afghanistan statistisch betrachtet bei 100.000 Lebendgeburten 396 Mütter sterben.1 Zum Vergleich: In Deutschland sind nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 2014 rund vier Frauen bei 100.000 Lebendgeburten gestorben.2 Der Kampf gegen die Müttersterblichkeit am Hindukusch galt lange als Erfolgsgeschichte. Dank westlicher Anstregungen gelang es im Zuge des Wiederaufbaus die Sterbequote in diesem Bereich drastisch zu senken. Im Jahr 2000 zählte die Weltgesundheitsorganisation in Afghanistan 1.100 Todesfälle je 100.000 Lebendgeburten, 2010 waren es nur noch 584.3 Und nun zeichnen, laut einem Bericht der britischen Zeitung Guardian, noch nicht veröffentlichte Untersuchungen der Kabuler Regierung, ein anderes Bild. Demnach sollen bei 100.000 Lebendgeburten durchschnittlich zwischen 800 und 1.200 Frauen ums Leben kommen.4 Gehört Samira, die hinten im Wagen zwischen Leben und Tod schwankt, zu diesen Frauen oder nicht? Sie ist Teil der Schicksale und Geschichten, die hinter den Zahlen stehen, die in Jahresberichten, Analysen oder Medienberichten inflationär gebraucht werden, um Trends, Entwicklungen und Momentaufnahmen zu beschreiben, um am Ende zu beurteilen, wie viel, gemessen an dem jahrelangen Engagement der internationalen Gemeinschaft, unter anderem mit Hilfsgeldern oder militärischen Mitteln erreicht worden ist. Doch Schicksale, wie das von Samira, geben der anonymen Statistik ein Gesicht. Es ist leicht, rund 5.000 Kilometer Luftlinie von Afghanistan entfernt, die Zeitung aufzuschlagen, den Fernseher oder das Radio einzuschalten und anhand der präsentierten Daten und Fakten zu sagen, dass man weiß, dass es den Afghanen schlecht geht, dass sie in Armut leben oder an Hunger leiden. Über das wahre Ausmaß des Leids vermitteln Zahlen und Statistiken nur eine vage Vorstellung. Was es heißt, täglich ums nackte Überleben kämpfen zu müssen, bleibt abstrakt. Schlagartig werde ich Teil von Samiras Geschichte, ihres Leids, ihrer Verzweiflung und der Qualen, die sie hinten im Wagen erduldet. Mit dem Geruch von geronnenem Blut in der Nase, dem Weinen und Wimmern, das in meine Ohren dringt, mit ihrem schmerzverzerrten Gesicht vor Augen wird Samiras Not zu meiner eigenen. Ich fühle mich machtlos der Situation und der fehlenden Infrastruktur ausgeliefert. Das einzige, was ich für Samira und Hamid tun kann, ist fahren bis wir ein Krankenhaus finden. Kann ich mir vorstellen, wie es ist, mit Schmerzen in der sengenden Sonne, auf staubigen Trampelpfaden, mit dem Esel kilometerweite Wegstrecken zurückzulegen, darauf hoffend, am Ende all der Strapazen lebend in einer Klinik anzukommen und dabei nicht überfallen zu werden? Kann ich mir die Angst vorstellen, auf eine Landmine zu treten? Kann ich mir vorstellen, wie es ist, in ein Gefecht zu geraten? Solche Ängste musste ich nie durchstehen. Jede mögliche Antwort auf Hamids Frage erscheint mir deshalb derart belanglos und abgedroschen, dass ich keine Worte finde. Schließlich kann ich jederzeit in den Flieger nach Deutschland steigen und alles hinter mir lassen. Im Rückspiegel sehe ich, wie Hamid den Kopf schüttelt. „Einige Kilometer entfernt gibt es eine Krankenstation‟, erzählt er. „Aber dort gibt es keine weiblichen Ärzte und auch kein Ultraschallgerät.‟ Deshalb hatte Samira keine medizinische Betreuung erhalten. Einzig und allein die Dorfhebamme hat sich vor der Geburt mit der Fünfzehnjährigen unterhalten und ihr erzählt, wie alles abläuft. In jedem Dorf werden die jungen Frauen in die Geburtshilfe eingeführt. Treten Komplikationen auf, sind die werdenden Mütter auf sich gestellt. „Die Hebammen im Dorf können nicht festellen, ob das Kind falsch herum liegt, eine Eileiterschwangerschaft vorliegt oder etwas mit der Nabelschnur nicht stimmt‟, klagt Hamid. „ Viele Kinder sterben in den ersten Lebenswochen und -monaten.‟ Der Großteil der Schwangeren bringt seine Kinder zu Hause zur Welt, mit allen Risiken, die ohne die professionelle Hilfe ausgebildeter Geburtshelferinnen und angesichts mangelnder Hygiene auftreten. So kann es zu Infektionskrankheiten wie Tetanus kommen. Dessen Erreger können unter anderem durch Straßenstaub oder Erde in offene Wunden gelangen und bei Neugeborenen zu einer Nabelinfektion führen, die kurz nach der Geburt zum Tode führen kann. Bei 30 Prozent der Geburten im ländlichen Raum legen die Frauen ihr Leben in die Hände unausgebildeter Hebammen, während in schwer zugänglichen Gebieten 12 Prozent der Schwangeren überhaupt keinen Zugang zu einer entsprechenden Gesundheitsvor- und -versorgung hat.5 „Neuste Schätzungen besagen, dass mehr als neun Millionen Afghanen keine oder nur einen begrenzten Zugang zu einer medizinischen Basisversorgung haben. Angesichts dessen wird es im Jahr 2017 zwangsläufig zu einem Anstieg von Todesfällen kommen, die in Zusammenhang mit Geburten stehen.“6 Mindestens 41 Gesundheitseinrichtungen, die in den Provinzen Nangarhar, Hilmand, Kandahar und Uruzgan über eine halbe Million Menschen medizinisch versorgen, mussten aufgrund der desolaten Sicherheitslage ihre Türen schließen.7 Angesichts der Tragödie, zu der sich eine Schwangerschaft unter diesen Bedingungen sehr leicht entwickeln kann und die Samira hinten im Wagen durchlebt, frage ich mich, ob es in Afghanistan für eine Frau ein freudiges Ereignis ist, einem Kind das Leben zu schenken, oder ob es nicht eher Anlass zu Angst und Sorge bedeutet. Für Hamid sichern Kinder die Existenz der Familie. Für einen Afghanen ist die Familie der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Sie trägt ihn von der Wiege bis zur Bahre. „Die Familie sichert das Überleben“, sagt Hamid. „Sie ist für mich da, wenn ich krank, verletzt oder alt bin und nicht mehr arbeiten kann.“ In einem Land, in dem es keine Kranken-, Renten- oder Pflegeversicherung gibt, übernimmt die Familie alle Funktionen, die in westlichen Staaten von den Sozialversicherungsträgern abgedeckt werden. Deshalb ist es für Hamid völlig normal, dass er eine junge Frau heiratet, die möglichst viele Kinder zur Welt bringen soll. Schließlich ist es die Großfamilie, die das Dasein garantiert. Dass es in Deutschland eine Versicherung gibt, die die Kosten für Arzt, Krankenhaus und Medikamente übernimmt, überrascht den Dreiundzwanzigjährigen. Dass der Staat Straßen baut, für Zug- und Busverbindungen sorgt oder irgendwelche finanziellen Mittel für die Versorgung der Bevölkerung bereitstellt, erstaunt ihn. Lohnnebenkosten, Abwasser- oder Müllgebühren kennt er ebensowenig wie ein funktionierendes Straßennetz. „Ich muss selbst sehen, wo ich mit meiner Familie bleibe“, sagt Hamid. „Der Staat tut nichts für mich. Wenn ich ein Problem habe, frage ich meine Verwandten oder meinen Stammesführer.“ Der junge Mann ist neugierig geworden. „Was machst du in Deutschland, wenn es deiner Mutter oder deinem Vater so schlecht geht wie meiner Frau?“, fragt er. Ich erkläre ihm, dass es flächendeckend Krankenhäuser gibt und niedergelassene Ärzte: „In Deutschland wählst du die Nummer vom Rettungsdienst, schilderst die Art des Notfalls und bekommst medizinische Hilfe.“ Verhältnisse, von denen Hamid und Samira nur träumen können. Einen Krankenwagen hat der Dreiundzwanzigjährige noch nie gesehen. Die gebe es in Kabul. Zumindest hat er das gehört. Einer seiner Verwandten sei einmal in der afghanischen Landeshauptstadt gewesen, um seinen Sohn operieren zu lassen. „Den Krankenwagen hat er vor dem Krankenhaus stehen sehen“, erzählt Hamid. „Und er sagte, dass es in ihm eine Trage, Medikamente und Verbandsmaterial gibt.“ In Dörfern wie seinem sei das undenkbar. „Selbst wenn du ein Handy hast, brauchst du keinen Krankenwagen zu rufen. Hier kannst du dir nur selbst helfen", so seine ernüchternde Antwort. Er greift eine der Wasserflaschen, die hinten im Kofferraum liegen, hebt den Kopf seiner Frau an, um ihr etwas zu trinken zu geben, doch die ist kaum in der Lage, ihren Mund zu öffnen. Hustend schluckt sie einige Tropfen und sackt kraftlos in sich zusammen. Hamid nimmt sein grün-beiges Tuch vom Hals, faltet es einige Male, schüttet Wasser darauf und legt es ihr auf die Stirn. Seit zwei Stunden sind wir unterwegs. Und es wird mindestens noch einmal so lange dauern, bis wir Kunduz erreichen. Wir können nur hoffen, dass Samira den Transport übersteht. Es fällt ihr schwer, die Augen offen zu halten. Immer wieder fällt ihr Kopf zur Seite. Hamid rüttelt sie wach, bittet sie durchzuhalten und erzählt ihr, dass Kunduz nicht mehr weit sei. Selbst für einen gesunden Menschen ist die Fahrt auf den staubigen Pistenwegen bei vierzig Grad und ohne Klimaanlage anstrengend. Ich kann mir schwer vostellen, wie es für Samira sein muss. In diesem Moment würde ich alles dafür geben, aufs Gaspedal drücken zu können, um schneller nach Kunduz zu kommen. Mit einem Schlag kommen mir die Probleme, die mich, meine Freunde und Bekannten in Deutschland beschäftigen, so klein und nichtig vor. Eigentlich geht es den allermeisten von uns doch richtig gut. Was spielt es für eine Rolle, mit dem neusten Smartphone zu telefonieren, das größte Auto zu fahren oder die angesagtesten Klamotten im Schrank hängen zu haben, die teilweise gar nicht getragen werden? Ist es wichtig, dass es dieses Jahr ein Urlaub weniger wird oder das Hotel nicht den Erwartungen entspricht? Ein kanadischer Soldat, den ich bei einem Barbeque auf seinem Stützpunkt traf, formulierte es so: „Was ist schon kaputt, wenn mein Haus abbrennt? Natürlich ist der Schaden groß, die Nerven liegen blank, jede Menge Querelen mit der Versicherung und dem Sachverständigen. Aber im Grunde ist doch nicht viel kaputt. Ich baue mein Haus einfach wieder auf. Verglichen mit der Situation in Afghanistan ist das ein Spaziergang. Durch den Einsatz hier habe ich gelernt, die Dinge zuhause mehr wertzuschätzen.“ Mir geht es nicht anders. Gleich nach meinem ersten Afghanistanaufenthalt schnappte ich mir mehrere Kartons und trennte mich von allen Hosen, Pullovern, Jacken, Blusen und Schuhen, die ich nur selten oder gar nicht trug und schickte sie nach Kabul zu einem guten Freund. In jedes Paket legte ich einen Zettel, damit Shamsudin wusste, für wen der Inhalt bestimmt war. Einmal schickte ich ihm zwei Pakete mit Kompressen, Verbandstüchern, Pflastern und Fixierbinden, die er Khatool Mohammadzai übergab, einer afghanischen Generalin, auf die ich später in diesem Buch noch zu sprechen komme. Sie hatte einen Verein für Witwen ins Leben gerufen und mir erzählt, dass sie Verbandsmaterial gut gebrauchen könnte. Zurück in Deutschland bat ich Freunde und Bekannte, mir alles zur Wundversorgung zu geben, was sie haben, kaufen oder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis einsammeln können. Gleiches galt für Kleidungsstücke. Teilweise schickte ich auf einen Schlag zehn Pakete nach Afghanistan, weil so viele in meinem Umfeld bereit waren zu helfen. Einen Teil der Kleider bewahrte Shamsudin bis zu meinem nächsten Besuch auf, damit wir sie gemeinsam an Bedürftige verteilten konnten. Natürlich war das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem wollte ich helfen und das Leid und die Armut, die ich gesehen und erlebt hatte, nicht ignorieren. Der harte afghanische Winter stand vor der Tür. Schnee, eisiger Regen und Wind und Hunger fordern vor allem unter Kindern und Älteren ihre Opfer. Warme Mäntel, festes, gefüttertes Schuhwerk, Handschuhe, Schals, Mützen und Pullover schützen vor dem Kältetod. Der Bedarf ist groß. Kaum war der Kofferraum offen, scharten sich Frauen, Männer und Kinder um den Wagen. Sie rissen uns die Kleidungsstücke aus den Händen, drückten sie fest an sich aus Angst, dass sie ihnen jemand wegnahm und verschwanden so schnell, wie sie auftauchten. Es dauerte keine drei Minuten bis alle Kleider verteilt waren. Die Leute waren nicht wählerisch. Sie griffen sich, was sie kriegen konnten, ohne nachzusehen, was es war oder zu überlegen ob das, woran sie sich klammerten, überhaupt von Nutzen war. Ob Jacke, Mantel, Hose, Pullover oder Schal - wichtig war nur, dass sie etwas ergattert hatten. Niemand fragte nach Größen oder probierte Schuhe an. Irgendjemandem in der Familie würden sie schon passen. Einige werden die Kleider wohl verkauft haben, um mit dem Geld Nahrung oder Medikamente zu beschaffen. Wer arbeitslos ist, als Tagelöhner so gut wie nichts verdient, kaum etwas zu essen hat oder krank ist, sorgt sich mehr darüber, wie er den nächsten oder übernächsten Tag übersteht. Der Winter kann warten, wenn der Alltag ein existenzieller Spießrutenlauf ist. Unterm Strich hat sich die Lebenserwartung in Afghanistan verbessert. 2008 lag sie bei Männern zum Zeitpunkt der Geburt noch bei 44 Jahren und bei Frauen bei 43,9 Jahren.8 Ausgehend von den aktuellsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation hat sich die Lebenserwartung bei den Männern auf 59,3 Jahre und bei den Frauen auf 61,9 Jahre erhöht.9 Eine Entwicklung, die auf eine verbesserte medizinische Versorgung zurückzuführen ist. Trotzdem fällt das mit Schwangerschaft und Geburt verbundene Todesrisiko verglichen mit den Nachbarländern nach wie vor hoch aus. In Indien belief sich die Müttersterblichkeitsrate 2013 auf 174 Frauen pro 100.000 Geburten, in Pakistan auf 178, in Turkmenistan auf 61, in Tadschikistan auf 32, in Usbekistan auf 36 und im Iran auf 25.10 Die Zahlen liegen damit deutlich über den bereits erwähnten 396 Sterbefällen unter Frauen, die 2015 pro 100.000 Geburten für Afghanistan in der Statistik angeführt werden.11 Die Sterberate für Kinder unter fünf Jahren und Neugeborene liegt in Afghanistan bei 91,1 Todesfällen pro 1.000 Geburten, in Pakistan bei 81,1, in Indien bei 47,7, in Tadschikistan bei 44,8 und in Usbekistan bei 39,1 Sterbefällen pro 1.000 Geburten.12 „Von Verhältnissen wie in Deutschland sind wir weit entfernt‟, sagt Hamid. „Die Versorgung in Privatkliniken kostet Geld, öffentliche Krankenhäuser sind oft personell unterbesetzt und überfordert.“ Zudem sei die Reise in Städt, in denen es eine adäquate medizinische Versorung gibt, mit Kosten verbunden, die er nur bezahlen könne, wenn er Schulden mache. „Mir fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel“, fährt er fort. „Hier draußen gibt es keine Apotheke. Manche Medikamente sind nur in Pakistan erhältlich. Um dorthin zu gelangen und die Arznei bezahlen zu können brauche ich wieder Geld, das ich nicht habe.“ Und selbst wenn er das Geld aufbringen könnte, wäre das noch lange keine Garantie dafür, dass er tatsächlich medizinische Hilfe erhält. In den Wintermonaten sind viele Dörfer praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Und selbst wenn Schnee, Kälte und Eis nicht zur Barriere für medizinische Hilfe werden, dann sind es kriegerische Auseinandersetzungen, Überfälle und Landminen, die es so gut wie unmöglich machen eine Klinik zu erreichen. „Eine Krankenstation kann“, laut Hamid, „nur wenige Kilometer entfernt liegen. Aber wenn geschossen wird, Menschen sterben, Autos und Häuser in die Luft fliegen, dann ist die Rettung trotz aller Nähe unerreichbar weit entfernt.“ Nachts ist die Gefahr noch größer. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt die Stunde der Taliban, anderer Aufständischer und von Kriminellen. Einheimische rieten mir deshalb immer wieder zeitig eine sichere Zuflucht zu suchen, um die Nacht unbeschadet zu überstehen. Mit der Dämmerung ziehen sich die Menschen in ihre Häuser zurück, verschließen die Türen hinter sich und wagen keinen Schritt nach draußen, geschweige denn, dass sie wegen eines Notfalls zum nächsten Krankenhaus aufbrechen würden. „Wenn jemand in der Nacht einen Arzt braucht, muss er bis zum nächsten Morgen warten. Bis dahin wird er zuhause versorgt. Manche im Dorf haben Erfahrung mit Erster Hilfe, andere wissen wie Wunden gereinigt oder Verbände angelegt werden. Mehr können Dorfbewohner und Angehörige für einen Verletzten nicht tun, noch weniger für jemanden, der lebensgefährliche Beschwerden mit inneren Organen hat und eine Operation braucht“, fasst Hamid die Lage in Worte. Bei Notfällen mindert das zwar die Überlebenschancen, aber letzten Endes wagt es dem Dreiundzwanzigjährigen zufolge niemand bei Dunkelheit sein Dorf zu verlassen. „Außerdem gibt es immer wieder Angriffe auf Kliniken und Krankenstationen. Sie werden gezielt ins Kreuzfeuer genommen oder von Aufständischen geplündert, die die Ausrüstungsgegenstände und das medizinische Material für eigene Zwecke nutzen“, so Hamid. In anderen Fällen besetzen regierungstreue Kräfte die Einrichtungen, um sie als Einsatzstützpunkt zu nutzen.“ 2015 sind nach Angaben von Safeguarding Health in Conflict 63 bewaffnete Zwischenfälle registriert worden, bei denen Aufständische medizinische Einrichtungen und deren Angestellte ins Visir nahmen – gegenüber 2014 ein Anstieg um 47 Prozent.13 Schlussendlich führt das hohe und unkalkulierbare Gefahrenpotenzial dazu, dass zu Beginn des Jahres 2016, in sechs Provinzen 23 Krankenhäuser geschlossen wurden.14