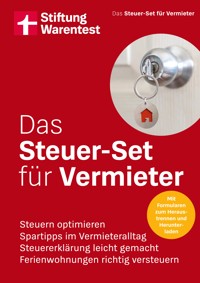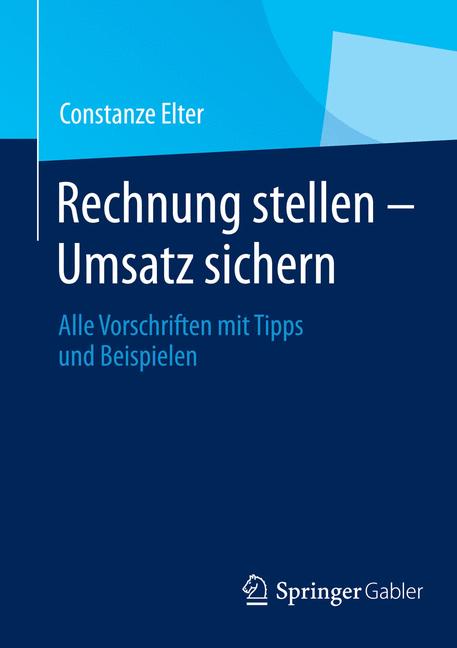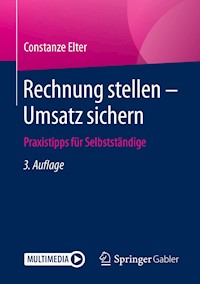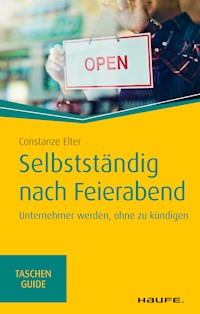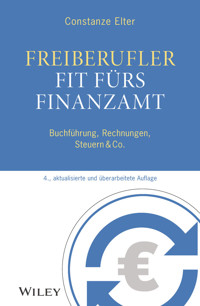
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Auch als Freiberufler kommt man um die Steuererklärung nicht herum. Der sicherste Weg ist hier immer noch der Steuerberater. Aber ob mit oder ohne Steuerberater - endlich zu verstehen, warum das Sammeln dieser und jener Belege wichtig ist, worauf ich bei Rechnungsstellung achten muss, wie ich meinen Gewinn über eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittle und dafür Sorge tragen kann, dass das Finanzamt nicht am Ende bei Einreichung der Unterlagen noch etwas Wichtiges zu beanstanden hat: Das aufzuzeigen und verständlich darzustellen, ist Ziel dieses Buches. Außerdem erklärt die Autorin, welche Folgen die zunehmende Digitalisierung für die Buchhaltung hat und worauf hier zu achten ist. Zusätzlich werden wichtige Vorlagen und Muster auf der Buchwebsite zum Download bereitstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
4. Auflage 2024
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2024 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.de-nb.de> abrufbar.
Umschlaggestaltung init GmbH, Bielefeld
Print ISBN: 978-3-527-51035-1ePub ISBN: 978-3-527-83769-4
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Gewidmet
Über dieses Buch
Legende
Geleitwort zur ersten Auflage
1 Am Anfang steht das Geld – was Sie über Rechnungen wissen sollten
Der Vertragsabschluss – die Grundlage für die spätere Rechnung
Rechnung – aber richtig!
Elektronische Rechnungen
Rechnungen ins Ausland
2 Oh Schreck, die Umsatzsteuer – (k)ein Buch mit sieben Siegeln
Umsatzsteuer – ein Grundkurs
7, 19 oder gar keine Prozente?
Die Kleinunternehmerregelung
Haupt- und Nebenleistungen bei der Umsatzsteuer
Vorsteuerabzug
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Umsatzsteuer-Erklärung
Umsatzsteuerprüfungen
Verbindliche Auskunft des Finanzamts
3 Formulare, Formulare – keine Angst vor der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Einstieg in die Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Wer kann, wer muss, wer darf?
Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Was ist das eigentlich?
Grundregeln der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Betriebseinnahme – ja oder nein?
Einlagen und Entnahmen
Was muss, das muss: die Anlage EÜR
Bilanzieren: Wann lohnt sich der Wechsel?
4 Keine Angst vor den Belegen – Steuern sparen, mit Steuern gestalten
Kosten fürs Unternehmen absetzen: Was sind Betriebsausgaben?
Betriebsausgaben … von A bis Z
Unterwegs fürs Geschäft: Reisekosten
Beschränkt abzugsfähig: Bewirtung und Geschenke
Betriebsausgaben pauschal – geht das überhaupt?
Halb und halb: gemischt betrieblich-private Ausgaben
Längst abgeschrieben? Abschreibungen und Investitionsabzugsbetrag
Nicht zu unterschätzen: geringwertige Wirtschaftsgüter
Das Anlage(n)verzeichnis
5 Und überall Daten, Daten, Daten – die Geschäftsanalyse
Buchführung selbst machen oder abgeben? (K)eine Philosophiefrage
Alles in Ordnung: Belege gut organisieren
Und was kann ich selbst tun? Einführung ins eigenständige Buchen
Vom Beleg zur Auswertung: Buchhaltung auf elektronisch
BWA und Co: Buchführungsdaten nutzen und auswerten
Investitionen steuern, flüssig bleiben: Finanz- und Liquiditätsplanung
Forderungsmanagement leicht gemacht
6 Möglichst viel digital: Vom Beleg bis zum Jahresabschluss
Das Fundament: die GoBD
Der Aufzug in die oberen Stockwerke: die digitale Ablage
Das Penthouse: die elektronische Steuererklärung
Der Hausmeister: die digitale Betriebsprüfung
7 Nicht immer einer Meinung mit dem Finanzamt? Vom Jahresabschluss bis zur Betriebsprüfung
Der Jahresabschluss
Steuererklärung und Steuerbescheid: Vom geschulten Auge prüfen lassen!
Einspruch und Klage: Wie geht das – und was bringt es?
Vertrauen ist gut, Aufbewahren ist besser: Die Betriebsprüfung
Aufzeichnungspflichten und Aufbewahrungsfristen
Wie es weitergeht …
Die Experten
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Beispielrechnung
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Zufluss-/Abflussprinzip;
Abbildung 3.2: Formular Einnahmen-Überschuss-Rechnung;
Abbildung 3.3: Einnahmen-Überschuss-Rechnung und Bilanzierung: die wichtigs...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Pauschale Kilometersätze;
Abbildung 4.2: Verpflegungspauschbeträge;
Abbildung 4.3: Formular Anlage AVEÜR;
Kapitel 5
Abbildung: Bestandsaufnahme Ablage;
Abbildung 5.2: Struktur Kontenrahmen SKR 04;
Abbildung 5.3: Auszug Kontenrahmen SKR 04 (Stand 2023), Teil 1;
Abbildung 5.4: Auszug Kontenrahmen SKR 04, Teil 2;
Abbildung 5.5: Spielarten der BWA;
Abbildung 5.6: Beispielrechnung Privatentnahmen ohne Anspruch auf Vollständ...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Die Checkliste für den Steuerbescheid;
Abbildung 7.2: Größenklassen Betriebsprüfung;
Abbildung 7.4: Prüfschwerpunkte Betriebsprüfung;
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Gewidmet
Über dieses Buch
Legende
Geleitwort zur ersten Auflage
Fangen Sie an zu lesen
Wie es weitergeht …
Die Experten
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
Für Nelly, das Schreibtalent von morgen,
und für meine Mutter, die mir ihre Buchhalterseele vererbt hat.
Die Autorin hat die Inhalte dieses Buchs mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Trotzdem können sie und der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Insbesondere sind die Informationen allgemeiner Art und stellen keine Steuer-oder Rechtsberatung dar. Sie können eine individuelle Beratung nicht ersetzen.
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde im Buch weitestgehend auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Entsprechende Begriffe und Formulierungen gelten natürlich grundsätzlich für alle Geschlechter.
Im Blog der Autorin finden Sie zusätzliche Vorlagen, Checklisten und Merkblätter für Freiberufler – einfach reinklicken bei http://www.steuer-saetze.de
Über dieses Buch
Steuern – für viele ist dieses Thema eine ungeliebte und meist unverständliche Materie. Fachchinesisch von Juristen und Bürokraten sowie die Tatsache, dass die meisten Freiberufler sich höchst ungern mit Zahlen befassen, tun ihr Übriges. Kaum jemand beschäftigt sich gern mit Steuern oder hat sogar Spaß daran.
Genau das möchte ich mit diesem Buch ändern. Sie müssen nach der Lektüre dieses Ratgebers nicht unbedingt die Steuererklärung zu Ihrer Lieblingsbeschäftigung machen. Aber ich möchte Sie ermutigen, sich mit den steuerlichen Konsequenzen Ihrer freiberuflichen Arbeit auseinanderzusetzen. Denn das wird sich für Sie in Euro und Cent auszahlen.
Als Steuerjournalistin möchte ich Sie durch das Labyrinth der Steuern führen und Ihnen die Punkte verständlicher machen, die für Sie wichtig sind. Dazu zählen korrekte Rechnungen genauso wie die Umsatzsteuer und die Wahl des richtigen Umsatzsteuersatzes. Dazu gehören die Einnahmen- und die Ausgabenseite ebenso wie die einzelnen Positionen für Ihre Gewinnermittlung, die Einnahmen-Überschuss-Rechnung und eine strukturierte Ablage. Wichtig ist aber auch, dass Sie verstehen, was Sie in puncto Steuern und Finanzen digital erledigen können und sollten, was hinter Ihren Zahlen steckt und was das für Ihr Unternehmen bedeutet. Betriebswirtschaftliche Auswertungen und andere Analysen sind Hilfsmittel, die Sie bei finanziell relevanten Themen unterstützen können. Und letztlich sollten Sie auch wissen, wie Sie sich mit dem Finanzamt auseinandersetzen können – vom Einspruch bis zur Betriebsprüfung.
»Freiberufler: Fit fürs Finanzamt« soll eine verständliche Gebrauchsanweisung für Ihre Steuerangelegenheiten sein, ausgerichtet auf die speziellen Belange der Freien Berufe. Es soll Ihnen als Wegweiser durch den Steuerdschungel dienen und Sie bei Ihrer Buchführung unterstützen. Und es kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen betriebswirtschaftlich zu hinterfragen. An vielen Stellen finden Sie Expertentipps von Steuerberatern und praktische Hinweise von freiberuflichen Kollegen. »Freiberufler: Fit fürs Finanzamt« ist im besten Fall ein Buch, das Sie gern in die Hand nehmen und lesen – ein Nachschlagewerk, das auf Ihrem Schreibtisch einen festen Platz findet.
Wie wichtig ein aktueller Ratgeber in Sachen Steuern für Freiberufler ist, zeigt die überarbeitete und ergänzte Auflage dieses Buches. Zwischen der dritten Auflage und der, die Sie nun in Ihren Händen halten, lag die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, ein exponentieller Sprung in der digitalen Entwicklung und zahlreiche steuerliche Neuerungen für Selbstständige. Dieses Buch erscheint nun in seiner vierten aktualisierten Auflage - nicht nur auf den neuesten Stand gebracht, was alle steuerlichen und rechtlichen Änderungen für Sie als Freiberufler anbetrifft. Ich habe zudem aus aktuellem Anlass ein Kapitel hinzugefügt, das sich ausschließlich mit den digitalen Aspekten von Steuern und Buchführung befasst. Denn ohne Digitalisierung geht auch in der Buchhaltung von Freiberuflern fast nichts mehr – angefangen von elektronischen Rechnungen über digital erstellte Steuer-Voranmeldungen bis hin zur digitalen Betriebsprüfung. Ich hoffe, dass Ihnen das Buch in dieser runderneuerten Auflage noch mehr Nutzen bringen wird.
Ein Buch schreibt sich nicht von selbst und nicht ohne die Unterstützung anderer. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die bei der Entstehung dieses Buchs mitgeholfen haben. An erster Stelle geht ein großes Dankeschön an meine Familie, meine Tochter Nelly und meinen Mann Andreas, die in den intensivsten Schreibphasen viel Geduld aufgebracht und mir den Rücken freigehalten haben. Jutta Hörnlein, meine Lektorin beim Wiley-Verlag, war auch dieses Mal ein konstruktiver Sparringspartner und die produktive Zusammenarbeit hat das Manuskript zu dem Buch gemacht, das es jetzt ist.
Schon immer wollte ich über »mein« Thema ein Buch schreiben; mein Dank geht an meine Kollegin Jana Tosic, die den entscheidenden Anstoß für dieses Buch lieferte. Die Buchautorin Andrea Behnke hat mir bei den Anfängen dieses Projekts mit intensivem und immer konstruktivem Feedback zur Seite gestanden, wofür ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Mehrere Steuerberater haben mich mit fachlichen Hinweisen und Expertentipps unterstützt, dafür möchte ich mich bei Susanne Christ, Susanne Vogelbacher, Helmut Friederici und Robert Spitzner bedanken. Ein Dank geht an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mir Beispiele aus der Praxis geliefert haben – sowie an alle meine Seminarteilnehmer für Input und Feedback.
Steuerberatung kann ich nicht leisten. Aber vielleicht kann ich mit diesem Buch dazu beitragen, Ihnen die notwendigen steuerlichen Informationen für Ihr Unternehmen zu liefern – und Ihre Hemmschwellen bei diesem Thema abzubauen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende, erkenntnisreiche Lektüre!
Nürnberg, im August 2023
Ihre
Constanze Elter
Legende
Frisch vom Finanzamt
Hinweise auf Vordrucke und Muster
Hinter den Paragrafen
Lexikonartige Begriffserklärung, Vertiefung, Erläuterungen
Zum Abheften
Weiterführende Informationen und Lesetipps, etwa BMF-Schreiben und nützliche Internetseiten
Steuer-Rat
Expertentipp
Vor Gericht
Hinweis auf interessante Urteile
Merke
Geleitwort zur ersten Auflage
Freiberufler, das klingt nach Freiheit und Unabhängigkeit, nach schöpferischer und anspruchsvoller Tätigkeit, nach eigenverantwortlichem Entscheiden auf Basis von Fachwissen und Erfahrung. Ein Traum für viele Menschen. Im beruflichen Alltag der Freien Berufe gerät diese Freiheit allerdings nicht selten ins Hintertreffen, denn auch Freiberufler sind in ein enges Korsett von Pflichten und (Standes-)Regeln, Vorschriften und Gesetzen eingebunden. Zudem müssen sie sich auf dem freien Markt wirtschaftlich behaupten, sollten sie nicht den Luxus einer großen Erbschaft oder eines reichen Mäzens haben. Und wer hat das schon?
Gleich, ob Schriftsteller, Musikerin, Journalist, Architekt, Ärztin, Rechtsanwalt, Softwareentwickler, Lotse oder Hebamme, auf der Rangliste der ungeliebten Tätigkeiten stehen Buchhaltung und Steuern wohl bei den meisten ziemlich weit oben. Nur bei den Steuerberatern sieht das naturgemäß anders aus: Sie haben die intellektuelle Herausforderung, die sich aus dem deutschen Steuerrecht und dem historisch gewachsenen kaufmännischen Rechnungswesen ergibt, zum Beruf gemacht und zu einer eigenen Kunst entwickelt. Davon wiederum können andere Freiberufler profitieren.
Tatsächlich machen sich viele Unternehmer und Freiberufler die Fachkenntnisse und oft sogar die Begeisterung der Steuerberater und Steuerberaterinnen für betriebswirtschaftliche Zahlen und deutsche Gesetzestexte zu Nutze. Denn zum Glück sind unter den Menschen die Talente und Fähigkeiten unterschiedlich verteilt und so ist diese Aufgabenteilung für beide Seiten von Nutzen: Jeder kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Wenn beide Partner dabei Software beispielsweise der DATEV eG einsetzen, klappt das noch einfacher. Denn wir unterstützen diese Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Freiberufler seit mehr als 40 Jahren, unter anderem mit IT-Lösungen, die einen einfachen und sicheren digitalen Austausch zwischen beiden Partnern möglich machen.
Unabhängig davon ist es in jedem Fall ratsam, sich mit den eigenen Geschäftszahlen auseinanderzusetzen und die relevanten Regeln rund um Steuern und Finanzen zu kennen, gleich, ob man nun mit einem Steuerberater zusammenarbeitet oder nicht. Denn nur wer seine Ausgaben und Einnahmen sowie deren unterjährige Entwicklung kennt, kann wirtschaftlich agieren, das heißt nachhaltig für seinen Lebensunterhalt und gegebenenfalls den seiner Familie sorgen. Das gilt für Einzelkämpfer ebenso wie für solche, die in Praxis, Kanzlei oder Büro Mitarbeiter beschäftigen.
Es ist schlicht im ureigenen Interesse eines jeden Freiberuflers zu wissen, wie sich beispielsweise seine variablen und fixen Kosten entwickeln, ob für notwendige Investitionen Kapital angespart werden muss, welche steuerlichen Auswirkungen das jeweils hat und was gegebenenfalls getan werden kann, um das Einkommen zu erhöhen und die steuerliche Belastung zu beschränken.
Ein betriebswirtschaftliches Studium ist für diese Basiskenntnisse über das eigene Wirtschaften nicht nötig, auch kein nächtelanges Grübeln über Zahlenreihen und Sortieren von Belegen. Nötig sind nur die Bereitschaft, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und einige Regeln zu beachten sowie ein wenig Praxiswissen, das dieses Buch von Constanze Elter leicht verständlich und praxisnah vermitteln möchte. Es ist eine einfache Anleitung für eine optimale betriebswirtschaftliche Gestaltung und ein Wegweiser durch die zahlreichen steuerlichen Vorschriften – versehen mit vielen praktischen Tipps von Steuerberatern und Anekdoten von Freiberuflern. Die böhmischen Dörfer des klassischen Rechnungswesens und des deutschen Steuerrechts werden damit zu einem übersichtlichen Routenplan für Ihren wirtschaftlichen Erfolg. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg damit!
Nürnberg, im Februar 2013
Ihr Eckhard Schwarzer
ehemaliges Mitglied des Vorstands der DATEV eG
1Am Anfang steht das Geld – was Sie über Rechnungen wissen sollten
Rechnungen zu schreiben, gehört zu den schönsten Tätigkeiten der Selbstständigkeit. Ein gutes Gefühl, einen Auftrag erledigt und womöglich positives Feedback vom Kunden bekommen zu haben. Und dann die Entlohnung für die getane Arbeit: das Honorar. Die Grundlage für eine solide Rechnung ist ein rechtssicherer Vertrag. Und auch bei den Rechnungen selbst gibt es einiges zu beachten, etwa die Vorschriften und Pflichtangaben für eine korrekte Rechnung. Außerdem verschickt so mancher seine Rechnungen inzwischen am liebsten per E-Mail. Hier sind ebenfalls detaillierte gesetzliche Rahmenbedingungen einzuhalten.
Der Vertragsabschluss – die Grundlage für die spätere Rechnung
Vor der Rechnung steht immer ein Vertrag, der zu Beginn des Auftrags geschlossen wurde. Das kann ein abgezeichnetes Angebot, ein Werk- oder Dienstvertrag oder die selbst erstellte Auftragsbestätigung sein.
Dienstvertrag oder Werkvertrag?
Gerade unter den Freiberuflern aus dem kulturellen Bereich kommt es darauf an, ob mit dem Auftraggeber ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag geschlossen wurde. Mit Auswirkungen auch auf Rechnungen und Honorar. Daher ist es wichtig, den Unterschied zwischen den beiden Vertragsarten zu kennen.
Ein Werkvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass der Dienstleister ein bestimmtes Arbeitsergebnis – also ein Werk – schuldet. Die Grundlage dafür ist im Bürgerlichen Gesetzbuch §§ 631 BGB, festgelegt. Ein Beispiel: Eine Werbeagentur erhält den Auftrag, für ein Unternehmen das Design eines Firmenlogos zu entwickeln. Es handelt sich um einen Werkvertrag.
Obwohl im Gesetz die wichtigsten Punkte angesprochen sind, ist es trotzdem notwendig, im Vertrag klare Vereinbarungen über alle wesentlichen Einzelheiten zu treffen. Dazu zählen die genaue inhaltliche und technische Beschreibung der Leistung, ein Terminplan und Liefertermin sowie das Honorar und dessen Fälligkeit. Ganz wichtig: Beim Werkvertrag muss das Werk vom Auftraggeber abgenommen werden! Dazu ist der Kunde verpflichtet, wenn das Werk fehlerfrei ist. Der Auftraggeber darf die Abnahme nur verweigern, wenn es entscheidende Mängel oder Abweichungen vom Vertrag gibt. Er muss aber dem Dienstleister die Möglichkeit zum Nachbessern geben. Erst wenn die Mängel binnen einer eingeräumten Frist nicht beseitigt sind, kann das Honorar gekürzt werden. Geschmack spielt bei der Abnahme keine Rolle; wenn's dem Kunden nicht gefällt, darf er die Abnahme also nicht verweigern. Der Auftraggeber ist verpflichtet, nach Abnahme den vereinbarten Preis zu zahlen.
Im Unterschied dazu geht es beim Dienstvertrag darum, dass der Auftragnehmer bestimmte Tätigkeiten für den Kunden erbringt – also Dienste leistet. Hier wird nicht ein bestimmter Erfolg – mit anderen Worten das Arbeitsergebnis –, sondern nur der Dienst an sich geschuldet: Ein Heilpraktiker erbringt beispielsweise für seine Patienten die Dienstleistung »Therapie«. Er schuldet aber nicht das Arbeitsergebnis »Gesundheit«. Das Honorar aus einem Dienstvertrag ist fällig, wenn die Dienstleistung erbracht ist. Zusätzlich kann ein Vorschuss vereinbart werden. Ein Dienstvertrag läuft meist über längere Zeit, sprich, es geht darum, Tätigkeiten regelmäßig zu erbringen.
Ein typischer Vertragsabschluss basiert auf zwei Elementen:
der Willenserklärung des Auftragnehmers (zum Beispiel in Form eines schriftlichen Angebots);
der Willenserklärung des Auftraggebers (etwa in Form der Annahme oder Zustimmung).
Ein Vertrag kommt also grundsätzlich nur dann zustande, wenn die eine Seite einen Vorschlag macht, dem die andere Seite zustimmt. Welche Form für den Vertrag gewählt wird, ist nicht entscheidend. Denn in Deutschland herrscht für die meisten Verträge Formfreiheit. Auch E-Mails sind zulässig. Allerdings ist es für mögliche Streitigkeiten wichtig, nachweisen zu können, ob der Empfänger die elektronische Post bekommen hat.
Ein schriftlicher Vertrag muss im Prinzip nicht sein. Besser aber ist es, das Besprochene schriftlich zu fixieren. Denn ein Telefonat ist juristisch zwar genauso bindend wie die schriftliche Vereinbarung. Wenn es aber zum Streit kommt, steht das Wort des Dienstleisters im Zweifel gegen das Wort des Kunden. Bei besonderen Verträgen heißt es außerdem aufgepasst. Denn in bestimmten Fällen schreibt das Gesetz eine bestimmte Form vor, etwa bei der Zusage einer Bürgschaft.
Daher sollten Sie in jedem Fall schon bei Vertragsschluss darauf achten, dass Sie eine sichere Basis dafür haben, später Ihr Geld pünktlich zu erhalten. In manchen Situationen heißt dies, erst einmal überhaupt einen schriftlichen Vertrag zu schaffen – etwa dann, wenn Aufträge per Zuruf erteilt werden. Mit einer Auftragsbestätigung und dem kaufmännischen Bestätigungsschreiben können Freiberufler den Vertrag formell festklopfen.
Mit diesen beiden Arten der Bestätigung unterscheiden Juristen, ob mit dem Schreiben ein Vertrag erst zustande kommt (Auftragsbestätigung) oder ob ein bereits geschlossener Vertrag bestätigt wird (kaufmännisches Bestätigungsschreiben). Im geschäftlichen Alltag ist diese Abgrenzung allerdings häufig nur schwer zu ziehen. Vieles, was im Geschäftsalltag als Auftragsbestätigung bezeichnet wird, ist juristisch betrachtet eher ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Fakt ist: Auf die Bezeichnung der Vereinbarung kommt es nicht an. Sie können also auch ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben als »Auftragsbestätigung« benennen. Die Unterscheidung zwischen den beiden Formen wird dann wichtig, wenn das Schriftliche vom mündlich Besprochenen abweicht. Denn beim kaufmännischen Bestätigungsschreiben wird davon ausgegangen, dass der (bereits geschlossene) Vertrag mit dem Inhalt des Bestätigungsschreibens übereinstimmt. Widerspricht die andere Seite dem Schreiben nicht unverzüglich, gilt der Vertrag. Ausnahme: Der Absender des Schreibens hat das vertraglich Vereinbarte bewusst und mutwillig falsch wiedergegeben. Übrigens: Kaufmännische Bestätigungsschreiben dürfen Sie nur anderen Unternehmern schicken. Bei Privatleuten gelten besondere Verbraucherschutzrechte.
Ob kaufmännisches Bestätigungsschreiben oder Auftragsbestätigung: Ihre Vereinbarung sollte folgende Punkte enthalten:
Bezug auf Gespräch oder Korrespondenz mit dem Kunden (Telefonat, E-Mail-Korrespondenz etc.),
Titel des Projekts,
Arbeitsauftrag, Thema und gegebenenfalls Bezug auf Briefing,
Umfang,
Liefertermin,
vereinbartes Honorar und Fälligkeit,
die eigenen Kontaktdaten.
Die Vorlage für eine Auftragsbestätigung können Sie in meinem Blog http://www.steuer-saetze.de herunterladen.
Falls individuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) vorhanden sind, müssen diese in den Vertrag ausdrücklich einbezogen werden. Sie können diese beifügen oder auf den entsprechenden Link im Internet verweisen. AGB bieten den Vertragspartnern die Möglichkeit, gesetzliche Regelungen entweder auszuschließen oder zu verändern – natürlich nur dann, wenn es sich nicht um zwingende, allgemeingültige Vorschriften handelt. Da die gesetzlichen Bestimmungen allerdings in der Regel recht vorteilhaft für Freiberufler ausfallen, müssen nicht unbedingt eigene AGB formuliert werden. Wer individuelle AGB wünscht, sollte sich aber in keinem Fall auf Schablonen oder Mustervorlagen aus dem Internet verlassen, sondern anwaltlichen Rat einholen. Denn auch für AGB existiert ein gesetzlicher Rahmen – wer gegen diese Vorschriften verstößt, muss mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen rechnen.
In jedem Vertrag sollte ein Passus enthalten sein, der die Fälligkeit der Rechnungen regelt. Ein solches Zahlungsziel entscheidet später über den möglichen Verzug eines nicht zahlenden Kunden – und damit auch über Zinsen. Nach dem Gesetz ist ein Schuldner zwar, sofern er ein Unternehmen ist, nach Ablauf von 30 Tagen nach Fälligkeit der Forderung und Erhalt der Rechnung automatisch in Verzug. Aber bei Verbrauchern gilt diese Regel nur, wenn bei Vertragsabschluss ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Hier hilft ein Passus in der Rechnung, etwa: »Sie geraten spätestens 30 Tage nach Erhalt dieser Rechnung in Verzug (§ 286 Abs. 3 BGB)«. Dazu kommt, dass kürzere Zahlungsziele als das gesetzliche in jedem Fall bereits bei Vertragsabschluss festgehalten werden müssen.
Mehr Informationen zum Thema »Forderungsmanagement« finden Sie in Kapitel 5.
Nehmen Sie also in Ihre Auftragsbestätigung einen Passus auf, in dem steht, wann das Honorar fällig ist – zum Beispiel 14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Der Kunde muss dieses frühere Zahlungsziel bereits mit Vertragsabschluss kennen. Auf der Rechnung können und müssen Sie dann später genau diese Zahlungsfrist angeben.
Zahlungsverzug
Das »Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr« legt beschränkte Zahlungsfristen für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber fest. Die Vorschriften gelten ausschließlich für Forderungen von Unternehmern gegen andere Unternehmer oder öffentliche Auftraggeber. Demnach sind Rechnungen im Prinzip sofort fällig. Ist der Schuldner ein Unternehmen, darf die Frist auf bis zu 60 Tage verlängert werden; für öffentliche Auftraggeber werden die Fristen auf 30 Tage begrenzt. Fristen über diesen Rahmen hinaus sind nur noch wirksam, wenn sie zum einen ausdrücklich vereinbart werden und zum anderen mit Blick auf die Belange des Gläubigers nicht »grob unbillig« sind.
Mit dem Gesetz wurden außerdem begrenzte Überprüfungs- und Abnahmefristen festgelegt. Darüber hinaus ist der Verzugszinssatz auf 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz angehoben worden. Im Gesetz vorgeschrieben ist die Verzugsschadenspauschale in Höhe von 40 Euro – eine Summe, die Kosten für das interne Forderungsmanagement, mögliche Rechtsberatung und andere Auslagen decken soll. Haben Sie nachweislich höhere Kosten, dürfen Sie diese in Rechnung stellen.
Rechnung – aber richtig!
Ist der Auftrag erledigt, können Sie die Rechnung schreiben. Dafür gibt es keine einheitliche Vorlage. Als Rechnung gilt jedes Dokument, mit dem Unternehmer eine Lieferung oder Leistung abrechnen – egal, wie das Dokument bezeichnet wird. Eine Rechnung kann auch aus mehreren Dokumenten bestehen. Bei Geschäften zwischen Unternehmern sind Sie verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach der Leistung eine Rechnung auszustellen. Ausnahmen davon gibt es nur dann, wenn die erbrachte Leistung von der Umsatzsteuer befreit ist. Dies betrifft Leistungen nach § 4 Nr. 8 bis 28 des Umsatzsteuergesetzes, wenn sie nach 2008 erbracht worden sind. Aber Achtung: Trotzdem können Sie verpflichtet sein, aus zivilrechtlichen Gründen eine Abrechnung zu erstellen.
Mehr Informationen zum Thema »Umsatzsteuerbefreiung« finden Sie in Kapitel 2.
Aufbewahrungsfristen für Privatleute
Schreiben Sie Privatleuten eine Rechnung über Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken – etwa über planerische Leistungen oder Bauüberwachung –, müssen Sie diese darauf hinweisen, dass Verbraucher solche Rechnungen zwei Jahre lang aufbewahren müssen. Dazu eignet sich beispielsweise folgende Formulierung:
»Als Privatperson sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt am 31. Dezember des Jahres, in dem diese Rechnung ausgestellt wurde.«
Darüber hinaus müssen bei Rechnungen einige Formvorschriften beachtet werden. Dabei wird unterschieden zwischen
Pflichtangaben für Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro und
Pflichtangaben für alle Rechnungen mit einem höheren Betrag.
Warum ist eine korrekte Rechnung wichtig?
Die Vorschriften für Rechnungen sind vor allem für den Vorsteuerabzug entscheidend. Das bedeutet: Nur mit einer korrekten Rechnung kann derjenige, der die Rechnung bezahlt, die darin enthaltene Umsatzsteuer beim Finanzamt geltend machen. Enthält eine Rechnung nicht die vorgeschriebenen Elemente, kann der Rechnungsempfänger keinen Vorsteuerabzug geltend machen. Tut er es trotzdem und kommt später eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung ins Haus, wird der Vorsteuerabzug rückwirkend aberkannt.
Bei Rechnungen über 250 Euro sind die Formalien umfangreich. Folgende Punkte müssen enthalten sein:
Mehr Informationen zum Thema »Vorsteuerabzug« finden Sie in Kapitel 2.
Name und Adresse des leistenden Unternehmers
Name und Anschrift müssen vollständig aufgeführt werden. Bei Personengesellschaften oder einer GmbH muss der Name der Gesellschaft in der Rechnung stehen.
Name und Adresse des Kunden
Hier gilt das Gleiche wie bei Ihrer Adresse. Eine Großkundenadresse mit eigener Postleitzahl oder ein Postfach können jedoch die Anschrift ersetzen. Vorsicht: Es reicht nicht aus, die Rechnung an einen Dritten mit dem Zusatz »c/o« zu addressieren.
Steuernummer des leistenden Unternehmens
Hier gehört die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST-ID) hin. Freiberufler, die für ihr Unternehmen eine Steuernummer erhalten haben, die von der der Privatperson abweicht, müssen diese auf ihren Rechnungen aufführen. Wer keine separate Steuernummer fürs Unternehmen hat und sich scheut, seine private Steuernummer auf der Geschäftskorrespondenz zu veröffentlichen, kann eine USt-ID beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen. Sie kostet nichts und kann online beantragt werden.
Ausstellungsdatum
Fortlaufende Rechnungsnummer
Dieser Punkt hat in den vergangenen Jahren unter Freiberuflern und anderen Selbstständigen für viel Verwirrung gesorgt. Wichtig ist, dass durch die Nummer klar wird, dass die Rechnung einmalig ist. Die Rechnungsnummer darf also nicht zweimal verwendet werden. Alles andere bleibt dem Unternehmer überlassen. »Fortlaufend« bedeutet also weder lückenlos noch der Reihe nach. Möglich ist zum Beispiel eine Kombination aus Jahreszahl und Rechnungsnummer, also beispielsweise »07023« für die siebte Rechnung im Jahr 2023. Denkbar ist auch eine Kombination mit Kundennummern oder Kundenabkürzungen.
Menge und handelsübliche Bezeichnung der Lieferungoder Leistung
Allgemeingültige Aussagen, wann eine Bezeichnung »handelsüblich« ist, sind laut Bundesfinanzministerium nicht möglich. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs veröffentlichte das Ministerium im Dezember 2021 ein Schreiben, in dem die Details festgelegt sind. Demnach muss immer im Einzelfall entschieden werden. Die Leistung muss aber leicht nachprüfbar sein: Die Angaben müssen »eine eindeutige Identifizierung der abgerechneten Leistungen ermöglichen. Der Umfang und die Art der erbrachten Dienstleistungen sind zu präzisieren, dies bedeutet jedoch nicht, dass die konkreten erbrachten Dienstleistungen erschöpfend beschrieben werden müssen.« (BMF-Schreiben III C 2 - S 7280-a/19/10002:001) Bezeichnungen allgemeiner Art – etwa »Beratungsleistungen« – reichen hier nicht aus. Sind Abkürzungen oder Verweise auf Gebühren- oder Honorarordnungen dem Auftraggeber bekannt, dürfen diese aber in der Rechnung verwendet werden. Außerdem darf in der Rechnung auf andere Geschäftsunterlagen verwiesen werden. Diese müssen der Rechnung nicht zwingend beiliegen, müssen aber genau benannt werden.
Zeitpunkt/Zeitraum der Leistung
Die Angabe des Kalendermonats reicht in aller Regel aus. Steht der genaue Liefer- oder Leistungstermin noch nicht fest, muss der voraussichtliche Termin angegeben werden. Entscheidend ist hier, wann eine Leistung als ausgeführt gilt: Bei sonstigen Leistungen, wie sie Freiberufler häufig erbringen, ist der Zeitpunkt grundsätzlich durch die Abnahme des Kunden definiert. Bei Abschlagszahlungen muss der Leistungszeitpunkt nicht angegeben werden, da er ja noch nicht feststeht. Allerdings muss aus der Rechnung klar hervorgehen, dass hier eine noch nicht erbrachte Leistung abgerechnet wird. Kennen Sie den Zeitpunkt schon, zu dem das Geld vereinnahmt wird, müssen Sie diesen ebenfalls angeben. Außerdem muss es später eine zusammenfassende Schlussrechnung geben, welche die Gesamtrechnung, Angaben über sämtliche Abschläge sowie die verbliebene Restforderung enthält. Auch die gesamte zu zahlende Umsatzsteuer sowie der bereits gezahlte Steueranteil und der noch offene Steuerbetrag müssen hier zu finden sein.
Nettoentgelt
Wenn die Leistungen unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen unterliegen oder zum Teil von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen die einzelnen Positionen aufgeschlüsselt werden. Ansonsten genügt ein Nettobetrag.
Vereinbarte Entgeltsminderung
Darunter sind Skonto-, Rabatt- oder Bonus-Vereinbarungen zu verstehen, die vorab getroffen wurden. Hier reicht ein Hinweis wie »Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen«. Beim Skonto muss lediglich die Prozentzahl angegeben werden und nicht der konkrete Betrag.
Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag (so man umsatzsteuerpflichtig ist)
Falls es sich um mehrere Leistungen handelt, die demselben Umsatzsteuersatz unterliegen, dürfen Sie erst einmal die Gesamtsumme bilden und darauf den Steuersatz ermitteln und ausweisen.
Übrigens: Wenn Sie Leistungen abrechnen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen Sie keine Paragrafen zitieren. Es reicht aus, wenn Sie – umgangssprachlich formuliert – den Grund für die Befreiung nennen.
Mehr Informationen zum Thema »7 oder 19 Prozent Umsatzsteuer« finden Sie in Kapitel 2.
Bei Freiberuflern, welche die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, ist ein Hinweis auf die Regelung zwar nicht verpflichtend, aber doch sinnvoll.
Denn sonst kommt es möglicherweise zu Zahlungsverzögerungen, da der Rechnungsempfänger nicht sofort weiß, warum keine Umsatzsteuer erhoben wird – und ob dies so in Ordnung ist. Wenn Sie also die Kleinunternehmerregelung anwenden, versehen Sie Ihre Ausgangsrechnungen einfach mit der Standardformulierung: »Umsatzsteuer
Mehr Informationen zum Thema »Kleinunternehmerregelung« finden Sie in Kapitel 2.
Abbildung 1.1: Beispielrechnung
wird nicht erhoben, da die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG angewendet wird«. Wenn Sie den Begriff »Kleinunternehmer« vermeiden wollen, reicht folgender Satz: »Gemäß § 19 UStG enthält der Rechnungsbetrag keine Umsatzsteuer.«
Susanne Christ, Fachanwältin für Steuerrecht, Köln
»Auch Verträge über dauerhaft erbrachte Leistungen sind Rechnungen! Das gilt für gewerbliche Mietverträge ebenso wie für Verträge über laufende Beratung oder Wartungsverträge. Achten Sie bei Verträgen und Rechnungen, die Sie über dauerhaft erbrachte Leistungen erhalten, auf die Pflichtangaben, damit Ihnen der Vorsteuerabzug erhalten bleibt. Das gilt vor allem für die Steuernummer – und für die fortlaufende Rechnungsnummer.«
Selbst wenn es nicht von den Finanzbehörden vorgeschrieben ist: Vergessen Sie nicht, Ihre Bankverbindung auf all Ihren Rechnungen anzugeben. Ohne die IBAN und BIC-Daten ist es schwierig, Honorarforderungen einzutreiben.
Ein besonderer Fall der Rechnung ist die Gutschrift. Denn es gibt Situationen, in denen Freiberufler nicht selbst eine Rechnung über ihre Leistungen schreiben, sondern vom Auftraggeber eine Gutschrift erhalten. Die Abrechnung per Gutschrift muss allerdings zuvor vereinbart worden sein. Widerspricht der leistende Unternehmer einer Gutschrift, gilt sie nicht mehr als Rechnung. Ein Beispiel: Ein Journalist arbeitet für einen Zeitschriftenverlag. Abgerechnet wird nach Seitenpreisen. Da aber noch nicht klar ist, wie viel Text nach Einbau von Fotos und Anzeigen auf eine Seite passt, rechnet der Verlag am Ende die gedruckten Seiten ab. Danach erstellt die Verlagsbuchhaltung eine Gutschrift für den freiberuflichen Journalisten. Für eine solche Gutschrift sind die gleichen Pflichtangaben vorgeschrieben wie für eine Standardrechnung. Denken Sie also beispielsweise daran, Ihrem Kunden in solchen Fällen Ihre Steuernummer mitzuteilen.
Bei Kleinbetragsrechnungen ist der Gesetzgeber nicht so streng. Trotzdem müssen bei Rechnungen bis zu einem Betrag von 250 Euro folgende Elemente enthalten sein:
vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmers,
Ausstellungsdatum,
Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Leistungen,
Bruttobetrag in einer Summe (Nettobetrag zzgl. Umsatzsteuer),
anzuwendender Umsatzsteuersatz,
Hinweis auf Steuerbefreiung bei steuerfreien Umsätzen.
Es ist also nicht unbedingt erforderlich, eine fortlaufende Rechnungsnummer, den Nettobetrag oder Ihre Steuernummer zu nennen. Auch auf die Adresse des Leistungsempfängers sowie den Zeitpunkt der Leistung können Sie verzichten.
Wer viele Kleinbetragsrechnungen ausstellt, greift häufig auf vorgedruckte Quittungsblöcke zurück. Das erleichtert im alltäglichen Geschäft die Buchhaltungsarbeit. Aber Vorsicht: Fehlerhafte Angaben auf Quittungsblöcken gefährden den Vorsteuerabzug. So vergessen Unternehmer manchmal, bestimmte Punkte überhaupt in den Vordruck einzutragen. Gefährlich ist es auch, den falschen Steuersatz auszuweisen – oder falsche Angaben darüber zu machen, ob der Umsatz steuerfrei ist oder nicht. So dürfen beispielsweise Kleinunternehmer oder Heilberufler mit steuerfreien Umsätzen auf dem Block keinen Steuersatz ankreuzen. Denn wer unberechtigt Umsatzsteuer ausweist, schuldet diese dem Finanzamt. Streichen Sie also auf den Formularen den Zusatz »inkl. 19% MwSt« oder »inkl. 7% MwSt«. Besser noch: Setzen Sie auf maschinelle Quittungen.
Achtung: Der Grenzbetrag von 250 Euro bezieht sich auf den Bruttobetrag einschließlich möglicher Umsatzsteuer.
Die Erleichterungen für Kleinbetragsrechnungen gelten auch für Fahrkarten – zum Beispiel Zugtickets oder U-Bahn-Fahrscheine. Hier genügen
der vollständige Name und die Anschrift des Beförderungsunternehmens,
das Rechnungsdatum,
das Entgelt plus Umsatzsteuerbetrag in einer Summe,
der anzuwendende Steuersatz sowie
bei Flugscheinen Hinweise auf eine mögliche grenzüberschreitende Beförderung.
Für den Vorsteuer-Abzug braucht es normalerweise das Originalticket. Bei Online-Fahrausweisen und Online-Flugtickets gelten jedoch Sonderregeln. Für die Finanzverwaltung ist es hier in Ordnung, wenn der Fahrausweis im Online-Verfahren abgerufen und ein Kunden- oder Kreditkartenkonto belastet wird. Allerdings müssen Sie einen Papierausdruck des abgerufenen Dokuments aufbewahren.
Muss ich meine Rechnungen unterschreiben?
In aller Regel müssen Rechnungen nicht unterschrieben werden, es sei denn, Sie sind Rechtsanwalt oder Steuerberater. Manch einer warnt sogar, dass der Empfänger einen Stempel mit der Aufschrift »Betrag dankend erhalten« über die Unterschrift setzen könnte. Trotzdem: Eine Rechnung wirkt persönlicher und wirkungsvoller als Schlusspunkt eines Auftrags, wenn sie in Form eines Geschäftsbriefs verfasst wird. Neben den Pflichtangaben ist es daher durchaus empfehlenswert, den Kunden persönlich anzusprechen, sich für den Auftrag und die Zusammenarbeit zu bedanken und den Geschäftsbrief mit Grüßen zu beenden und zu unterschreiben. Der persönliche Eindruck macht auch hier den Unterschied.
Fehlerhafte Rechnung: Was nun?
Nur selten überprüfen Freiberufler ihre Eingangsrechnungen auf Punkt und Komma – und werfen einen Blick darauf, ob alle Pflichtangaben enthalten sind. Dabei können sie hier viel Geld verlieren. Denn wenn sich das Finanzamt bei einer Betriebsprüfung die Rechnungen früherer Jahre vornimmt, kommen Flüchtigkeitsfehler teuer zu stehen. Der Betroffene muss die Vorsteuer, die er zu Unrecht von seiner eigenen Umsatzsteuerlast abgezogen hat, plus Zinsen zurückzahlen. Machen Sie es sich daher zur Gewohnheit, Ihre Eingangsrechnungen auf die vorgeschriebenen Pflichtangaben zu überprüfen.
Eine Checkliste zur Kontrolle Ihrer Eingangsrechnungen finden Sie in meinem Blog http://www.steuer-saetze.de
Im Tagesgeschäft kommt es unter Umständen auch vor, dass Sie selbst eine Rechnung berichtigen müssen – zum Beispiel, weil sie nicht alle Angaben enthält oder einzelne Angaben unzutreffend sind. Prinzipiell müssen Sie nur die fehlenden oder fehlerhaften Angaben korrigieren – in einem Dokument, das eindeutig auf die Rechnung Bezug nimmt. In der Praxis ist es aber ratsam, eine komplett neue Rechnung zu schreiben, damit keine weiteren Fehlerquellen entstehen.
Wann die Korrektur wirkt
Eine Rechnungsberichtigung setzt laut Bundesfinanzhof voraus, dass es eine erstmalige Rechnung gegeben hat. Diese Regelung wiederum wirkt sich nach Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs so aus, dass eine Berichtigung auf den Zeitpunkt zurückwirkt, zu dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Der Bundesfinanzhof ist dieser Ansicht gefolgt und hält demnach an seiner früheren Rechtsprechung nicht mehr fest (Az. V R 26/15). Bislang waren die Münchner Richter davon ausgegangen, dass die Vorsteuer aus einer berichtigten Rechnung erst im Besteuerungszeitraum der Berichtigung abgezogen werden konnte. Allerdings muss für eine Berichtigungsmöglichkeit das vorgelegte Dokument die Mindestvoraussetzungen einer Rechnung enthalten – etwa den Aussteller, das Entgelt und einen gesonderten Steuerausweis.
Schreiben Sie also – unter der „alten” Rechnungsnummer – eine berichtigte Rechnung mit allen Pflichtangaben. Ergänzen Sie Ihre korrigierte Rechnung unbedingt um einen Hinweis auf die Rechnungsberichtigung. Als Musterklausel für eine Rechnungsberichtigung können Sie eine Formulierung wie diese verwenden: