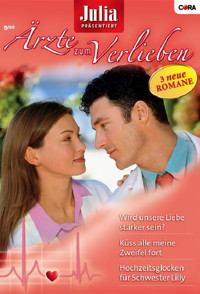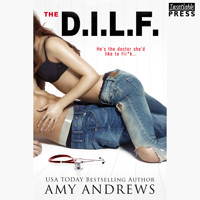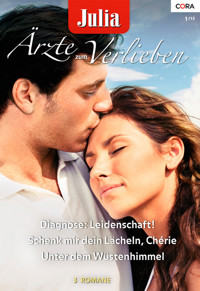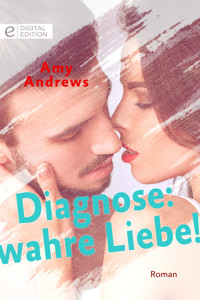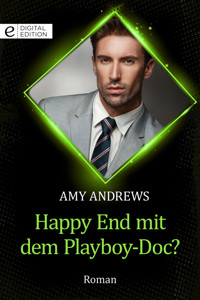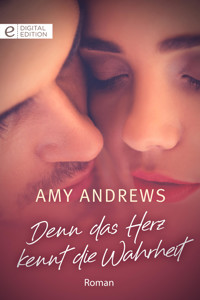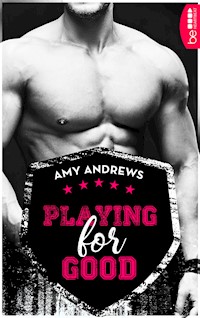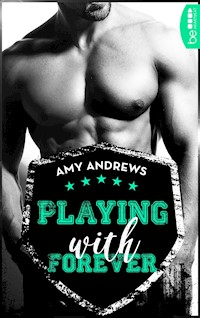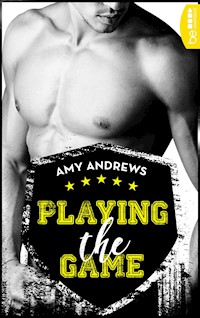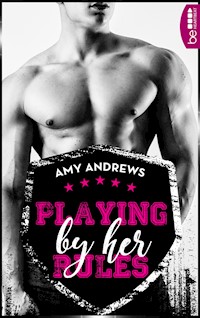2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Deutsch
Seine ozeanblauen Augen erregten Lady Mary. Pirat oder nicht, Vasco Ramirez war ein Prachtexemplar von Mann und brachte jede Faser ihres Körpers zum Prickeln …Seufzend klappt Stella ihr Laptop zu. Mit "Piratenherz" hatte sie einen Bestseller gelandet, aber die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung will ihr einfach nicht gelingen. Da taucht Rick auf, ihr Freund aus Kindertagen. Schon damals war ihr Lieblingsspiel Pirat und Meerjungfrau. Nun lädt er sie auf seine Segeljacht ein: zu einer Schatzsuche! Können Stellas süße Küsse Rick zeigen, dass ihre Liebe wertvoller ist, als alle Schätze der Welt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Amy Andrews
Freibeuter der Liebe
IMPRESSUM
JULIA erscheint in der Harlequin Enterprises GmbH
© 2012 by Amy Andrews Originaltitel: „The Devil and the Deep“ erschienen bei: Mills & Boon Ltd., London in der Reihe: RIVA Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe JULIABand 122013 - 2013 by Harlequin Enterprises GmbH, Hamburg Übersetzung: Juliane Zaubitzer
Fotos: Wavebreakmedia / mauritius images
Veröffentlicht im ePub Format in 05/2013 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-95446-518-7
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, ROMANA, HISTORICAL, MYSTERY, TIFFANY, STURM DER LIEBE
CORA Leser- und Nachbestellservice
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an! Sie erreichen den CORA Leserservice montags bis freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr:
CORA Leserservice
Telefon
01805 / 63 63 65*
Postfach 1455
Fax
07131 / 27 72 31
74004 Heilbronn
* 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz
www.cora.de
PROLOG
Lady Mary Bingham hatte in den zwanzig Lenzen ihres jungen Lebens noch nie so ein Prachtexemplar der männlichen Spezies zu Gesicht bekommen wie den Mann, der jetzt die Hand ausstreckte, um ihr an Bord zu helfen. Pirat oder nicht, Vasco Ramirez brachte jede Faser ihres Körpers zum Prickeln. Seine strahlend blauen Augen, von derselben Farbe wie der tropische Ozean, der die Riffe umsäumte, berührte etwas in ihr, von dessen Existenz sie bislang nichts geahnt hatte.
Dessen Existenz sie jedoch nicht länger leugnen konnte.
Hätte sie zu Ohnmachten geneigt, wäre dies wohl ein passender Moment gewesen. Doch sie fand die Gepflogenheit ermüdend und erlaubte sich nicht einmal weiche Knie. Frauen, die ständig hysterische Anfälle hatten und alle zwei Sekunden nach Riechsalz verlangten – wie ihre Tante –, waren für sie keine Vorbilder.
Ihr stockte der Atem, während Vasco Ramirez mit seinen schönen, von dunklen Wimpern umrahmten Augen unverhohlen jeden Zentimeter ihres Körpers studierte. Als er den Blick wieder auf ihr Gesicht richtete, bestand kein Zweifel, dass ihm gefiel, was er gesehen hatte. Mit dem Daumen strich er sanft über die Haut auf ihrem Unterarm, und sie erschauerte.
In sein sonnengebräuntes, exotisches Gesicht blickend, wusste sie, dass sie Angst haben sollte. Offenbar war sie vom Regen in der Traufe gelandet.
Doch seltsamerweise hatte sie keine Angst.
Nicht einmal, als sein Blick auf die milchweiße Haut fiel, wo ihr Puls wild gegen ihren Hals schlug. Oder tiefer, wo ihre Brüste gegen den engen Stoff ihres Mieders drängten. Es löste keine Angst in ihr aus, dass er ihren Busen, der sich aufgeregt hob und senkte, so eingehend betrachtete – doch was es in ihr auslöste, bot durchaus Grund zur Angst.
Ihr Onkel, der Bischof, hätte ihn als Handlanger des Teufels bezeichnet. Ein Mann, der unschuldige Damen zur Sünde verführte, doch seltsamerweise war sie zum ersten Mal in Versuchung. Der Gedanke war prickelnd, und sie sog scharf die Luft ein, verärgert, dass dieser Freibeuter so eine bestürzende Wirkung auf sie hatte.
Schließlich war er ein Pirat wie jeder andere.
Empört blickte Mary auf seinen Daumen. „Lassen Sie mich sofort los“, befahl sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Ramirez’ Lächeln war mindestens so charmant wie unverschämt. „Wie Sie wünschen“, murmelte er. Er beugte sich über ihre Hand, sodass sie seinen Atem an den zarten Knochen ihres Handgelenks und ihrer Handinnenfläche spürte, fuhr mit den Fingern an den blauen Adern ihres Unterarme entlang und gab sie frei.
Lady Mary schluckte. „Ich bestehe darauf, dass Sie mich umgehend zu meinem Onkel zurückbringen.“
Vasco bewunderte ihren Schneid. Das Mädchen, das kaum dem Teenageralter entwachsen war, mochte ihm fest in die Augen schauen, doch er konnte ihre Angst riechen, wie es nur ein Veteran hunderter Beutezüge auf offener See vermochte.
Der Herr allein wusste, wie es ihr in den zwei Tagen ergangen sein mochte, die sie sich in der Gewalt von Juan del Toro und seiner Mannen befunden hatte. Doch etwas sagte ihm, dass dieses verwöhnte englische Fräulein sich zu wehren wusste.
Und für Jungfrauen gab es auf den Sklavenmärkten viel Geld.
„Wie Sie wünschen“, wiederholte er.
Argwöhnisch verengte Mary den Blick. „Sie kennen meinen Onkel? Wissen Sie, wer ich bin?“
Er lächelte. „Sie sind Lady Mary Bingham. Der Bischof hat mich beauftragt, Sie zu … Sie zu finden.“
Zum ersten Mal seit zwei Tagen sah Mary ein Ende des Albtraums, der mit ihrer Verschleppung vor achtundvierzig Stunden unten am Kai begonnen hatte, und fast wäre sie auf den feuchten Planken zu seinen Füßen gesunken. Sie hatte ihre Entführer von Sklavenmärkten reden hören und sich zu Tode gefürchtet.
Doch leider gehörte sich für eine junge Dame aus gutem Hause nicht, einem Piraten zu Füßen sinken, selbst wenn er im Auftrag ihres Onkels handelte. „Danke“, sagte sie höflich. „Ich bin Ihnen zutiefst dankbar für ihre schnelle Hilfe. Juan del Toros Männer wissen nicht, wie man eine Dame behandelt.“
„Danken Sie mir nicht zu früh, Lady Bingham.“ Er lächelte stählern. „Es liegen viele Meilen zwischen hier und Plymouth, und am Ende kümmert es meine Männer vielleicht weniger, dass Sie eine Dame sind, und vielmehr, dass Sie eine Frau sind.
Arrogant zog Mary die Augenbrauen hoch, in der Hoffnung, über ihren rasenden Puls hinwegzutäuschen. „Und Sie würden Ihrer Mannschaft so ein Verhalten durchgehen lassen?“
Vasco lächelte charmant, und sein dunkles, verstrubbeltes Haar ließ ihn aussehen wie den Teufel höchstpersönlich. „Meiner Mannschaft natürlich nicht, Lady Bingham. Aber Kapitäne genießen gewisse Privilegien …“
Seufzend schloss Stella Mills das Dokument in ihrem PC und ließ das abenteuerliche achtzehnte Jahrhundert hinter sich, um ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Sie konnte die Worte, die ihr vergangenes Jahr mühelos aus der Feder geflossen waren und sie über Nacht zur Bestsellerautorin gemacht hatten, immer wieder lesen, doch das änderte nichts an den Tatsachen: Ein einziges Buch machte noch längst keinen Schriftsteller.
Egal wie viele Verlage einander bei Piratenherz überboten hatten, egal auf wie viele Bestsellerlisten sie es geschafft und egal wie viel Fanpost sie bekommen hatte oder wie viel Geld für die Filmrechte.
Egal wie verrückt die Leser nach Vasco Ramirez waren.
Sie wollten mehr.
Und der Verlag auch.
Stella starrte auf den blinkenden Cursor auf der leeren Seite. Derselbe blinkende Cursor, den sie jetzt schon seit fast einem Jahr anstarrte.
Oh, Gott. „Ich bin eine Eintagsfliege“, stöhnte sie und ließ den Kopf auf die Tastatur sinken.
Ein Klopfen an der Tür verhinderte, dass sie vor Selbstmitleid zerfloss. Sie hob den Kopf. Mehrere Zeilen Buchstabensalat starrten ihr entgegen.
Wieder ein Klopfen, energischer als das letzte. „Ich komme“, rief sie und tat, was sie seit einem Jahr jeden Tag tat – sie löschte den Text.
Während sie zur Tür eilte, klopfte es ein drittes Mal. „Okay, okay, ist ja gut“, sagte sie, riss die Tür auf – und blickte in strahlend blauen Augen von derselben Farbe wie der warme, tropische Ozean. Sie blinzelte. „Rick?“
„Stella“, murmelte er und beugte sich vor, um ihr einen Kuss auf die eine, dann auf die andere Wange zu drücken.
Stella schloss kurz die Augen, während der Duft von Meeresluft und Salzwasser ihre Sinne benebelte, wie immer, wenn sie Riccardo Granville so nah war. Als sie die Augen wieder aufschlug, tauchte ihre Mutter hinter Rick auf. Ihre Augen waren gerötet, und sie kaute nervös an ihrer Unterlippe.
Ihre Mutter wohnte in London, und Ricks Heimat war das Meer. Warum waren sie hier? In Cornwall. Zusammen?
Stella überkam ein ungutes Gefühl.
„Was ist los?“, wollte sie wissen, und das Blut rauschte ihr in den Ohren wie ein reißender Sturzbach, als sie von einem zum anderen blickte.
Ihre Mutter trat auf sie zu und umarmte sie. „Liebling“, murmelte sie, „es geht um Nathan.“
Stella blinzelte. Ihr Vater?
Sie blickte über die Schulter ihrer Mutter in Ricks betrübtes Gesicht. „Rick?“, fragte sie, in der Hoffnung auf irgendetwas, das sie vor dem Abgrund zurückhielt, an dessen Rand sie balancierte.
Rick blickte auf die Frau herab, die er fast sein ganzes Leben kannte, und schüttelte traurig den Kopf. „Es tut mir leid.“
1. KAPITEL
Sechs Monate später …
Noch immer blinkte der Cursor auf derselben leeren Seite. Auch wenn es Stella eher so vorkam, als würde er spöttisch blinzeln.
Es gab keine Worte. Keine Story.
Keine Figuren in ihrem Kopf. Keine Handlung, die wie ein Film vor ihrem inneren Auge ablief. Keine brillanten Dialogfetzen, die zu Papier gebracht werden wollten.
Nur Stille.
Und obendrein Trauer.
Und gleich würde Diana kommen.
Prompt verkündete ein Klopfen an der Tür die Ankunft von Stellas bester Freundin. Normalerweise wäre sie aufgesprungen, um Diana zu begrüßen, aber heute nicht. Einen Moment lang erwog sie sogar, die Tür überhaupt nicht zu öffnen.
Heute kam Diana nicht als ihre Freundin.
Heute kam Diana im Auftrag des Verlags.
Und Stella hatte ihr das erste Kapitel versprochen …
„Ich weiß, dass du da drin bist. Soll ich etwa die Tür eintreten?“
Die Stimme klang gedämpft, aber entschlossen. Sich ihrem Schicksal ergebend, durchquerte Stella das Zimmer – von ihrem Arbeitsbereich in der Fensternische mit dem spektakulären Hundertachtzig-Grad-Blick auf die zerklüftete kornische Küste bis zur Haustür. Nachdem sie tief Luft geholt hatte, schob sie den Riegel zurück und öffnete.
Diana breitete die Arme aus. „Süße“, murmelte sie und drückte Stella so fest an sich, dass diese kaum noch Luft bekam. „Wie geht es dir? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.“
Stella war plötzlich so froh, ihre Freundin zu sehen, dass ihr die Tränen kamen. Sie kannten sich erst seit der Uni, aber Diana hatte seit der Beerdigung fast jeden Abend angerufen und kam regelmäßig vorbei.
„Nicht so besonders“, gestand sie, an Dianas Schulter gelehnt.
„Natürlich nicht.“ Diana strich ihr tröstend über den Rücken. „Dein Vater ist gestorben, das ist ganz normal.“
Diana wusste, wovon sie sprach: Ihre Eltern waren gestorben, kurz bevor die Freundinnen sich kennengelernt hatten.
„Ich will mich aber nicht so fühlen.“
Diana drückte sie noch fester. „Das geht vorbei. Irgendwann. Solange musst du tun, was du tun musst. Und ich denke, wir fangen mit einem schönen Glas Rotwein an.“
Diana hielt die Flasche Shiraz hoch, die sie in Penzance gekauft hatte, auf dem Weg zu dem windumtosten Cottage auf den Klippen, in dem ihre Freundin allein wohnte, seit ihr verklemmter Verlobter Dale die Flucht ergriffen hatte, weil er mit dem Erfolg von Piratenherz nicht klarkam.
Natürlich behauptete Stella, dass die spektakuläre Küste sie beim Schreiben inspirierte, doch da noch immer kein neuer Roman vorlag, kaufte Diana ihr das nicht ab.
Stella sah auf die Uhr und lachte zum ersten Mal an diesem Tag. Es war zwei Uhr nachmittags. „Ein bisschen früh, findest du nicht?“
Diana schnalzte missbilligend mit der Zunge. „Ach was, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Außerdem ist November, es ist praktisch schon dunkel.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, zog Diana ihren Rollkoffer ins Haus und trat die Tür mit den zehn Zentimeter hohen Absätzen ihrer Stiefel hinter sich zu. Dann streifte sie den wadenlangen, figurbetonten Ledermantel und ihren Louis-Vuitton-Schal ab – alles ohne die Flasche abzustellen – und darunter kamen eine dunkelgraue Hose und ein hellrosa Kaschmir-Pullover zum Vorschein, der perfekt zu ihren vollen, glänzenden dunklen Locken passte.
Diana war typisch London.
Stella sah an sich hinunter und kam sich furchtbar schlampig vor. Graue Jogginghose, ein mit Kaffee bekleckerter Kapuzenpullover und flauschige Schlappen. Ein achtlos gebundener Pferdeschwanz.
Stella war typisch einsiedlerische Schriftstellerin.
Was ja ganz romantisch gewesen wäre, wenn sie in den letzten achtzehn Monaten etwas geschrieben hätte.
„Setz dich“, befahl Diana, während sie Weingläser holen ging.
Stella setzte sich auf ihr rotes Ledersofa, auch um sich weniger klein vorzukommen. Stella war fast einen Meter achtzig groß und kräftig gebaut wie eine Amazone oder Wonder Woman. Sie dagegen war nur knapp über einen Meter fünfzig, blond und pummelig.
„Da“, sagte Diana, drückte ihr ein riesengroßes Glas Rotwein in die Hand und stieß mit ihr an, bevor sie sich gegenüber auf den Schalensessel setzte. „Darauf, dass es dir bald wieder besser geht“, sagte sie und trank einen großzügigen Schluck.
„Darauf trinke ich“, stimmte Stella zu und nahm einen etwas maßvolleren Schluck. Sie starrte in die Tiefen ihres Weinglases, um dem Blick ihrer Freundin nicht zu begegnen.
„Du hast das Kapitel nicht, stimmt’s?“, fragte Diana, als das Schweigen unerträglich wurde.
Stella blickte Diana über den Rand ihres Glases an. „Nein“, gestand sie. „Tut mir leid.“
Diana nickte. „Schon gut.“
Stella schüttelte den Kopf und sprach endlich aus, was ihr auf der Seele lag, seit sie unter der Schreibblockade litt. „Was ist, wenn ich nur dieses eine Buch in mir hatte?“
Diese Angst plagte sie, seit sie ihren ersten Roman beendet hatte.
Vasco Ramirez wollte geschrieben werden. In all seiner Freibeuterpracht war er direkt aus ihrem Kopf auf die Seiten stolziert. Es war eine Freude gewesen, ein Geschenk.
Und jetzt?
Jetzt wollten die Leute einen neuen Piraten, und sie hatte keinen.
Diana hob beschwichtigend die Hand. „Unsinn“, sagte sie energisch.
„Aber wenn es doch so ist?“
Stella fürchtete das Urteil ihrer Lektorin Joy. Dass ihr nicht gefallen würde, was sie schrieb. Dass sie darüber lachen würde.
Alles war wie ein Traum gewesen – ein sechsstelliger Vorschuss, die New-York-Times – Bestsellerliste, Hollywood.
Vielleicht war es Zeit aufzuwachen?
Diana zeigte mit dem Finger auf sie. „So. Ein. Quatsch.“
Stella spürte, wie der Shiraz in ihrem Blut ihr schlechtes Gewissen noch beflügelte. Diana hatte sie von Anfang an bei ihren schriftstellerischen Ambitionen unterstützt und sie darin bestärkt, sich von ihrem Job als Lehrerin vorübergehend beurlauben zu lassen, um das verdammte Buch zu schreiben.
Sie war die Erste, die es zu lesen bekam. Die Erste, die sein Potenzial erkannte und darauf bestand, es ihrer Chefin zu zeigen, die genau das suchte, was Stella geschrieben hatte – einen saftigen historischen Liebesroman. Als Lektoratsassistentin eines Londoner Verlags war Diana überzeugt, einen Bestseller zu landen, und Stella konnte ihr Glück kaum fassen, als Dianas Prophezeiung sich bewahrheitete.
Sie lächelte ihre Freundin an, in der Hoffnung, nicht so verzweifelt zu wirken, wie sie sich fühlte. „Wirst du gefeuert, wenn du mit leeren Händen nach London zurückkommst?“
Diana schüttelte den Kopf. „Nein. Lass uns heute Abend nicht darüber reden. Heute Abend werden wir uns besinnungslos betrinken, morgen reden wir über das Buch. Einverstanden?“
Stella spürte, wie sich die Verkrampfung in ihren Schultern löste und lächelte. „Abgemacht.“
Zwei Stunden später wurde es draußen tatsächlich schon dunkel. Der Wind heulte um das Haus, rüttelte an den Fensterläden, was die beiden Frauen, die es sich vor dem Kamin gemütlich gemacht hatten, jedoch kaum bemerkten. Sie waren bei der zweiten Flasche Wein und fast am Ende einer großen Tüte Chips angelangt und lachten lauthals über alte Geschichten von der Uni.
Ein lautes Klopfen an der Tür ließ sie beide aufschrecken, dann brachen sie sofort wieder in schallendes Gelächter aus.
„Mein lieber Schwan.“ Diana fasste sich an die Brust. „Ich glaube, ich hatte gerade einen Herzinfarkt.“
Stella lachte, während sie ein wenig schwankend aufstand. „Quatsch. Rotwein ist gut fürs Herz.“
„Nicht in solchen Mengen“, widersprach Diana, und Stella brach erneut in Gelächter aus, als sie zur Tür ging.
„Warte, wo willst du hin?“, murmelte Diana und kam mühsam auf die Beine.
Stella runzelte die Stirn. „Die Tür aufmachen.“
„Und wenn es ein zweiköpfiges Ungeheuer ist?“ Trotz ihres Alkoholpegels sah Diana den Regen gegen das Fenster hinter Stellas Schreibtisch schlagen. „Das ist der Inbegriff einer finsteren stürmischen Nacht da draußen.“
Stella hatte Schluckauf. „Oh, ich wusste nicht, dass Monster anklopfen, aber ich werde es höflich bitten zu verschwinden.“
Diana fing an zu gackern, und Stella lachte noch immer, als sie die Tür öffnete.
Vor ihr stand Vasco Ramirez. In Fleisch und Blut.
Das Licht aus dem Cottage badete sein gebräuntes Gesicht, fiel auf seinen Mund und erleuchtete seine blauen Bilderbuchaugen. Sein schulterlanges Haar, ein Relikt seiner Flegeljahre, hing in feuchten Strähnen herab, und an seinen unglaublich dunklen Wimpern hatten sich Wassertropfen gesammelt.
Er glich dem Piraten bis aufs Haar.
„Rick?“ Ihr stockte der Atem. Die Erinnerung an einen verunglückten Kuss vor fast zehn Jahren flatterte wie ein Schmetterling durch ihr Gehirn.
Rick lächelte. „Was ist denn das für eine Begrüßung?“, neckte er die perplexe Stella, als er sie wie immer zur Begrüßung auf beide Wangen küsste.
Ihr Kokosduft umhüllte ihn. Nathan hatte Stella jedes Jahr zum Geburtstag Kosmetikprodukte geschenkt, die nach Kokos rochen, und sie hatte die Cremes brav benutzt. Und tat es offensichtlich noch immer.
Stella schloss die Augen und wartete darauf, dass die Engel in ihrem Kopf Halleluja sangen, während das Aroma von Salz und Meer sie umhüllte. Denn er war so perfekt, dass nur der Himmel ihn geschickt haben konnte.
Sie blinzelte, als er sich von ihr löste. „Ist alles in Ordnung?“, fragte er.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Was weder mit seinem verführerischen Dreitagebart zu tun hatte noch mit der Berührung seiner Lippen, sondern mit seinem letzten Besuch.
Rick kam nicht einfach so vorbei.
Das letzte Mal, als er unangekündigt vor ihrer Tür stand, hatte er keine guten Neuigkeiten gehabt.
„Ist Mum …?“
Rick legte die Finger an ihre Lippen. „Pst. Linda geht es gut, Stella. Alles ist gut.“
Fast wäre sie vor Erleichterung in seine Arme gesunken. Lächelnd zog er seine Hand zurück, und sie erwiderte sein Lächeln, und während der Wind um sie herum toste und der Regen ihnen ins Gesicht schlug, war es, als wären sie wieder Kinder an Bord der Persephone.
„Also doch kein Moormonster?“, unterbrach Diana den magischen Moment.
Rick blickte über Stellas Schulter in das vage vertraute Gesicht einer attraktiven Brünetten. Sie betrachtete ihn mit unverhohlener Bewunderung, und er lächelte amüsiert.
Gott, er liebte eben Frauen.
Vor allem Frauen wie diese. Unkomplizierte Frauen, die gern lachten und sich amüsierten und flirteten, ohne gleich Bedingungen zu stellen.
„Schätzchen, ich bin alles, was du willst“, versprach er vollmundig, während er sich an Stella vorbeizwängte und die Hand ausstreckte. „Hi. Rick. Ich glaube, wir sind uns schon irgendwo begegnet.“
Lächelnd schüttelte Diana seine Hand. „Ja. Auf der Beerdigung. Diana“, stellte sie sich vor.
„Ach, ja, richtig“, sagte er und versuchte, Zeit zu gewinnen. Er war so schockiert und fassungslos gewesen, so damit beschäftigt, sich um Stella und Linda zu kümmern, dass er nicht viel mitbekommen hatte. „Du arbeitest für Stellas Verlag?“
Diana lächelte, und ihre Augen blitzten. Sie schien nicht im Geringsten gekränkt, dass Rick Schwierigkeiten hatte, sich an sie zu erinnern. „Hat ja eine Weile gedauert.“
Stella beobachtete interessiert, wie ihre beste Freundin und ihr – tja, was war Rick eigentlich? Ein alter Freund der Familie? Geschäftspartner ihres verstorbenen Vaters? Der Bruder, den sie nie hatte? – locker flirteten. Warum konnte sie nicht so sein? Der einzige Mann, in dessen Gesellschaft sie sich richtig wohlfühlte, war ein von ihr erdachter Pirat.
Ein dicker Regentropfen, der ihr in den Nacken fiel, riss sie aus ihren Gedanken, und sie registrierte, dass die Tür noch immer offenstand.
„Welchem Umstand verdanken wir das Vergnügen?“, fragte sie, während sie die Tür kopfschüttelnd schloss und sich zu den Turteltauben gesellte.
Rick blickte auf Stellas süße kleine Stupsnase herab. „Na ja“, er zwinkerte ihr zu, bevor er sich wieder Diana zuwandte, „ein Vogel hat mir gezwitschert, dass hier eine Party steigt.“
Diana lachte. Sie sah Stella an. „Du hast mir nie erzählt, dass er übersinnliche Kräfte besitzt.“ Dann eilte sie in die Küche, um noch ein Glas zu holen.
Rick sah ihr nach, bevor er sich zu Stella umdrehte. Sie blickte zu ihm auf, und ein vertrautes Verlangen, sie in seine Arme zu schließen, stieg in ihm auf. „Wie geht es dir, Stella?“, murmelte er.
Für Rick war der Tod von Nathan Mills fast noch schwerer zu verkraften gewesen als der seines eigenen Vaters. Nathan war sein Vormund und Mentor gewesen, seit Anthony Granville bei einer Kneipenschlägerei ums Leben kam, als Rick sieben war.
Stella zuckte die Schultern und versank förmlich in seinem mitfühlenden Blick. Manchmal fiel es ihr schwer, den wilden Bad Boy ihrer Fantasie mit dem fleißigen, verantwortungsbewussten, verständnisvollen Mann, der vor ihr stand, unter einen Hut zu bringen.
„Ich hasse es“, flüsterte sie.
In Wahrheit hatte Stella ihren Vater nur noch selten gesehen, seit sie angefangen hatte zu studieren.
Ein flüchtiger Besuch zu Weihnachten, ab und zu in der Post ein Umschlag mit einer perfekten Muschel, die er irgendwo am Strand gefunden hatte, eine gelegentliche E-Mail mit Fotos von ihm und Rick und einem erstaunlichen Fund vom Meeresgrund.
Doch allein das Wissen, dass er da draußen war und seinem Kindheitstraum von gesunkenen Galeonen folgte, hielt ihre Welt im Gleichgewicht.
Und jetzt, seit seinem Tod, war nichts mehr, wie es einmal war.
„Ich weiß.“ Rick legte einen Arm um ihre Schulter und zog sie an seine Brust. „Ich hasse es auch.“
Und das tat er. Er hasste es zu tun, was er tat, ohne den einen Menschen an seiner Seite zu haben, der verstand warum. Er hasste es, sich umzudrehen, um etwas zu Nathan zu sagen, und er war nicht da. Er vermisste Nathans Weisheiten und seinen derben Humor.
Überwältigt von Trauer schloss Rick die Augen und genoss die Umarmung, die Vertrautheit, genoss es, wie perfekt Stella sich an ihn schmiegte, ihr Kopf genau unter seinem Kinn, ihre Wange an seiner Brust, genoss ihren Kokosduft.
Als Kinder war er der Pirat gewesen und sie die Meerjungfrau, und sie hatten sich unermüdlich Geschichten um versunkene Schätze ausgedacht, stundenlang in ihrer eigenen Welt gelebt. Das enge Band zwischen ihnen hielt bis heute.
Natürlich gab es Zeiten in ihrer Jugend, wo ihre Spiele etwas gewagter geworden waren, und obwohl nie etwas zwischen ihnen passiert war, hatten sie mit dem Feuer gespielt.
Als er sie jetzt in seinen Armen hielt, erinnerte er sich daran.
„Okay, okay, ihr beiden“, neckte Diana, als sie Rick ein Glas Rotwein in die Hand drückte. „Heute Abend wird nicht Trübsal geblasen. Das ist die Bedingung. Esst, trinkt und seid fröhlich.“
Widerstrebend wich Rick einen Schritt zurück, froh, dass Diana ihn in die Wirklichkeit zurückholte. Seit Nathans Tod hatte er viel an Stella gedacht, mehr als sonst.
Und nicht alle Gedanken waren unschuldig gewesen.
Er nahm den Wein. „Guter Plan“, befand er und stieß mit beiden Frauen an.
Stella deutete auf die Sessel, die um den Kamin standen, und sah zu, wie Rick seinen marineblauen Dufflecoat abstreifte und eine ausgetragene Jeans und ein Rollkragenpullover mit Zopfmuster zum Vorschein kamen.
Selbst an Land sieht dieser Mann aus, als gehörte er aufs Meer.
Diana machte es sich gemütlich und musterte ihn gründlich, was durch ihren Alkoholpegel erschwert wurde. „Irgendwie kommst du mir bekannt vor“, lallte sie.
Stella gefiel der Ausdruck auf dem Gesicht ihrer Freundin nicht. Sie kannte den Blick und wollte Diana bremsen.
„Ja, du kennst ihn von der Beerdigung“, sagte sie, in der Hoffnung, ihre Freundin von ihrer fixen Idee abzubringen.
Diana kniff die Augen zusammen. „Nein, nein“, meinte sie kopfschüttelnd. „Ich habe das Gefühl, als würden wir uns näher kennen.“ Schon bei der Beerdigung war er ihr irgendwie bekannt vorgekommen. Waren es die Augen? Oder sein Haar?
Rick lachte leise. „Vielleicht erinnere ich dich an deinen Großonkel Cyril?“
Diana lachte schallend, während sie an ihrem Wein nippte, und ihr Lachen klang, als würde Tinkerbell ihren Zauberstab schwingen.
Sie drohte mit dem Finger. „Netter Versuch, aber du siehst wirklich nicht aus wie irgendjemandes Großonkel.“ Erneut kniff sie die Augen zusammen und tippte sich dreimal mit dem Zeigefinger an die Nase. „Keine Sorge. Es fällt mir schon noch ein. Ich brauche nur“ – sie blickte auf ihr fast leeres Weinglas – „ein bisschen Zeit.“
Rick salutierte. „Ich bin gespannt auf das Ergebnis.“
Diana nickte. „Das solltest du auch sein.“