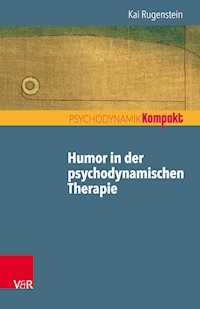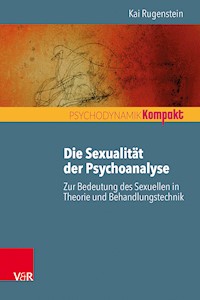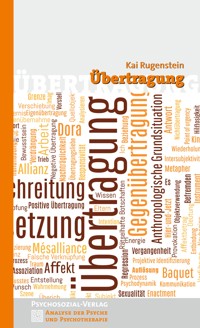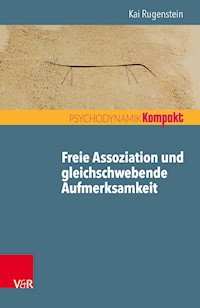
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
»Weniger hilft mehr« lautet das Prinzip der psychoanalytischen Methode. Es empfiehlt Verzicht: Frei assoziierend verzichtet der Patient auf eine Auswahl des Gesagten im Hinblick auf logische, ästhetische oder moralische Normen. Gleichschwebend aufmerksam verzichtet der Therapeut auf theoriegeleitete Hypothesenprüfung, Helfenwollen und Verstehenmüssen. Dadurch etabliert sich eine Form therapeutischer Kommunikation, deren Ziel das Gewährenlassen des Unbewussten ist. Ausgehend von Freud fragt Kai Rugenstein nach Herkunft und Zukunft dieser Methode. Er untersucht ihre Anwendung in der Praxis, ihr theoretisches Fundament, ihren interdisziplinären Bezug und ihre Lernbarkeit. Dabei wird deutlich, wie die Methode der Psychoanalyse beständig davon bedroht ist, den mit ihr erzielten Resultaten zum Opfer zu fallen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Kai Rugenstein
Freie Assoziation undgleichschwebendeAufmerksamkeit
Arbeiten mit der psychoanalytischen Methode
Mit 3 Abbildungen
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Witterndes Tier, 1930/akg-images
Bildnachweise S. 52/53 (Abb. 2): Christine Böhme, Berlin
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2566-641X
ISBN 978-3-647-99901-2
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1Einleitung: Der Weg der Analyse
2Die Grundregeln: Freie Assoziation und gleichschwebende Aufmerksamkeit
3Unterwegs zur psychoanalytischen Methode
3.1Poetik: Die Kunst des Hervorbringens
3.2Psychologie: Assoziationismus
3.3Freuds voranalytische Schriften: Der Assoziationsapparat
3.4Freuds klinische Erfahrungen: Einsicht durch Abblendung
3.5Selbstanalyse und Traumdeutung: Freiheit zum Determinismus
4Die Praxis der Methode
4.1Ein Beispiel: Herr O
4.2Rahmen: Formulierungen der Regeln
4.3Haltung: Aufnahme- und Reaktionsbereitschaft
4.4Interventionen: Wege zur Deutung
4.5Das Problem der äußeren Realität und die tiefenpsychologische Anwendung der psychoanalytischen Methode
5Reines Beobachten: Achtsamkeit und die psychoanalytische Methode
6Die Methode lernen – mit der Methode lernen: Ausbildung und Supervision
7Zusammenfassung: Zehn Prinzipien für das Arbeiten mit freier Assoziation und gleichschwebender Aufmerksamkeit
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten und Patientinnen hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 70 bis 80 Seiten je Band kann sich die Leserin, der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schemathera pie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Soziale Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Die Technik der freien Assoziation hat Freud selbst im Alter als bedeutsamste Neuerung der Psychoanalyse und als methodischen Schlüssel zu den Ergebnissen der Analyse bezeichnet. Der Autor nimmt die Leserinnen und Leser mit auf einen Weg des besseren Verstehens der analytischen Methode, deren Aufgabe es ist, das »Terrain des psychischen Innenlebens« zu eröffnen und Zugang zu ihm zu ermöglichen. Er sagt, dass Methode und Ergebnisse der Psychoanalyse zueinander in einem konflikthaften Spannungsverhältnis stehen können. »Die Methode ist ständig davon bedroht, den mit ihr erzielten Resultaten zum Opfer zu fallen!« Das Aufschließen der Psyche, die empathische Offenheit gegenüber dem, was kommt, kann durch »Wissen« verstellt werden. Dann liegen Verständnis und Deutung immer auf der Hand. Der Therapeut kann sich als »Besserwisser« gar nicht mehr öffnen. Demgegenüber muss es das Ziel sein, die »psychoanalytische Methode zum Arbeiten zu bringen«.
Die methodischen Grundregeln der freien Assoziation und der gleichschwebenden Aufmerksamkeit werden in ihrer konzeptuellen Spannung aufgezeigt, da sie eigentlich eine »Contradictio in Adjecto« darstellen. Assoziationen sind nie frei und die Aufmerksamkeit ist immer fokussiert. Die Regeln können gar nicht in aller Eindeutigkeit befolgt werden, sie haben aber das Ziel, das Sprechen des Patienten und das Hören des Therapeuten »zu befreien«, Konventionen aufzubrechen und eine innere Öffnung zuzulassen.
Die Entwicklung der psychoanalytischen Methode wird aus der Geschichte der Psychoanalyse, ihren poetischen und wissenschaftlichen Wurzeln und Freuds voranalytischen Schriften und klinischen Erfahrungen abgeleitet. Die Psychoanalyse »misstraut dem Bekannten, dem Verständlichen, denn sie ist dem Unbekannten und Unbeherrschbaren auf der Spur«.
In der Praxis der methodischen Anwendung stellt sich die Frage, ob die methodischen Regeln eine Vorschrift oder eine Erlaubnis darstellen. Als Vorschrift gegen die inneren Vorschriften eines Zensors des Über-Ichs gerichtet, hat die Regel etwas Befreiendes. Sie muss nicht »sklavisch eingehalten« werden, sondern soll neugierig machen »auf das, was gegen sie verstößt«. Dabei wird auch Lacans Formulierung aufgegriffen, dass die Deutungen des Therapeuten den Patienten anregen und »Wellen schlagen« sollen. Der Autor hält fest: »Die Deutung soll nicht die Rätsel des Patienten lösen, sondern seine Zunge«.
Eine solche Methode kann auch gelernt werden, wobei das Ziel des Lehrenden sein sollte, den Scholaren zur Emanzipation zu bewegen und sich schließlich selbst überflüssig zu machen. In einer Zusammenfassung hebt der Autor schließlich »zehn Prinzipien für das Arbeiten mit freier Assoziation und gleichschwebender Aufmerksamkeit« hervor. Diese sind nicht zu befolgen, sondern zu beherzigen.
Ein spannendes, tiefsinniges und kluges Buch zur psychoanalytischen Methode, das nicht belehrt, sondern innerlich befreit.
Inge Seiffge-Krenke und Franz Resch
1Einleitung: Der Weg der Analyse
»Die Technik der freien Assoziation [ist] die bedeutsamste Neuerung der Psychoanalyse, der methodische Schlüssel zu den Ergebnissen der Analyse.« – In diesem erstaunlichen Fazit präsentiert der 74-jährige Freud (1960a, S. 398) die freie Assoziation rückblickend nicht nur als den innovativen Kern der Psychoanalyse, sondern auch als einen Schlüssel, über den wir verfügen müssen, wollen wir Zugang zu dem gewinnen, was er »Ergebnisse der Analyse« nennt. Damit sind offenbar die uns vertrauten und zum Teil sprachliches Allgemeingut gewordenen psychoanalytischen Konzepte gemeint: das dynamische Unbewusste, Übertragung und Gegenübertragung, Verdrängung und Widerstand, infantile Sexualität und Ödipuskomplex. Aber müssen diese Ergebnisse noch aufgeschlossen werden? Stehen sie nicht vielmehr fest? Haben wir denn nicht alle in Seminaren gelernt und können theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich nachlesen, was das ist: Übertragung (Körner, 2018), Widerstand (Seiffge-Krenke, 2017), das Unbewusste (Gödde, 2018), Sexualität (Quindeau, 2014)? Wozu da noch einen »Schlüssel«? Was soll er uns aufschließen, öffnen, zugänglich machen?
Freud legt Wert darauf, die psychoanalytische Methode und die Ergebnisse der Analyse voneinander zu unterscheiden. In der berühmten Definition aus dem Artikel »Psychoanalyse«, den Freud für Max Marcuses »Handwörterbuch der Sexualwissenschaft« verfasste, heißt es: »Psychoanalyse ist der Name 1.) eines Verfahrens zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind; 2.) einer Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet; 3.) einer Reihe von psychologischen, auf solchem Wege gewonnenen Einsichten, die allmählich zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin zusammenwachsen« (Freud, 1923a, S. 211). Wir können unterstellen, dass die Reihenfolge der Aufzählung hier keine zufällige ist: Psychoanalyse ist zuallererst eine Methode, ein Verfahren, ein Beobachtungs- und Forschungsinstrument. Erst an nachgeordneter Stelle ist sie der aufgrund dieses Verfahrens gewonnene Fundus an neuen Einsichten und Wissensbeständen (vgl. Bernfeld, 1981; Laplanche, 1998).
Das griechische Wort méthodos bedeutet wörtlich metá hodós: das Nachgehen eines Weges. Seit Platons Prägung des philosophischen Methodenbegriffs fungiert das Bild des Weges als epistemische und systematische Metapher, ohne die in vielen Wissenschaften kein Schritt unternommen werden kann (Westerkamp, 2011): Wir interessieren uns für »Geldströme«, »Nervenbahnen« oder »Geschlechtsverkehr«; wir »folgen« »Argumentationslinien« und »gelangen« so vom »Ausgangspunkt« unserer »Gedankengänge« – wenn wir nicht »irren« – zu einem »Ziel«. Freud spricht mit Blick auf die psychoanalytische Methode des Forschens und Heilens oft vom »Weg der Analyse« (z. B. Freud, 1914d, S. 57). Dieser verlaufe folgendermaßen: Die Aufgabe der analytischen Methode ist es, ein bestimmtes Terrain überhaupt erst zu eröffnen und Zugang zu ihm zu ermöglichen. Auf diesem Terrain sind dann bestimmte neue Erfahrungen möglich. Da es für diese anfangs noch keine Orientierung stiftenden Konzepte und Theorien gab, waren sie zunächst unverständlich, irritierend und verunsichernd. Erst aus der Sammlung vieler solcher Erfahrungen konnte sich nach und nach eine analytische Theorie entwickeln, deren Aufgabe es war, Erfahrungen verständlich zu machen und so mit ihnen fertigzuwerden, anstatt sie auszuhalten. Die oft erzählte Geschichte der Entdeckung, Entfesselung und konzeptuellen Zähmung der Übertragung ist ein bekanntes Beispiel dafür, wie die psychoanalytische Methode ins Unvertraute und Ungewisse führt und wie die Ergebnisse der Analyse Vertrautheit und Gewissheit herstellen.
Insbesondere in seinen Schriften zur Behandlungstechnik geht es Freud darum, das Chaos, die »unübersehbare Mannigfaltigkeit« (Freud, 1913c, S. 454), einer in wesentlichen Teilen durch unbewusste Strukturen der beide Akteure bestimmten Interaktion zwischen Therapeut und Patient zu ordnen, um diese so für den angehenden Psychoanalytiker handhabbar zu machen. Es sollten gangbare »Wege der psychoanalytischen Therapie« (Freud, 1919a) aufgezeigt und mit Wegmarken versehen werden. In diesem Kontext muss auffallen, dass sich Freud an entscheidenden Stellen einer Sprache bedient, welche die darzustellenden Sachverhalte in ihrer Mehrdeutigkeit ebenso erhellt wie verdunkelt. Das »berühmt-mißverständliche Wort von der analytischen Spiegelhaltung« (Körner u. Rosin, 1985, S. 30) ist neben der Chirurgen-Metapher das bekannteste Beispiel hierfür. Aber auch die von Helmut Hinz (1991, S. 149) als »poetisch-psychologische Metapher« bezeichnete Wendung »gleichschwebende Aufmerksamkeit« und ihr Pendant, die »freie Assoziation«, gehören in diesen Zusammenhang.
Wenn Donald Spence (1984, S. 47) vom »Mythos der gleichschwebenden Aufmerksamkeit« spricht, dann meint er dies durchaus despektierlich: Mythos bedeutet hier etwas im Vergleich zur rational-wissenschaftlichen Welterklärung Defizitäres, etwas nicht erwiesenermaßen Feststehendes und Wohlbegründetes, sondern etwas, das »bloß« Phantasma ist, »nur« Ammenmärchen, »lediglich« Fiktion. Unabhängig von seiner Bewertung erkennt Spence darin zu Recht, dass Freud hier eine Sprache verwendet, welche offenbar eher dem Bereich des Mythos als dem des Logos zu entstammen scheint. An den Konstrukten der gleichschwebenden Aufmerksamkeit und der freien Assoziation lässt sich zeigen, dass dies nicht etwa ein Lapsus, sondern ein methodischer Kunstgriff ist, der auf eine Grundspannung verweist, welche das gesamte Freud’sche Werk durchzieht: eine Spannung zwischen Orientierung durch Klärung, Erhellung, Einsicht und Verstehen auf der einen Seite und Desorientierung durch Verwirrung, Verdunkelung, Verblindung und scheiterndes Verstehen auf der anderen Seite.
Diese Spannung entsteht daraus, dass es offenbar – im Gegensatz zur naturwissenschaftlichen Rationalität – gar nicht das primäre Ziel