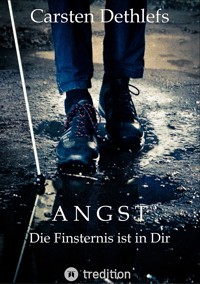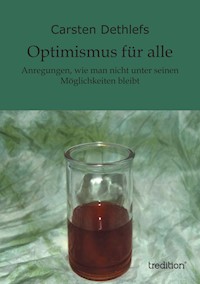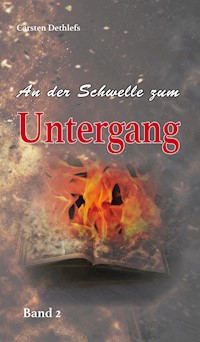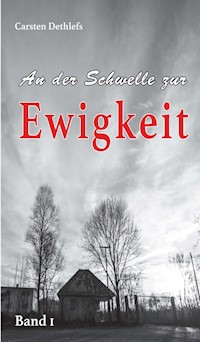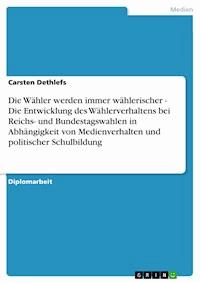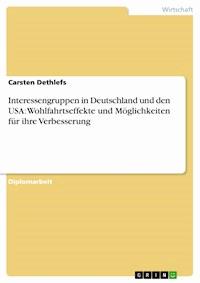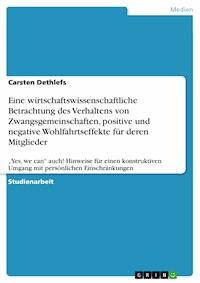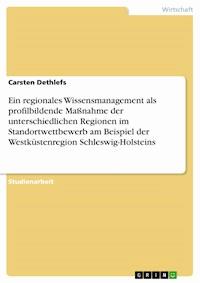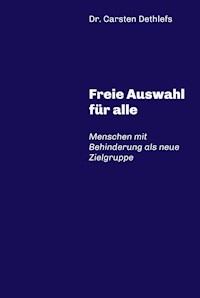
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Können Sie sich vorstellen, wie es ist, nicht mehr ohne fremde Hilfe durch die Geschäfte schlendern zu können? Für jeden Handgriff in der Konsumwelt fremde Hilfe zu benötigen? Nicht zu wissen, wie Sie an Ihr Lieblingsmüsli im Regal des Geschäfts Ihres Vertrauens herankommen? Und auch bei der Erledigung Ihres Jobs, der Ihnen bislang viele Dinge ermöglicht hat, neu denken zu müssen? Zugegeben, das ist eine furchtbare Vorstellung. Dennoch geht es 10 Millionen Menschen in Deutschland mehr oder weniger genauso; sie haben nämlich eine sichtbare oder unsichtbare Behinderung. Wie diese Menschen in der Welt der bunten Produkte des täglichen Bedarfs zurechtkommen und welche Hilfen sie sich wünschen, wird in diesem Buch beschrieben. Unter Anderem anhand einer empirischen Erhebung versucht das Buch "Freie Auswahl für alle" die Frage zu beantworten, wie man Menschen mit Behinderung nicht mehr nur länger als "Objekte des Mitleids" wahrnehmen, sondern sie als neuen Markt, als neue Zielgruppe, entdecken kann. Diese Zielsetzung wird umrahmt vom Gedankengerüst der Sozialen Marktwirtschaft. Denn eine gedankliche und praktische Umpositionierung von Menschen mit Behinderung würde letztlich allen zugutekommen. Falsches Mitleid ist hier fehl am Platz. Die Soziale Marktwirtschaft will niemanden in der Gesellschaft zurücklassen. Die Soziale Marktwirtschaft will aktivieren statt versorgen. Die Soziale Marktwirtschaft will helfen, statt Menschen links liegen zu lassen. Wer sich informieren möchte, wie so etwas geht, findet in diesem Buch reichlich Ansatzpunkte und Diskussionsstoff.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 76
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Dr. Carsten Dethlefs
Freie Auswahl für alle
Menschen mit Behinderung als neue Zielgruppe
© 2017 Dr. Carsten Dethlefs
Lektorat, Korrektorat, Umschlag und Illustration:Susanne Junge
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7439-0024-0 (Paperback)
978-3-7439-0025-7 (Hardcover)
978-3-7439-0026-4 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Freie Auswahl für alle
Teil I – Vorbemerkungen
Zum Autor und seiner Zielsetzung
"Man kann doch mehr, als nur blind zu sein!"
Was bedeutet das Wort „Behinderung“?
Definitionen Blindheit/Sehbehinderung
Das Zahlen-Dilemma
Was bedeutet das Wort „Barrierefreiheit“?
Teil II – Die empirische Erhebung
Vorbemerkungen
Der Fragebogen
Grenzen empirischer Erhebungen
Teil III – Barrierefreiheit als Wettbewerbsvorteil
Barrierefreier Lebensmittelmarkt
1. Das Einkaufszentrum
2. Eingang zur Passage
3. Erschließung der Ebenen
4. Ladenausstattung
5. Sonstige Einrichtungen
Ladeneinrichtungen für Friseursalons
1. Großzügige Parkplätze
2. Briefen Sie Ihr Personal
3. Rampen als Alternative zu Treppen
4. Handläufe als nützliche Hilfe
5. Reduzieren Sie Barrieren im Salon
6. Schnell und einfach im Warte- und Frisierbereich Platz schaffen
7. Höhenverstellbare Waschbecken
8. Sanitäre Anlagen für Kunden?
9. Glastüren als potentielle Gefahr
10. Achten Sie auf die Gestaltung
Tastbare Straßenschilder in Sydney
Neues Vorlesungsmodul an der Fachhochschule Westküste in Heide/Holstein
Schlussbetrachtung und Ausblick
Teil IV – Die Wirtschaftsordnung
Befähigung statt Versorgung
Forderungen an Politik und Gesellschaft
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Vorwort
Der Titel dieses Buches mag dem Einen oder Anderen zunächst ein Rätsel aufgeben. Wer stellt schon unsere freie Konsumwahl in Frage und wer sind „alle“? Diese Fragen dürften durch den auf den folgenden Seiten schnell beantwortet werden. Es handelt sich bei diesem Buch um ein Plädoyer für die Freiheit, für die Freiheit von Menschen, die ihre freiheitlichen Grundrechte wegen unfreiwilliger Einschränkungen nicht in gleicher Weise wahrnehmen können wie andere Personen.Es geht um Menschen mit Behinderung, insbesondere körperlicher Behinderung.
Diesem Buch liegen unterschiedliche Impulse zugrunde, die ich aus Gesprächen mit Betroffenen und aus eigener Erfahrung beisteuern konnte. Die freie Auswahl ist eben nicht selbstverständlich. Er hat seine Grenzen, nicht nur in der durch viele politische Einflüsse gefährdeten Wirtschaftsordnung, sondern eben auch durch mangelnde oder oftmals unproduktiv gesteuerte Kommunikation über die tatsächlichen Bedürfnisse von behinderten Menschen.
Der Zusatz im Titel „für alle“ lehnt sich zudem an das Werk Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“ an, welches ebenfalls das Ziel hatte, niemanden zurückzulassen. Ohne die mutigen Reformen zu Beginn der bundesrepublikanischen Geschichte wäre eine freie Auswahl von Konsumgütern Konsum heutzutage vielleicht auch für andere Gruppen kein alltägliches Vergnügen. Die freie Preisentwicklung, sowie das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung sind auch noch heutzutage Grundpfeiler unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.
Mit diesem Buch ist es erstmals gelungen, in einer empirischen Studie die tatsächlichen Bedürfnisse von Menschen mit Handicap als Konsumenten darzulegen.
Ich danke an dieser Stelle Herrn Prof. Hans-Dieter Ruge, der es mir ermöglichte, im Rahmen eines Wahlpflichtmoduls an der FH-Westküste eine Onlinebefragung zu diesem Thema durchzuführen. Zudem danke ich der Konrad-Adenauer-Stiftung, die es mir erlaubt hat, im Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit vier Semesterwochenstunden am frühen Freitagnachmittag zu lehren. So ist auch dieses Buch ausschließlich in meiner Freizeit entstanden. Weiterhin gilt mein Dank Herrn Volker König, der in operativer Hinsicht als Ingenieur die Barrierefreiheit von Supermärkten und anderen gestalteten Lebensbereichen in den Blick genommen hat. Zudem danke ich meiner bewährten und mir schon seit vielen Büchern die Treue haltenden Assistentin Susanne Junge, die nicht nur bei der Auswertung und anschließenden Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, sondern auch bei der Visualisierung und dem Layout eine große Hilfe war.
Heide im Januar 2017
Carsten Dethlefs
Freie Auswahl für alle
Menschen mit Behinderung als Zielgruppe
Einfach mal entspannt shoppen, gemütlich durch die Geschäfte schlendern, in die Regale schauen und die eine oder andere Sache kaufen. Und hat man mal keine Lust, sich aus dem Haus zu bewegen, ersetzt das Internet den Gang in die Geschäfte. Diese schöne Beschäftigung – früher offline, heute oftmals online – die unsere bunte Konsumwelt mit sich bringt, gehört spätestens seit den Jahren des so genannten Wirtschaftswunders zu unserer aller Leben. Man könnte sagen, dass die freie Konsumwahl für viele zur gelebten Freiheit unserer westlichen Kultur maßgeblich dazugehört. Doch gibt es eine sehr große Gruppe in unserer Gesellschaft, für die diese Errungenschaften der Marktwirtschaft nicht so selbstverständlich sind. Ich spreche hier von den knapp zehn Millionen Menschen mit Behinderung, die es in Deutschland (und in ähnlicher Größenordnung auch in anderen Staaten unserer westlichen Zivilisation) gibt. Das einfache Lesen von Preis- und Produktinformationen im stationären Handel kann für blinde Menschen genauso schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, wie das Erreichen von Produkten in höheren Regalbrettern für Rollstuhlfahrer oder kleingewachsene Personen.
Zudem ist die Barrierefreiheit in Geschäften aber nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderung, sondern genauso für Personen, die mit schweren Einkaufstaschen, Kinderwagen oder Krücken unterwegs sind.
Nun könnte man mit Recht denken, dass das Internet heutzutage eine willkommene Alternative zum Einkauf im stationären Handel bietet. Doch ist auch die Zugänglichkeit des Internets für Menschen mit Behinderung keine Selbstverständlichkeit. Die bildhafte Kommunikation auf Webseiten, die nicht mit einem Alternativtext versehen sind, macht die Navigation und Informationsaufnahme für blinde Menschen extrem schwierig. Wenn man in der Beweglichkeit des Oberkörpers eingeschränkt ist oder einen Tremor hat, ist allein schon die Bedienung einer Computermaus eine Herausforderung.
In Deutschland gibt es laut statistischem Bundesamt ca. zehn Millionen Menschen mit einer sichtbaren oder unsichtbaren Behinderung1. Diese Personengruppe, die bislang vor allem unter dem Blickwinkel der Versorgung und staatlichen Wohlfahrt gesehen und aus diesem Grund eher als Kostenfaktor wahrgenommen wurde, ist aber viel mehr. Diese Gruppe ist ein aus unterschiedlichen Gründen bislang vollkommen vernachlässigter Markt.
Nun mag es dem einen oder anderen merkwürdig vorkommen, eine Gruppe „bemitleidenswerter Geschöpfe“ mit harten kapitalistischen Vokabeln zu konfrontieren. Schließlich wurde gerade durch die Diskussion um das Bundesteilhabegesetz deutlich, wie ungerecht die Welt gegenüber Menschen mit Behinderung doch ist. Wenn es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, merkwürdig vorkommt, ist das erste Ziel dieses Buches bereits im Begriff, verwirklicht zu werden. Warum sich der Autor erdreistet, scheinbar so wenig Empathie für Menschen mit Behinderung aufzubringen und sie durch die harte marktwirtschaftliche Brille zu sehen, wird wahrscheinlich deutlicher, sobald Sie den folgenden Abschnitt „Zum Autor und seiner Zielsetzung“ lesen.
Und diese Bemerkung soll sie jetzt keinesfalls dazu veranlassen, das Buch aus der Hand zu legen. Vielmehr sollten Sie neugierig sein, wie es weitergeht.
Teil I – Vorbemerkungen
Zum Autor und seiner Zielsetzung
Der Autor ist – Sie werden es erwartet haben – promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Etwas weniger erwartet haben dürften Sie, dass er Altstipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. (KAS) ist. Er ist – das war wieder zu erwarten – Mitglied im Promotionskolleg „Soziale Marktwirtschaft“ der KAS. Zudem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung und war im Wintersemester 2016/2017 in einer nebenberuflichen Tätigkeit Dozent an der Fachhochschule Westküste in Heide/Holstein. Er ist Mitglied der CDU und vom Fanclub des HSV, er hat eine Leidenschaft für Currywurst und Heavy Metal. Ach ja, nicht zu vergessen ist: Er ist seit seinem vierten Lebensjahr vollständig erblindet.
Doch ist sein Ansinnen gerade nicht, in zu große Abhängigkeit von sozialen Leistungen zu geraten. Er vertraut vielmehr auf die Stärke der Marktwirtschaft. Das heute in so vielen schillernden Farben benutzte und diskutierte Wort „Inklusion“ ist nach seiner Auffassung erst dann vollständig erreicht, wenn das eigene Handicap zur Nebensache wird. Seine wohl als exotisch anzusehende Einstellung wird auch in dem folgenden Artikel deutlich, der während seiner Promotionszeit am 15. Oktober 2010 in der Tageszeitung „Die Welt“ erschienen ist:
"Man kann doch mehr, als nur blind zu sein!"
Freitag ist der "Tag des weißen Stocks". Doch Carsten D. (29) will keinen Gedenktag, er will ernst genommen werden.
1: Carsten D. an seinem Computer, Quelle: Pressebild.de/ Bertold Fabricius
„Ich bin ausgetreten aus dem Kollektiv von Jammerlappen. Aus dem Blindenverband (hiermit ist ausschließlich der BSVSH aus Schleswig-Holstein gemeint, Anm. des Verfassers). Fast mein ganzes Leben war ich Mitglied, jetzt hat es mir gereicht. Ich habe ein Schreiben bekommen, mit dem ich gebeten wurde, gegen die Kürzung des Blindengeldes in Schleswig-Holstein mitzudemonstrieren. Das war mal wieder typisch: Die einzig sichtbare Aufgabe, die der Verband wahrnimmt, ist öffentliches Jammern. An das Mitleid der Gesellschaft appellieren. Die Schwächsten vorschicken, ihre Hilfsbedürftigkeit zur Schau stellen undsie abhängig machen von Almosen des Staates. Da will ich nicht mehr mitmachen. Ich will nicht jammern. Ich will ernst genommen werden. Ich will etwas leisten.
Ich weiß heute noch, wie Farben aussehen