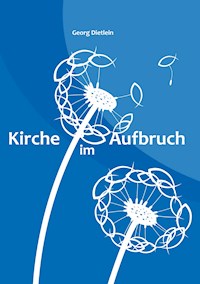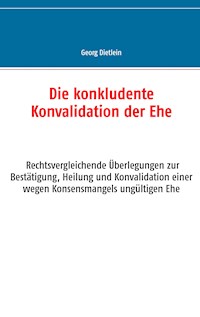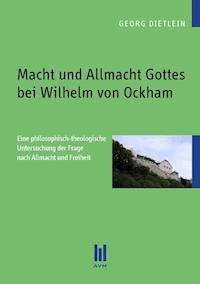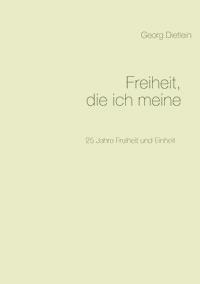
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Wiedervereinigung Deutschlands liegt inzwischen ein Vierteljahrhundert zurück. Seitdem ist eine Generation herangewachsen, für die die deutsche Einheit eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Die Errungenschaft der Freiheit und Einheit droht in Vergessenheit zu geraten. Denn wer die Wiedervereinigung bloß als Zusammenlegung zweier Territorien begreift, der übersieht etwas Entscheidendes. Der 3. Oktober 1990, der Tag der Deutschen Einheit, folgt auf den 9. November 1989, den Tag der „deutschen Revolution“, der Revolution der Freiheit. Das vorliegende Buch geht der Frage nach, was Deutschland überhaupt eint, was diese Nation überhaupt ausmacht. Im Zentrum steht dabei das nationale Gedächtnis der lang erkämpften Freiheit – von der Deutschen Revolution 1848/49 bis hin zur friedlichen Revolution am 9. November 1989, die letztlich eine Revolution der Freiheit war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die Revolution der Freiheit
Der deutsche Sonderweg
Die Wiedervereinigung
Kultur der Erinnerung
Besinnung auf das Gemeinsame
Deutsche Einheit gemeinsam gestalten
Kultur der Freiheit
Kontingenz und Notwendigkeit von Werten
Werteverfall oder Wertevielfalt
Die Suche nach dem „Kitt der Gesellschaft“
Eine Kultur der Freiheit
Nation der Freiheit
Die Kultur?
Ein Blick in die Geschichte
Was eint Deutschland?
Nation als Geschichts-Gemeinschaft
Nation – kontur- und profillos?
Deutschland – Nation der Freiheit?
Mut zur Freiheit
Kultur des Lebens und des Todes
Der Weg hinein in eine Kultur des Unrechts
Latenter Bewusstseinswandel in der Bevölkerung
Zivilcourage als Aufmerksamkeit für das Unbemerkte und Unscheinbare
Zivilcourage als Mut zur Freiheit
Erstveröffentlichung der Beiträge
Die Revolution der Freiheit
Tiefgründige Fragen erfordern tiefgründige Antworten. Und da liegt das Problem: Oft sind es schon die Fragen, welche den Blickwinkel des Antwortenden in eine gewisse, möglicherweise falsche oder unpräzise Richtung lenken. Oft sind es aber auch die Antworten, die sich von der Frage entfernen und lieber an Ideologien als an der Realität Maß nehmen.
Dieses Problem eröffnete sich mir, als ich anfing darüber nachzudenken, wie sich die Deutsche Einheit „gestalten“ lässt. Eine solche Frage setzt bereits voraus, dass man Einheit überhaupt „gestalten“, „herstellen“ und damit gleichsam „produzieren“ kann. Sie unterstellt aber auch, dass Einheit ein gestaltungswürdiges Ziel ist, dass es sich „lohnt“, Einheit gemeinsam zu gestalten. Konkret verbindet sich damit die fundamentale Frage, ob die Deutsche Einheit als solche überhaupt Wille der Deutschen ist und war.
Ich selbst bin der Überzeugung, dass man Einheit nicht schlicht „gestalten“ kann – genauso wenig wie sich Liebe und Zuneigung „herstellen“ lassen. Der Deutschen Einheit liegt eine bereits bestehende Einheit voraus. Dass sich diese Einheit allerdings konkret ausprägen und verwirklichen kann, obliegt der individuellen Gestaltung. Sie ist eine bleibende Aufgabe an die Politik, die Voraussetzungen für die gelingende Durchsetzung dieser Einheit schaffen kann. Zunächst ist es aber ein Auftrag an jeden Einzelnen: Diese zugrundeliegende Einheit lässt sich nicht einsam, sondern nur gemeinsam leben.
Was, wenn …
Was wäre, wenn es zum 9. November 1989 niemals gekommen wäre? Wenn es gar nicht zum 9. November 1989 hätte kommen müssen? Etwa deshalb, weil die Ideologie der DDR doch aufgegangen wäre? Weil den Bürgerinnen und Bürgern nach 1945 das schlichte Vergessen der Vergangenheit lieber gewesen wäre als der grundlegende Aufbau eines demokratischen Gemeinwesens nach westdeutschem Vorbild? Oder aber deshalb, weil sich die DDR immanent zur Demokratie weiterentwickelt und es einer Wiedervereinigung, eines Bei-oder Übertritts zur Bundesrepublik gar nicht bedurft hätte? Vielleicht hätten sich gar der ost- und der westdeutsche Teil parallel zu zwei souveränen Staaten in demokratischer Hochkultur entwickelt und damit auseinander gelebt? – Theoretische Überlegungen, die uns heutzutage – mehr als zwanzig Jahre nach der „friedlichen Revolution“ – als zu weit hergeholt erscheinen. Dabei lag in historischer Betrachtung eine solche Zwei- oder Mehr-Staaten-Lösung gar nicht allzu fern. Bereits die Teilung Deutschlands bei der Besetzung im Jahre 1945 spiegelt die Angst der Siegermächte wieder, erneut einem später wiedererstarkten Deutschland gegenübertreten zu müssen. Eine solche Furcht war angesichts des Ersten Weltkrieges gar nicht unbegründet.
Die deutsche Wiedervereinigung ist und war ein kontingentes Ereignis, eine nicht notwendige historische Entwicklung, die sich in der Form nicht hätte ereignen müssen und die auch nicht von allen Seiten her gewollt war.
Worauf will ich nun mit dieser Was-Wenn-Struktur hinaus? – Mich persönlich bewegt die Frage, worin der tiefere „Sinn“ der deutschen Wiedervereinigung liegt und lag – kurz gesagt: Was brachte viele tausend Bürgerinnen und Bürgern am 9. November 1989 auf die Straßen und stieß eine Entwicklung an, die schließlich zum 3. Oktober 1990 führte?
Der 9. November 1989 hat sicherlich viele verschiedene Ursachen. Im Vordergrund stand bei der Friedlichen Revolution aber – so paradox es klingen mag – gar nicht die Einheit, sondern die Freiheit. Was bereits seit 1945, also 44 Jahre lang, nicht Realität in der DDR war – die Einheit der Deutschen – wurde auch in den Montagsdemonstrationen und am 9. November 1989 nicht plötzlich zum neuen politischen Hauptziel. Im Vordergrund des 9. Novembers stand die Freiheit. Zugleich ging es dabei um Menschenwürde, Grundrechte und staatsbürgerliche Rechte. Die Einheit wurde zum Vehikel der Freiheit. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR waren seit Jahrzehnten entrechtet worden – Freiheit war nur noch in der Einheit zu haben.
Diese Freiheit stand in Abhängigkeitsbeziehung zur Einheit. Die primäre Forderung der geknechteten und in ihren Rechten verletzten DDR- Bürger lautete: „Wir sind das Volk“ – die Forderung nach Meinungsfreiheit und nach – faktischer – demokratischer Einflussnahme. Erst an zweiter Stelle stand die Forderung „Wir sind ein Volk“. So sehr wir uns am 3. Oktober 1990 über die wiedererlangte Einheit des einen deutschen Staates und des einen und unteilbaren deutschen Staatsvolkes freuen, feiern wir am 9. November 1989 weniger den Sieg der Einheit als den Sieg der Freiheit. Der 9. November 1989 ist als „Tag der Freiheit“ daher der eigentliche „Tag der Deutschen“.
Freilich – auch die Einheit hat ihren eigenen Wert. Ständiger Staatsauftrag der Bundesrepublik war nach der Präambel des Grundgesetzes: „Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“ – Hierin drückt sich das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus: Deutschland war 1871 ein Staat geworden. Nur das Volk als solches oder in demokratisch legitimierter Vertretung hätte diese staatliche Einheit wieder aufgeben können. Das war 1945 aber weder geschehen noch intendiert. So blieb die Wiedervereinigung ein dauerhafter Auftrag an die Bürger von „West“ und „Ost“ – nicht aber aus ihr selbst heraus, sondern aus der Freiheit des Einzelnen, der Freiheit der Völker. Schließlich waren es die Bürgerinnen und Bürger, die die Mauer überwunden haben, nicht ein abstrakter Wunsch und Gedanke von „Einheit“.