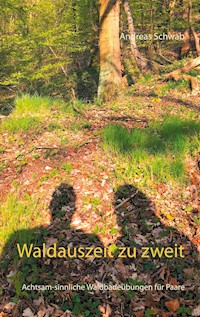21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Else Lasker-Schüler, Richard Dehmel, Edvard Munch, Oda Krogh, Henri Murger, Franziska zu Reventlow, August Strindberg, Frank Wedekind - sie alle gehörten der Boheme an, jener künstlerischen Subkultur, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Paris und Wien, München und Berlin entwickelte und durch ihren freizügigen Lebensstil, ihren rebellischen Geist und nicht zuletzt ihre prekären finanziellen Verhältnisse in Opposition zur gutbürgerlichen Gesellschaft geriet. Dieses Buch erzählt ihre Geschichte. Die Boheme revolutionierte die Ansichten darüber, was ein gutes Leben ausmacht. Und dies weniger in Texten und Manifesten als vielmehr im tätigen Leben mit all seinen Ambivalenzen. Andreas Schwab porträtiert nicht nur die Literaten und Künstlerinnen, die Männer und Frauen der Boheme, von denen diese Lebensstilrevolution ausging, er vergegenwärtigt auch die Orte, an denen sie sich trafen, die Kneipe «Das schwarze Ferkel» in Berlin, das «Chat Noir» im Pariser Montmartre, das «Café Stefanie» oder das Kabarett «Die Elf Scharfrichter» in München. So entsteht eine atmosphärisch dichte Beschreibung des Lebens der Boheme, die die von ihr ausgehende, bis in unsere Gegenwart reichende Faszination spürbar werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Andreas Schwab
Freiheit, Rausch und schwarze Katzen
Eine Geschichte der Boheme
C.H.Beck
Zum Buch
Paris und Wien, München und Berlin: Das wilde Leben der Boheme
Else Lasker-Schüler, Richard Dehmel, Edvard Munch, Oda Krogh, Henri Murger, Franziska zu Reventlow, August Strindberg, Frank Wedekind – sie alle gehörten der Boheme an, jener künstlerischen Subkultur, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in den großen Städten entwickelte und durch ihren freizügigen Lebensstil, ihren rebellischen Geist und nicht zuletzt ihre Verachtung des Geldes in Opposition zur gutbürgerlichen Gesellschaft geriet. Dieses Buch erzählt die Geschichte der Literaten und Künstlerinnen, der Männer und Frauen, von denen diese Lebensstilrevolution ausging, und vergegenwärtigt auch die Orte, an denen sie sich trafen, wie die Kneipe «Das schwarze Ferkel» in Berlin, das «Chat Noir» im Pariser Montmartre, das «Café Stefanie» oder das Kabarett «Die Elf Scharfrichter» in München. So gelingt es, die bis heute von der Boheme ausgehende Faszination spürbar werden zu lassen.
Über den Autor
Andreas Schwab (*1971) ist Autor, Ausstellungsmacher und Gemeindepräsident von Bremgarten bei Bern. Er hat Bücher über den Monte Verità und die Landkooperative Longo maï veröffentlicht. Bei C.H.Beck ist von ihm erschienen: Zeit der Aussteiger. Eine Reise zu den Künstlerkolonien von Barbizon bis Monte Verità (22021).
Inhalt
Einleitung
Ungebundenheit und subversives Potenzial – Die diverse Boheme
Gegen die Tyrannei – Die (a)politische Boheme
Hin zu einer Lebenskunst – Die praktische Boheme
I. Großstadthoffnungen und Mansardenromantik
Paris als Verheißung
Grisettes und exzentrische Künstlerinnen
II. Freundschaftszirkel in Cafés
Meinungsbörsen und Wärmehallen
Musik, Lyrik, Gesang und Skandal: «Das schwarze Ferkel»
Boheme-Prinzessinnen unter Ferkelbrüdern
III. Die Reize der Nacht
Schwarze Katzen
Botticellis der Vorstadt
Unterwelten und lichte Gegenwelten
IV. Ehekritik und freie erotische Kultur
Totentänze: Über die Aufweichung der Geschlechtergrenzen
Wilde Bauernfeste
Unabhängige Frauen und Mutterrecht
V. Politische Übergangsmenschen
Gnade dir Gott, du buntes Leben: Probleme mit Marx
Arbeiterinnen in Orchestersesseln: Theater und Politik
Ich will in das Grenzenlose
VI. Boheme und Erster Weltkrieg
Mimi Pinson stellt sich in den Dienst der Verteidigung
Epilog
Anhang
Anmerkungen
Einleitung
I. Großstadthoffnungen und Mansardenromantik
II. Freundschaftszirkel in Cafés
III. Die Reize der Nacht
IV. Ehekritik und freie erotische Kultur
V. Politische Übergangsmenschen
VI. Boheme und Erster Weltkrieg
Epilog
Bibliografie
Abbildungsverzeichnis
Personenregister
Was das Leben ist, erfährt man nur, wenn man sich ihm vorbehaltlos hingibt, in der Liebe, im Haß, in der Trauer, der Verzweiflung, der Langeweile, dem Ekel.
Franziska zu Reventlow
Aus dem Mistbeet der Bohême, von Unkraut fast erstickt, sprießen die Orchideen der Zukunft und befruchten gegenseitig ihre abenteuerlichen Blüten.
Roda Roda
Einleitung
Ungebundenheit und subversives Potenzial – Die diverse Boheme
In einem unmissverständlich formulierten Brief teilt Friedrich Uhl, Chefredakteur der angesehenen Wiener Zeitung, seiner Tochter mit, dass er ihre Verbindung mit dem fast doppelt so alten geschiedenen Schriftsteller August Strindberg äußerst kritisch sehe. Er befürchte ein Abgleiten in die Künstlerboheme. Ob sie nicht einen ordentlichen bürgerlichen Lebensweg, wozu eine standesgemäße Heirat gehöre, beschreiten wolle? Die Warnung verhallt ungehört, Frida Uhl und August Strindberg, die sich in Berliner Künstlerkreisen rund um das Lokal «Das schwarze Ferkel» kennengelernt haben, heiraten am 2. Mai 1893 in einer schlichten Zeremonie in der evangelischen Pfarrstube auf Helgoland. Auf die norddeutsche Insel sind sie gereist, weil dort nach britischem Recht keine sechswöchige Wartefrist für eine Heirat gilt. Der Ehemann ist in einen beigefarbenen Anzug mit schwarzer Seidenkrawatte und Sailorhut gekleidet; die Braut trägt ein Kleid aus Leinenbatist mit Spitzen nach einem Schnittmuster von ihr selbst. Zwei eilig beigezogene einheimische Lehrer agieren als Trauzeugen. Knapp zwei Jahre später, als sie in einem erbitterten Scheidungskrieg steckt, wird sich Frida Strindberg, wie sie zu diesem Zeitpunkt noch offiziell heißt, möglicherweise an die Zeremonie und den besorgten Brief ihres Vaters erinnert haben.[1]
Die letzte gemeinsame Zeit vor der endgültigen Trennung verbringt das Ehepaar in Paris, wohin Frida Strindberg, das gemeinsame Kind Kerstin bei ihren Eltern in Oberösterreich zurücklassend, ihrem Ehemann nachgereist war. Doch die Ehe ist längst zerrüttet. Strindbergs Schwärmereien des Anfangs – «Ein ganz neuer Typus in meinem Leben, weich, füllig, dunkel!»[2] – verkehren sich ins Gegenteil. Er erträgt nicht, dass Frida Strindberg ihre eigenen Ambitionen als Journalistin und Schriftstellerin verfolgt, und beobachtet jeden ihrer Schritte eifersüchtig. Sie vernachlässige den Haushalt, wirft er ihr vor. Zudem sei sie mit ihren Bemühungen, sein Werk bei Verlegern und Theaterdirektoren populärer zu machen, erfolglos geblieben. Schlimmer noch: Sie habe ihn mit ihrem respektlosen Auftreten in vielen Kreisen unmöglich gemacht. Seine Briefe an sie sind voller Gehässigkeiten; er lässt sich zu üblen Beschimpfungen hinreißen, «Du bist das schmutzigste menschliche Vieh, das ich je kennengelernt habe!», um sich kurz darauf wortreich für seine Entgleisungen zu entschuldigen.[3] Dass sich Frida Strindberg mit dem Kunsthändler und Lebemann Willy Grétor, einem Dandy mit mondänem Auftreten, anfreundet, belastet ihre ohnehin angespannte Beziehung zusätzlich.
Frida Strindberg-Uhl, die je ein Kind von August Strindberg und Frank Wedekind hat, verkehrt in den Boheme-Szenen von Wien, Berlin, Paris und München.
In einem förmlichen Brief willigt Frida endlich in die Scheidung ein. Sie nimmt sogar die Schuld an der gescheiterten Ehe auf sich unter der Bedingung, dass Strindberg alle Rechte auf das Kind an sie abtrete. In ihr steigt die Furcht auf, dass es ihr genauso ergehen werde wie August Strindbergs erster Ehefrau Siri von Essen. Nicht nur blieb Strindberg häufig die Alimente für die drei gemeinsamen Kinder schuldig, er machte auch intime Details seiner früheren Ehe in seinem autobiografischen Roman Plädoyer eines Irren (1888) öffentlich. Als sie längst getrennt lebten, sollte sich zeigen, dass Fridas Sorge berechtigt war: Im Roman Inferno (1897) veröffentlichte Strindberg auch seine Version seiner zweiten gescheiterten Ehe.
Die Zeichen stehen also auf Abschied. Den letzten Abend ihres fünfwöchigen Aufenthalts in Paris verbringt Frida Strindberg-Uhl im legendären Künstlercafé Le Procope inmitten des Quartier Latin. Hundert Jahre zuvor hatten sich hier die Aufklärer, unter ihnen Jean-Jacques Rousseau und Denis Diderot, zu ausgedehnten Diskussionsrunden getroffen. Sie hört sich Xavier Privas mit seinen gleichermaßen lebensfrohen wie melancholischen Chansons an. Der Auftritt begeistert sie, wie überhaupt ihr ganzer Aufenthalt in Paris. An ihre Schwester schreibt sie: «Oh, wie hier das Leben schäumt! Voll Rausch, voll Süße, geistiges, vergeistigtes Genießen mit aller Sinneskraft und Glut.» Doch sie kann nicht bleiben: Die Amme hatte gekündigt; es bleibt ihr keine andere Wahl, als zum Landsitz ihrer Eltern nach Saxen in Oberösterreich zurückzufahren. Bevor sie in den Zug steigt, trifft sie ein letztes Mal in ihrem Leben – sinnigerweise vor dem erst kürzlich eröffneten Warenhaus Le Printemps – ihren Noch-Ehemann August Strindberg. «Adieu Leben! Das Kind schreit wieder und ich komme. Ich reise noch heute Abend ab», lässt sie ihre Schwester wissen.[4]
Bemerkenswert: Frida Strindberg-Uhl verkehrt in vier europäischen Städten, die zu dieser Zeit eine ausgeprägte Boheme aufweisen, in Wien, Berlin, Paris und München. In München lässt sie sich nach ihrer Scheidung von August Strindberg im Milieu exzentrischer Künstlerinnen und Künstler im Bohemeviertel Schwabing nieder. Später geht sie eine kurze Affäre mit dem Dramatiker Frank Wedekind ein. Doch die Beziehung zerbricht, bevor der gemeinsame Sohn geboren ist. Als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern von zwei berühmten Schriftstellern, die sich beide kaum um ihren Nachwuchs kümmern, schlägt sie sich mehr schlecht als recht durch. Ihre Tochter, die in der Obhut von Verwandten aufwächst, sieht auch sie selbst nur wenig.
Wie lieblich präsentiert sich im Vergleich dazu Henri Murgers Scènes de la vie de Bohème. Dieser beinahe unangefochtene Prototyp aller folgenden Erzählungen über die Boheme, zunächst fast unbemerkt als Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitschrift erschienen, erlangte erst in der Bühnenfassung von 1849 seine umfassende Popularität. Die Hauptprotagonisten Rodolphe, der glücklose Dichter, sein Musikerfreund Schaunard, der Maler Marcel und der Bildhauer Jacques fristen ein beschwingt-verantwortungsfreies Leben in den Mansarden und Cafés des Quartier Latin in Paris. Sie haben keine feste Anstellung und zelebrieren ihre Ungebundenheit mit kurzfristigen Liebesbeziehungen und häufigen Wohnungswechseln. In gewisser Weise verhalten sie sich, als ob sie nicht erwachsen wären. Allein durch ihre Lebensweise protestieren sie gegen die meritokratischen Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft. Individualistisch wie sie sind, würde es ihnen nicht im Traum einfallen, sich freiwillig zum Militärdienst zu melden oder gar ihr Leben für einen abstrakten Begriff wie das Vaterland hinzugeben. Nichts ist ihnen so suspekt wie das Erfolgsstreben; sie kokettieren mit dem Scheitern. Die Auffassung, dass Geld den Charakter verderbe, ist ihnen geläufig. Also verprassen sie eine unverhofft zugefallene Erbschaft oder eine hohe Honorarzahlung so schnell wie möglich, indem sie ihre Freundinnen und Freunde zu einer ausgelassenen Feier einladen.
Es ist nicht zu verkennen: Murger romantisiert die Boheme. Seine glücklosen Künstler, typischerweise ausnahmslos Männer, sind idealistisch, liebenswert, großzügig und großherzig. Sie streben nach geistig Höherem und sind gleichzeitig realistisch genug zu wissen, dass sich nicht alle ihre Träume erfüllen werden. Das Leben ist kurz, und die Verhältnisse sind nicht geeignet, die großen Werke zu schaffen, die sie, wären die Umstände anders, leichthändig aus dem Ärmel schütteln würden. Also ist ihrer Geisteshaltung, aller ausgelebten Leichtigkeit zum Trotz, immer auch ein Schuss Melancholie und fatalistische Bitterkeit beigemischt.
Den Mythos der Boheme weiter genährt hat die 1896 im Teatro Regio in Turin uraufgeführte Oper La Bohème von Giacomo Puccini. Ihr Libretto, ein Destillat aus Henri Murgers episodischem Roman, erzählt in vier Bildern die Geschichte des armen Dichters Rodolfo. An einem Weihnachtsabend, den er zusammen mit seinem Freund Marcel verbringt, ist er gezwungen, eines seiner Manuskripte zu verbrennen, damit es in seiner Mansarde wenigstens ein bisschen warm wird. Er verliebt sich in seine Zimmernachbarin Mimi, nur um sie, als sie an Schwindsucht erkrankt ist, zu verlassen – aus Liebe, denn er weiß, dass er als armer Dichter nicht für sie sorgen kann. Um ihr Wohlergehen sicherzustellen, versucht er, ihr einen reichen Liebhaber zu verschaffen. Doch Mimi lässt sich darauf nicht ein und versichert Rodolfo kurz vor ihrem Tod in einer Arie ihre Liebe. Sie stirbt und lässt den mit dem Schrei «Mimi … Mimi» an ihr Bett stürzenden Rodolfo allein zurück.
Die meist im Dekor der Belle Époque inszenierte Oper bietet mit ihrer Mansardenromantik und den vielen komödiantischen Nebengeschichten rund um die verführerische Sängerin Musetta alles, was das Faszinosum der Boheme ausmacht. Nicht verwunderlich, dass sie bis heute zu einer der fünf meistaufgeführten Opern zählt. In zahlreichen Adaptionen und Remakes, darunter dem Film Das Leben der Bohème (1992) von Aki Kaurismäki oder im Rock-Musical Rent (1996) von Jonathan Larson, das während zwölf Jahren ununterbrochen am New Yorker Broadway lief, ist der Stoff für die jeweilige Gegenwart adaptiert worden.
Schon bei oberflächlicher Beschäftigung mit diesem absoluten Klassiker der Boheme fällt auf, wie stereotypisiert das Personal und die Geschichten sind: eine ebenso beschwingte wie hungerleidende männliche Künstlerschar, eine von ihnen angehimmelte Frau, die jung an Schwindsucht stirbt und den sie liebenden Dichter einsam zurücklässt. Dagegen ist es die Absicht dieses Buches zu zeigen, dass die Boheme deutlich vielfältiger und diverser war. Angestrebt wird ein Perspektivenwechsel: Den bislang vorherrschenden Blick auf die Boheme möchte ich durch andere Blickwinkel ablösen.
Es ist aufschlussreich zu beobachten, dass längst nicht alle der damals geführten öffentlichen Kontroversen die Zeit überdauert haben, eigentlich die wenigsten. Vieles wurde an den Rand gedrängt und ist heute schlicht vergessen. Die Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Buch eine tragende Rolle spielen, sind heute extrem unterschiedlich bekannt. Edvard Munch ist ein Weltstar der Malerei, August Strindberg, Frank Wedekind, Franziska zu Reventlow und Else Lasker-Schüler sind nicht vollständig vergessen. Von anderen ist allenfalls eine unbestimmte Vorstellung über ihr Wirken geblieben: Spielte Gustav Landauer, dieser in seinen Texten wild um sich greifende anarchistische Theoretiker, nicht eine Rolle in der Münchner Räterepublik? Mit den meisten Personen verbindet das Publikum abseits spezialisierter Fachkreise gar nichts mehr – sie sind der Amnesie anheimgefallen. Bedauerlicherweise zählen dazu viele Frauen. So sind George Sand, Dagny Juel, Oda Krohg, Yvette Guilbert oder Ida Dehmel allzu häufig einzig als «Musen» beschrieben und damit herabgewürdigt worden. Erst in jüngerer Zeit haben couragierte Historikerinnen und Ausstellungsmacher angefangen, diesen unhaltbaren Zustand zu berichtigen.
Selbstverständlich, so kann zu Recht eingewendet werden, ist das ein normaler Prozess: Das kulturelle Gedächtnis wählt selektiv nach dem aus, was zu erinnern sich lohnt, und tilgt alles andere. Aus der unendlichen Vielfalt des Geschehenen werden nur ganz wenige Werke, Episoden und Personen kanonisiert. Diesen historischen Kanon heute nochmals kritisch zu befragen, scheint inzwischen nötiger denn je. Denn Gewichtungen in der Geschichte sind nie zufällig, sondern Fragen von Interpretationen und Wertungen. Was für eine Generation schlüssig erscheint, kann und muss von einer späteren in Frage gestellt werden. Bei der Boheme zeigt sich, dass sie zu guten Teilen neu erschlossen werden muss. Zu entdecken ist eine spektakuläre Welt, in der ebenso faszinierende wie widersprüchliche Personen Gedanken entwickelten, die uns, die wir eineinhalb Jahrhunderte später leben, seltsam gegenwärtig vorkommen können.
Gleichzeitig lässt sich die Boheme nur im Kontext ihrer Zeit verstehen. Manche ihrer Übertreibungen erklären sich aus ihren Gegnerschaften. Ihre radikale Schärfe, die sie zum Teil entfaltete, war immer auch Reaktion auf politische und gesellschaftliche Zustände, auf den sich formierenden Nationalstaat, auf die Industrialisierung, auf die bürgerliche Familie, auf die soziale Frage und die umwälzenden Entwicklungen in Wissenschaft und Technik. Auch auf sie wird, selbstverständlich in der gebotenen Verdichtung, in den folgenden Kapiteln eingegangen und dadurch die Geschichte der Boheme zum Epochenbild erweitert.
Gegen die Tyrannei – Die (a)politische Boheme
Ein Einwand gegen das Thema liegt auf der Hand: Die weltpolitische Lage mit ihren multiplen Krisen, von der Klimaerwärmung über den Rechtspopulismus bis hin zu einem wiedererstarkten Autoritarismus in vielen Ländern, scheint nicht dazu angetan, die kostbare Lebenszeit dafür zu opfern, um sich mit eskapistischen Drückebergern und exzentrischen Außenseiterinnen zu beschäftigen. Mit Personen also, die sich weigerten, eine produktive Haltung in der Gesellschaft einzunehmen, die sich von Politik häufig fernhielten und deren Egoismus vielfach stärker ausgeprägt war als ihr Verantwortungsgefühl.
Das jedoch ist ein Missverständnis. Kaum jemand hat sich so um das Gemeinwesen verdient gemacht wie eben die Boheme. Denn in ihr wurden Selbsttechniken entwickelt und gelebt, welche zur gesellschaftlichen Liberalisierung, zur Akzeptanz verschiedenster Lebensmodelle bis hin zu den Rechten von Minderheiten führten. Anders gesagt: Die Dekadenz, die Libertinage, das Lotterleben wirkte letztlich doch um einiges attraktiver als eine graue «wissenschaftliche» Fortschrittstheorie, selbst wenn gerade die Sozialdemokratie mit ihren vielfältigen Arbeitervereinen sich nach Kräften um eine kulturelle Durchdringung ihrer Ideen bemühte. Der Lebensstilrevolution von Künstlerinnen und Künstlern im 19. Jahrhundert war so gesehen ein durchschlagender Erfolg beschieden: Argwöhnisch beobachtet von der bürgerlichen Gesellschaft lebten sie vor, was sich erst später in der Mitte der Gesellschaft durchzusetzen begann. Ihre Diagnosen, die sie aus ihrer Position als Außenseiter formulierten, waren häufig luzider und ihre Debattenbeiträge engagierter. Das lässt ihre Kontroversen, von denen sie nicht wenige austrugen, bis heute mit Gewinn nachverfolgen. Denn die Künstlerinnen und Künstler machten von der Freiheit des Individualismus Gebrauch. Von den totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts, vom Faschismus ebenso wie vom Kommunismus, sind genau diese individualistischen Freiheiten verfolgt worden; das Unheroische galt als subversiv, als Ausdruck einer dekadenten Einstellung, die sich nicht produktiv in die Gesellschaft einordnet. Bis heute haftet der Boheme eine leicht anrüchige Note an.
Der Wiener Gesellschaftstheoretiker Robert Misik hat die grundsätzliche Nähe der Boheme zu «linken» gesellschaftlichen Positionen betont.[5] Diese Auffassung erscheint nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung richtig. Denn den allermeisten Bohemiens widerstrebte es, sich für ein egalitäres Gesellschaftsprojekt einspannen zu lassen. Rigide Parteidisziplin war ihre Sache nicht, sie misstrauten umfassenden Antworten und abstrakten Solidaritätsgedanken; mancher Normierungsversuch war ihnen zu disziplinierend. Sie wollten sich nicht vorschreiben lassen, nach welchen Gesichtspunkten sie ihr Privatleben zu gestalten hatten.[6]
Hin zu einer Lebenskunst – Die praktische Boheme
Als im Lauf des bürgerlichen 19. Jahrhunderts die früheren feudalen Rollenverständnisse wegfielen, öffnete dies einen Raum für persönliche Lebensentscheidungen. Künstlerinnen und Künstler, die sich von aristokratischen Gönnern emanzipiert hatten, waren auf einmal gezwungen, ihr Leben selbstbestimmt auszurichten. Vielfach wogen sie Optionen gegeneinander ab; nicht selten unterliefen sie Erwartungen, die an sie gestellt wurden. Gegenüber manchen Zumutungen des modernen Lebens, etwa der Pflicht zur Arbeit oder zum Erwerb, waren sie skeptisch eingestellt. Sie suchten nach Alternativen und loteten individuelle Spielräume aus. Könnte, so fragten sie sich, das Leben nicht auch vollkommen anders organisiert werden? Jedenfalls waren sie gegenüber Fortschrittsideologien misstrauisch und setzten auf Subversion.
Der Lebensstil der Boheme hat nach Auffassung des französischen Soziologen Pierre Bourdieu «durch Phantasie, Wortwitz, Esprit, Chanson, Trinkgelage und Lieben in ihren vielfältigen Formen […] einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des künstlerischen Lebensstils» geleistet. Dieser diffundierte in die Gesellschaft – die Boheme revolutionierte die Ansichten darüber, was ein gutes Leben ausmacht. Dies tat sie weniger in ausgefeilten theoretischen Texten und Manifesten als vielmehr im tätigen Leben mit all seinen Ambivalenzen. Um es bildlich auszudrücken: Die hier entstandenen Texte und Bilder wurden mit dem ganzen Körper geschrieben bzw. gemalt; und der umfasst neben dem Hirn bekanntlich noch viele andere Organe inklusive des Unterleibs. Daher werde ich in den folgenden Kapiteln einen intimen Blick auf das Leben meiner Protagonisten werfen. Das ist auch deswegen aufschlussreich, weil sie häufig ihre eigenen Anschauungsobjekte sind und uns an ihren Gefühlen in Tagebuchaufzeichnungen und Briefen teilhaben lassen. Als gewollte Außenseiter waren sie Suchende, die die herrschenden Konventionen sprengten, um ihren Traum zu realisieren. Ihre Ansätze können uns folglich bis heute inspirieren – und vielleicht sogar den Weg weisen.[7]
Kaum eine andere gesellschaftliche Gruppierung hat sich so alltagspraktisch mit der Kunst des guten Lebens auseinandergesetzt und dabei unzählige Sinnsprüche und Kalenderweisheiten produziert wie die Boheme.[8] Nicht grundlos hat Alain de Botton in seinem Buch StatusAngst, in dem er philosophische Ansätze für ein gelungenes Leben Revue passieren lässt, der Boheme ein eigenes Kapitel gewidmet.[9] Dennoch bin ich dem Beispiel de Bottons nicht gefolgt und habe keinen weiteren philosophisch fundierten Glücksratgeber verfasst. Deren Krux besteht ja nicht selten darin, dass die Lehren, die aus ihnen folgen, mit der suggerierten Tiefe der großen Namen – von Aristoteles bis Epikur – nicht Schritt zu halten vermögen.[10] Viele sind so trivial, dass man auch ohne Referenz, nur mit etwas eigener Überlegung auf die aus ihren Texten abgeleiteten Ratschläge gekommen wäre.
Daher habe ich einen anderen Weg gewählt. Ich nähere mich den Themen in erzählender Weise, berichte von Bohemiens und Bohemiennes, von Lebensläufen am Rande der Gesellschaft und solchen, die ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit führten. Es wird sich zeigen, dass sich bei vielen Personen Widersprüche auftun; dass ihr Bestreben, sich individualistisch zu verhalten, längst nicht immer zum Erfolg führte. Nicht selten erteilte ihnen das Leben schmerzhafte Lektionen. Aber ihre Lebensgeschichten sind für uns gerade deswegen so instruktiv, weil sie von ständigen Reflexionen von Sinn und Zweck ihres Tuns begleitet waren.
Die Bohemiens und Bohemiennes führten gewissermaßen ein Leben für die Galerie. Ihr privates Leben war nicht in dem Sinne privat, dass es auf die Privaträume beschränkt war. Der Murger-Biograf Alfred Delvau drückte dies so aus: «In unseren vier Wänden leben, denken, trinken und essen, zu Hause sterben, wir finden das langweilig und unbequem. Wir brauchen Öffentlichkeit, Publikum, die Straße, das Cabaret …»[11] Dazu trägt bei, dass viele Bohemiens sich dem Skandal nicht nur nicht abgeneigt zeigten, sondern ihn geradezu suchten. Beispielsweise stattete der Autor Hans Jæger seinen Roman Kristiania Boheme (1885) über einen Selbstmörder mit so vielen freizügigen Details aus, dass er deswegen angezeigt und ins Gefängnis geworfen wurde. Diese exhibitionistische Form der Existenz wirkt gerade im Zeitalter von Social Media seltsam vertraut. Die Boheme war viel mehr als bloß eine Lebensform; sie war eine dramatisierte Spielart einer modernen Lebensführung, die im Laufe der Zeit in die Mitte der Gesellschaft diffundierte.
Doch vor voreiligen Schlussfolgerungen sollte man sich hüten. Im Scheidungskampf mit seiner ersten Ehefrau Siri von Essen hat August Strindberg auf den Vorwurf, er beleidige sie in einem Moment auf die unversöhnlichste Weise und im nächsten wolle er sie mit aller Liebe und Zärtlichkeit zurückgewinnen, mit einer Definition geantwortet: Ein Spießer ist, wer gleichzeitig nur zu einem Gefühl fähig ist.[12] Das mag wahr sein oder falsch; jedenfalls ist der Ausspruch kein schlechtes Motto für die folgenden Ausführungen. Auch hier müssen sich Lesende darauf gefasst machen, dass manche Themen zuerst von der einen und dann von der anderen Seite betrachtet werden und dass beide Sichtweisen nicht widerspruchsfrei ineinander aufgehen. Trotzdem sind beide gültig. Nicht nur bei Strindberg verlaufen diese Trennlinien manchmal innerhalb einer Person. Mehr noch: Es sind genau diese Gegensätze, die einen großen Teil des intellektuellen Reizes ausmachen, sich mit der Boheme zu beschäftigen. Nicht wenige von ihnen sind unverändert aktuell.
Was aber hat es mit den schwarzen Katzen im Titel auf sich? Seit dem ausgehenden Mittelalter dienten Katzen als Projektionsfläche für menschliche Abgründe und Begehren: Obschon sie gleich wie die braven Schoßhündchen zusammen mit den Menschen lebten, waren sie anders als diese im Grunde unzähmbar. Symbolisch standen sie für verführerische Lüste ebenso wie für eine ungehemmte, insbesondere weibliche Sexualität. Das machte sie für die Boheme attraktiv – und deswegen werden in den folgenden Kapiteln immer wieder Katzen herumstreunen.[13]
I.
Großstadthoffnungen und Mansardenromantik
Paris als Verheißung
Ein junger Mann aus der Provinz kommt nach Paris, einer von Tausenden, und tausende Geschichten fangen so an: Er stürzt sich in das Gewimmel auf den gepflasterten Straßen, die Sinneseindrücke sind verwirrend, der Lärm, die hohen Gebäude. Der Pomp der mächtigen Repräsentativbauten beeindruckt ihn. Möglicherweise setzt er sich in ein Café und steckt sich eine Zigarette an; er fühlt sich fremd, alle anderen scheinen sich zu kennen. Paris kann einschüchternd wirken. Niemand hat auf ihn und seine Talente gewartet. Wird er sich durchsetzen können, Erfolg haben? Einsam, jetzt schon zu nächtlicher Stunde, geht er durch die von Gaslaternen beleuchteten Straßen …
Abgesehen davon, dass ebenso viele Frauen in Paris ihr Glück suchten, worauf wir gleich noch kommen werden, ist einiges an dem jungen Mann bemerkenswert. Zunächst einmal ist er ein Individuum; sein Name wird heute vergessen sein, es sei denn, er hat es geschafft und ist zu Ruhm gelangt. Hector Berlioz beispielsweise ist als Achtzehnjähriger aus der kleinen Gemeinde La Côte-Saint-André in der Auvergne nach Paris gekommen, um Medizin zu studieren. Die grausigen Sektionen im Pathologiesaal bereiteten ihm Ekel, lieber konzentrierte er sich auf die Musik, wo er es zum gefeierten Komponisten brachte.[1] Oder Honoré de Balzac aus der Provinzstadt Tours, der es sich zur Aufgabe seines kurzen Lebens machte, das Pariser Großstadtleben in all seinen Facetten als Comédie humaine zu beschreiben.
Im zentralistischen Frankreich gab es keine mit Paris vergleichbare Stadt. Wer auf eine Karriere in den Künsten oder der Wissenschaft aspirierte, den zog es dahin. Aber die allermeisten sind so namenlos nach Paris gekommen, wie sie dort gestorben sind, selbst wenn auf ihrem längst verschwundenen Grabstein ein Name gestanden hat. Eine Bekanntheit als Künstler oder Schriftsteller, Ruhm gar, war nur wenigen vergönnt. Die Hoffnung darauf aber beflügelte viele, so viele, dass der junge Mann, der nach Paris kommt, nicht nur ein Individuum ist, sondern ebenso ein Topos.
Kaum einer hat diesen präziser in Worte gefasst als Balzac in seinem dreiteiligen Roman Verlorene Illusionen (1837–1843). Mit Anleihen bei seiner eigenen Biografie beschreibt er den Weg Luciens, Sohn einer Hebamme und eines Apothekers, aus einem kleinen Provinzort nach Paris. Lucien hofft, in der Großstadt sein Eldorado zu finden. Wie der Romantitel verrät, stellt sich das Unterfangen als schwierig heraus. In seiner mitreißenden Prosa, die uns mit dem Helden mitschauen, mithören, mitriechen, miterleben und mitfühlen lässt, bringt uns Balzac das komplexe Pariser Stadtgefüge näher. Damit aber hat Verlorene Illusionen das Bild geprägt, das wir uns heute von Paris machen und das durch unzählige Filme ikonisch geworden ist.
Auf einen Nenner gebracht: Paris ist eine Verheißung. Die Stadt bezaubert durch Progressivität und Prachtentfaltung; viele historische Epochen haben hier ihre Spuren hinterlassen, teilweise in engster räumlicher Verdichtung. So wollte Kaiser Napoleon Bonaparte beispielsweise an der Stelle, wo die Revolutionäre von 1789 das köngliche Gefängnis Bastille stürmten, als Symbol seiner imperialen Macht und als Erinnerung an seinen erfolgreichen Ägyptenfeldzug einen monumentalen Brunnen errichten lassen. Als Brunnenfigur vorgesehen war ein Elefant von 24 Metern Höhe, dessen Leib aus erbeuteten spanischen Kanonen gegossen werden sollte. Eine Aussichtsplattform auf seinem Rücken hätte den Besucherinnen und Besuchern einen Panoramablick erlaubt. Ein Architekt wurde bestimmt, ein Bildhauer schuf einen Elefanten aus Gips und Holz, der 1814 an Ort und Stelle aufgestellt wurde. Doch nach Napoleons verheerenden militärischen Niederlagen im gleichen Jahr, die seine Entmachtung und Verbannung nach Elba zur Folge hatten, wurde das Brunnenprojekt abgeblasen. Daran vermochte auch Napoleons kurzzeitige Rückkehr auf die Schlachtfelder Europas nichts zu ändern. Sie fand in der Niederlage in der Schlacht von Waterloo im Juni 1815 ihr definitives Ende.
Die Umgestaltung der Place de la Bastille musste einige Jahre warten. Erst Louis Philippe, der bei der Julirevolution 1830 als «Bürgerkönig» an die Macht gekommen war, initiierte ein neues Projekt, nämlich den Bau einer 52 Meter hohen Kupfersäule. Bei deren Fertigstellung 1840 waren am Sockel die Namen von 504 Bürgern eingraviert, die sich in der Julirevolution zehn Jahre zuvor verdient gemacht hatten. Die Spitze der Julisäule zierte eine blattvergoldete Figur Genie de la Liberté (Geist der Freiheit) von knapp sechs Metern Höhe – es war längst nicht die einzige namenlose allegorische Frauenfigur, mit der Paris in diesen Jahren verschönert wurde. Zahlreiche andere Prachtbauten entstanden, so etwa der 1851 eröffnete Invalidendom. In ihm wurden die sterblichen Überreste Napoleon Bonapartes in einem sechsfach geschachtelten monumentalen Sarkophag bestattet. Rund um ihn stehen Statuen seiner wichtigsten Generäle und Marschalle – mit Namen selbstverständlich.
Die Prachtentfaltung ist aber nur die eine Seite von Paris, und dafür gibt es kein besseres Beispiel als den Gipselefanten auf der Place de la Bastille. Er blieb nämlich bestehen, auch noch als die Julisäule längst einen Schatten warf. Bald diente der Elefant als bevorzugter Treffpunkt von Bettlern und Randständigen, was Victor Hugo und Heinrich Heine, die darüber Texte verfassten, nicht verborgen blieb. Als er 1846 endlich weggeräumt wurde, stellte sich heraus, dass sein Inneres voll von Ratten war, die in ihm einen Unterschlupf gefunden hatten.
In Paris bestanden extreme Gegensätze von Reichtum und Armut, von Glanz und Elend, von Lebensgenuss und Verachtung. Im Winter lag der Rauch von den Holzheizungen in der Luft; die Hinterhöfe stanken nach Urin von den Schweinen und Hühnern, die in ihnen gehalten wurden. Die Abwässer wurden direkt in die Seine geleitet, die bald einer Kloake ähnelte. Überhaupt waren die hygienischen Verhältnisse so pitoyabel, dass Seuchen wie die Cholera ein einfaches Spiel hatten. Begünstigt wurde dies auch dadurch, dass immer mehr Einwohner in der Stadt lebten. Waren es um 1800 rund 500.000 gewesen, stieg die Zahl bis 1840 auf über eine Million.
Gleichwohl lag, besonders nach der Julirevolution 1830, Aufbruchsstimmung in der Luft. Das Bürgertum hatte sich durchgesetzt, und mit ihm seine Werte wie Erfolgsstreben, Fleiß, Verlässlichkeit und Verantwortungsgefühl. Nicht nur in Frankreich, auch in vielen anderen europäischen Ländern, formierten sich junge Oppositionelle, denen dies nicht weit genug ging. Sie setzten sich mit viel Emphase für einen Nationalstaat ein, für verstärkte bürgerliche Teilhabe auch auf politischer Ebene. Diese war aber nicht so leicht zu haben. In seinem juvenilen Manifest Über die Gerontokratie von 1828, das in seiner Vehemenz vergleichbar mit heutigen Attacken gegen die «alten weißen Männer» ist, polemisierte der Philosoph James Fazy gegen diese Situation. Er mokiert sich über die Unfähigkeit der Geronten, die Notwendigkeiten der aktuellen Gesellschaft zu erkennen. Alle wichtigen Posten in Frankreich hätten sie usurpiert. Sogar im Theater seien die Schauspielerinnen und Autoren – das wertvollste Gut einer Nation – einer Handvoll Männer ausgeliefert, welche sich Seigneurs nannten. Dabei sei doch allgemein bekannt, dass gesellschaftliche Superiorität fast ausschließlich unter den (machtlosen) Intellektuellen zu finden sei.[2]
Nicht nur Fazy hatte dieses Empfinden. Viele junge Menschen sahen sich in eine verwaltete Welt geworfen, in der sie ihre persönlichen Aufstiegsoptionen eher skeptisch beurteilen mussten. Die oberste Schicht von Paris, genannt Tout Paris, bestand aus einem elitären Zirkel von nur rund 2000 Personen, wie Balzac schrieb.[3] Doch in dieser hoch kompetitiven Gesellschaft, in der mit einer gewissen Gnadenlosigkeit um die Plätze an der Sonne gerungen wurde, sahen nicht alle den Sinn darin, bei diesem Spiel mitzutun. Waren Macht und Reichtum wirklich so erstrebenswerte Ziele? Oder gab es anderes, Ruhm vielleicht, nach dem zu streben sich lohnte?
Ein junger Mann, Henri Murger mit Namen, hatte große Träume. Als Sohn eines Schneiders, der gleichzeitig Concierge war (die beiden Berufe ließen sich bestens verbinden), stammte der 1822 Geborene aus der unteren Mittelklasse. Eine bürgerliche Karriere gibt er auf, noch bevor sie richtig begonnen hat. Ohne Enthusiasmus übt er untergeordnete Tätigkeiten in einer Anwaltskanzlei aus. Der geregelte Alltag ödet ihn bald an. Er würde gerne Maler werden, merkt aber, dass sein Talent dafür nicht reicht. Also vielleicht Dichter? Er schließt sich einer Clique von ähnlich denkenden Künstlern an, die sich Buveurs d’Eau (Wassertrinker) nennen. Der Name kommt daher, dass sie aus Kostengründen einzig Wasser trinken. Ihre schöpferische Kraft wollen sie nicht mit Schlemmereien vergeuden, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren. Zusammen leben sie in einem heruntergekommenen Gebäude, das ein Chronist so beschreibt: «Ein großes Tor öffnete sich zu einem Hof voller Mist, wo Hühner und Enten pickten; Arbeiter und Wäscherinnen lebten in einem großen unregelmäßigen Gebäude, das von kleinen Behausungen umsäumt wurde. Steile Holztreppen führten vom Hof hinauf in die verschiedenen Zimmer, die an ein ärmliches Dörfchen erinnerten.»[4] Auch Murger bezieht hier ein bescheidenes Zimmer: «Es war ein kleiner Raum mit einer so niedrigen Decke, dass darin ein großer Mann seinen Hut nicht anbehalten konnte.»[5]
Der Begründer des Boheme-Mythos Henri Murger hat früh mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er leidet an Purpura, einer seltenen, unheilbaren Gefäßentzündung, die schreckliche Hautauschläge und fortgesetzte Schmerzen verursacht.
In diesem Dörfchen inmitten der Großstadt gehen die Künstler, nur Männer, ein und aus, neben Murger auch die Brüder Joseph und Léopold Desbrosses, der Musiker Schanne sowie die Maler Léopold Tabar und Antoine Chintreuil, der zusätzlich in einer Buchhandlung arbeitet. Alle sind sie Autodidakten, keiner stammt aus einer besseren Gesellschaftsschicht; selbst als einigen von ihnen ein moderater gesellschaftlicher Aufstieg gelingt, mögen sie nicht auf die Attitüde der Unterschicht verzichten. Ihre Kleider lassen die jungen Männer absichtlich verlottern; auch rasieren mögen sie sich nicht täglich. Obschon keiner von ihnen studiert hat, ist ihnen ein Bildungshunger nicht abzusprechen. Im Louvre vertiefen sie sich in die großformatigen Meisterwerke vergangener Epochen, sie verschlingen Bücher, die sie aus der Bibliothek Saint Geneviève ausgeliehen haben, und manche besuchen sogar Abendkurse. Murger schreibt später, dass er seine kümmerliche Bildung an den Bücherständen, die entlang der Seine aufgereiht sind, erworben habe.[6]
Außenstehenden mochten die «Wassertrinker» wie eine verschworene obskure Künstlergruppe erscheinen. Es handelte sich um ein informelles Gemeinschaftsexperiment, dessen Mitglieder sich gegenseitig aushalfen und mit Jobs versorgten. Es kostete sie keine Mühe, einen Kollegen um den letzten Sou, das letzte Stück Brot oder den letzten Krümel Tabak anzupumpen. Konzessionen an den Materialismus oder gar bürgerliches Erwerbsstreben waren ihnen ein Gräuel. Dahinter stand ein vom christlichen Glauben getragenes Künstlerbild: Ein wahrer Künstler solle in selbstgewählter Armut leben und für Werte wie Barmherzigkeit und Kompromisslosigkeit einstehen.
In seinem deutlich später veröffentlichten Roman Buveurs d’Eau zeichnet Henri Murger hingegen ein kritischeres Bild dieser Künstlergruppe. Die einzelnen Mitglieder seien durch ein Band unausgesprochener Rivalitäten miteinander verknüpft gewesen. Keineswegs gingen sie so selbstlos miteinander um, wie es ihrem Ideal entsprochen hätte. Ihrem künstlerischen Werk hätten sie alles untergeordnet, auch die Gruppensolidarität: «Zurückgezogen in der Ausübung ihrer Kunst endete für sie die Welt an den Wänden ihres Zimmers oder ihres Ateliers.» Instinktiv scheuten sie davor zurück, ihre künstlerischen Aspirationen einer sozialen Utopie oder einer Schule der Literatur und der Kunst unterzuordnen, «und dieser Respekt vor individuellen Bestrebungen wurde so religiös aufgefasst, dass er der Keim für die spätere Auflösung der Gruppe war».[7]
In seiner Erzählung Un poète de gouttières (Ein Gossenpoet) legt Murger sogar nahe, dass viele Künstler sich in ihrer selbstgewählten Armut und Erfolglosigkeit gefallen. Scheitern ist für sie ein Grund für Hochmut, nicht für Zweifel. Melchior, der Held der Erzählung, ist überhaupt nur schriftstellerisch tätig, um seiner Geliebten zu imponieren. Doch bei ihm trägt der Kult des Scheiterns nicht weit: Sobald er realisiert, dass sie schöne Kleider und Stiefel jeglicher schönen Poesie vorzieht, wird er Kommis eines Händlers – und mit gleichem Geschick geht er nun mit Zahlen um wie früher mit Reimen. Traurige Pointe einer desillusionierenden Geschichte: Das Künstlertum Melchiors war eine aufgesetzte Pose.[8]
Bereits mit zwanzig Jahren wird Henri Murger in das Hôpital Saint Louis eingeliefert. Diagnose: Purpura, eine seltene, unheilbare Gefäßentzündung, die schreckliche Hautauschläge und fortgesetzte Schmerzen verursacht. Seine Briefe, die er aus dem Krankenhaus schreibt, sind tragikomische Zeugnisse eines schwergeprüften jungen Mannes, der trotz aller Beschwerden seine Ideale nicht fahren lässt und auch den Humor nicht gänzlich verliert. «Ich bin von Flammen umhüllt, ich brenne buchstäblich.» Tausend Trompeten schmettern in seinem Ohr, am Nachmittag schafft er es nicht, dreißig Schritte zu machen; er hat beinahe unerträgliches Kopfweh, dazu Ohnmacht und Schwindel, der ihn wie einen Betrunkenen schwanken lässt. Behandelt wird er mit Arsen, zusätzlich wird er «zur Ader gelassen, erneut zur Ader gelassen und eingegipst». Doch die Behandlung bringt keine nachhaltige Linderung der Schmerzen.
Untergebracht ist er in einem riesigen Krankensaal mit 106 Betten. Die Mahlzeiten sind ausreichend, wenn auch nicht besonders lecker. Immerhin werden sie regelmäßig ans Bett gebracht. In seiner Mansarde, schreibt er, hätte er sich auch keine größeren Portionen leisten können. Nach über einem Monat Aufenthalt im Krankenhaus resümiert er desillusioniert: «Unsere Existenz ist wie eine Ballade mit mehreren Couplets: Manchmal geht es gut, manchmal geht es schlecht, später noch schlechter. Aber der Refrain ist immer der Gleiche – Misere!»[9]
Bis zu seinem frühen Tod hat Murger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen; schon rein äußerlich passt er schlecht in die Welt des aufstrebenden Bürgertums. Zeitgenössische Fotos und Karikaturen zeigen einen früh gealterten Mann mit schütterem Bart und hoher Stirn. Die Augen tränen ständig und liegen tief in ihren Höhlen; Augenzeugen berichten von seiner fahlen Gesichtsfarbe. Das kann jedoch auch daran liegen, dass er Unmengen an Kaffee trinkt und ständig in der Nacht arbeitet. Im Krankenhaus hat ihn besonders gestört, dass er genau dies nicht konnte. Denn obschon er ein paar Bücher mitgenommen hatte, fehlte ihm zur Arbeit während seiner bevorzugten Nachtstunden das Licht.
Trotz der widrigen Umstände stürzt sich Murger unmittelbar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in die Arbeit. Für einen Hungerlohn schreibt er Artikel in kleinen Zeitungen, wovon in Paris zahlreiche erscheinen. In einer der bekanntesten von ihnen, dem Corsaire-Safran, erhalten die freien Mitarbeiter nur ein kümmerliches Zeilenhonorar von 6 Centimes. Mit diesem kommen sie kaum über die Runden. Etwas besser bezahlt werden nur die fest angestellten Redakteure. In diesen Zeitungen wird alles verhandelt, was Paris bewegt: häufig pointiert, polemisch, mit Lust an der rhetorischen Spitze und der treffenden Formulierung.[10]
Murgers Fortsetzungsgeschichte über die Boheme, die von seinem eigenen Leben inspiriert ist, findet zunächst noch wenig Beachtung. Der Erfolg kommt erst, als 1849 auf dieser Basis ein Stück entsteht, das Begeisterungsstürme auslöst und jahrelang auf dem Spielplan steht. Nur stellt sich sofort die Frage: Was ist Erfolg? Ist ein Bohemien, der Erfolg hat, nicht ein Widerspruch in sich? Murger jedenfalls ist kein nachhaltiger Reichtum beschieden, obschon sich die später erstellte Buchversion von Scènes de la vie de Bohème ordentlich verkauft. Immer wieder unternimmt er Anläufe, um der ökonomischen Not zu entkommen. Einmal fragt er Victor Hugo an, ob er ihm eine Staatsstelle vermitteln könne. Der Versuch misslingt; Murger schafft den Sprung in eine bürgerliche Existenz nicht, er bleibt in der von ihm geschaffenen Rolle gefangen, als Außenseiter mit einem einzigen Lebensthema: «Murger c’est la Bohème, comme la Bohème fut Murger.»[11] (Murger ist die Boheme, so wie die Boheme Murger war.)
Ein derart legendäres Leben wie das von Murger, bei dem nie klar ist, wo genau die Grenze zwischen bedrückender Armut und Selbstpose verläuft, lädt natürlich zu Parodien ein. Der befreundete Autor Jules Champfleury lässt Murger unter dem Namen Streich in einem Roman auftreten: «Streich hatte eine einzigartige Manie: Er schrieb nur über sein Leben, seine Liebe und die Liebe von Rose. Von Zeit zu Zeit schnitt er ein Abenteuer seines Lebens ab, so wie man eine Scheibe Terrine abschneidet, und brachte diese Scheibe zum [Verleger] Monsieur de Saint-Charmay, der mit Vergnügen diese Art von Biografien von Studenten und Grisettes entgegennahm. Es bleibt unklar, wie Streich es geschafft hat, jeden Monat genau vier solche Abenteuer zu veröffentlichen.»[12]
Murgers Interesse bleibt auf das Private beschränkt. Er ist entschieden unpolitisch, von Reden und Manifesten hält er wenig. Freunde nehmen ihm übel, dass er 1848 nicht vehementer für den Republikanismus eintritt, auch als nach einem Staatsstreich Louis Bonaparte die Macht in Frankreich übernimmt und 1851 unter dem Namen Napoleon III. das Second Empire begründet.[13] Immer häufiger zieht er sich in ein Landhaus in Marlotte, am Rand des Waldes von Fontainebleau in der Nähe von Paris, zurück. Eine öffentliche Ehrung erfährt er, als er 1859 in die Ehrenlegion aufgenommen wird. Doch sein Leben verläuft weiterhin prekär, zumal sich seine gesundheitlichen Probleme verschärfen. Weil Murger sich eine Behandlung im Krankenhaus nicht leisten kann, spendet Graf Walesky 500 Francs. Vergeblich, Henri Murger stirbt mit nur 38 Jahren. Sein Erbe ist so bescheiden, dass der französische Staat die Kosten für das Begräbnis übernehmen muss. 250 Gäste sind eingeladen, ein langer Trauerumzug zieht sich durch Paris, um der großen Symbolfigur der Boheme die letzte Ehre zu erweisen.
Viel später, 1895 erst, als die Boheme längst in vielen anderen Städten Fuß gefasst hat, wird im Jardin du Luxembourg ihm zu Ehren eine Büste enthüllt. In Kupfer gegossen, mit grünlicher Patina, steht sein Kopf auf einem steinernen Sockel in einer stilleren Ecke der städtischen Parkanlage. Rosen ranken sich empor. Wer es nicht besser weiß, würde kaum vermuten, dass die Büste nicht an einen Gelehrten, sondern an die Zentralfigur der Pariser Boheme erinnert, also einen Schriftsteller, zu dessen Markenkern sein lebenslanges Außenseitertum gehörte. Mit seinem Bart sieht er sogar Karl Marx ein wenig ähnlich, dabei konnte dieser, wie wir später erfahren werden, mit der Boheme überhaupt nichts anfangen.
Grisettes und exzentrische Künstlerinnen
Die Boheme, wie Murger und andere sie als Kernelement ihrer Identität schufen, bezog sich besonders in den Anfängen nahezu ausschließlich auf ihresgleichen. Bohemiens, das waren männliche Künstler, die nach einem bestimmten subversiven Ideal lebten und dieses gegen außen zelebrierten. Den Frauen in ihrem Umfeld kam die Rolle der Muse oder Gespielin zu. Degradiert zu Objekten des männlichen Begehrens, waren sie zwar unverzichtbare Begleiterinnen, aber keine eigenständigen Akteurinnen. Sie waren dazu ausersehen, die geistigen Höhenflüge der Männer zu unterstützen, und das in ganz unterschiedlichen Rollen: indem sie sich entzogen und sich aus der Ferne anhimmeln ließen, indem sie verführten und erotischen Kitzel boten; indem sie zuhörten, animierten und trösteten, wenn es einmal nicht so gut lief. Ihre Care-Arbeit im Hintergrund war wohlgelitten, wenn auch selten öffentlich wertgeschätzt. Diese patriarchale Zuschreibung durchzieht die gesamte Frühgeschichte der Boheme.
Jedoch eröffnete eine Großstadt wie Paris auch für Frauen neue Perspektiven. Viele von ihnen, gerade aus den mittleren und unteren Gesellschaftsschichten, waren aus dem ländlichen Raum in die Großstadt gezogen. Hier fassten sie in zahlreichen Berufsgattungen Fuß, teilweise auch in solchen, die bis dahin den Männern vorbehalten gewesen waren. So sind im neunbändigen, vom Buchhändler Léon Curmer herausgegebenen Lexikon Les Français peints par eux-mêmes (wörtlich: Die Franzosen, wie sie sich selbst malen; nicht weniger als fünf Bände sind der Hauptstadt Paris gewidmet), auch zahlreiche Frauenberufe wie Hebamme, Zimmerdame, Femme politique, Jeune Fille, Fruitière (Früchtehändlerin) oder Krankenschwester verzeichnet. Die prächtig illustrierten Bände stellen ein reichhaltiges Kompendium von nicht weniger als 300 Typen von Französinnen und Franzosen dar. Verfasst sind die einzelnen Artikel nicht im sachlichen Stil eines klassischen Lexikons, sondern als lustvolle Typenbeschreibungen mit literarischem Anspruch. Auch Stilmittel wie direkte Rede, Ironie oder satirische Zuspitzung finden sich, machen geradezu die Qualität der Artikel aus. Manche Eigenart eines Typs wird liebevoll auf die Schippe genommen und überzeichnet. Auch subtile Gesellschaftskritik spielt eine Rolle, etwa wenn über die resolute Früchtehändlerin, eine füllige Frau, welche die Hälfte ihres Lebensalters überschritten habe, gesagt wird: «Wir verstehen, dass eine solche Frau, obwohl sie verheiratet ist, niemals das Potenzial ihres Ehemanns hat. Darin wie in vielem anderen irrte das Gesetz, das sie zur Unterwerfung verpflichtete. Der Ehemann einer Früchtehändlerin ist ein problematisches Wesen, das zweifellos existiert, das wir aber nicht sehen, das wir nicht kennen und über das wir nicht sprechen.»[14]
Ein Artikel ist der Grisette gewidmet, einer Figur, deren Bedeutung für die Boheme gar nicht überschätzt werden kann. Der Autor Jules Janin behauptet gleich zu Anfang, dass es Grisettes nur in Paris gebe, nicht aber in London, St. Petersburg oder Berlin. Es handelt sich um Frauen aus der Unterschicht, die sich in der Großstadt als Näherinnen oder als Verkäuferinnen durchschlagen. «Ihre fleißigen Hände verarbeiten unaufhörlich Gaze, Seide, Samt und Leinwand.» Nicht selten schicken sie an ihre auf dem Land verbliebenen Familien Geld. Die Bezeichnung Grisette kommt von der meist selbstgenähten grauen Kleidung, die sie tragen. Obschon eine Grisette kaum mehr als eine Fabrikarbeiterin verdient, ist sie schon wegen ihres Berufes besser als diese angezogen: «Kurz nach Tagesanbruch steht die Grisette auf, sie wäscht sich, sie kämmt ihr schönes Haar von oben nach unten und zieht daraufhin ihre blitzsaubere Kleidung an, die sie tagsüber anbehalten wird.»