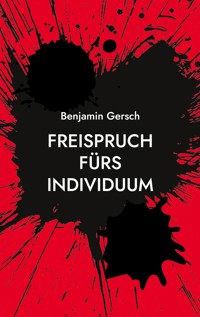
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Trockene, gelehrte Abhandlungen über das bedingungslose Grundeinkommen gibt es viele. Dieses Buch ist anders. Der Autor liefert eine wütende Polemik, die Mut machen will, an eine bessere Welt zu glauben, sich für ein BGE einzusetzen und mit grimmigem Humor durchzuhalten. Ein geistreiches Vergnügen für die geschundene Seele, voll Spott, Sarkasmus, bissiger Ironie und klarer Kanten gegen alle, die die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums verabscheuen. Denn darin liegt der eigentliche, immer aktuelle Wert der Idee.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Trockene, gelehrte Abhandlungen über das bedingungslose Grundeinkommen gibt es viele. Dieses Buch ist anders. Der Autor liefert eine wütende Polemik, die Mut machen will, an eine bessere Welt zu glauben, sich für ein BGE einzusetzen und mit grimmigem Humor durchzuhalten.
Ein geistreiches Vergnügen für die geschundene Seele, voll Spott, Sarkasmus, bissiger Ironie und klarer Kanten gegen alle, die die Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums verabscheuen. Denn darin liegt der eigentliche, immer aktuelle Wert der Idee.
Inhaltsverzeichnis
Erste, grobe Schussrichtung: Würde und Freiheit
Statt Arbeitshaus: Selbstbestimmte Individuen im solidarischen Miteinander
Ausgrenzung der Grundsicherungsbezieher nachhaltig verhindern
Andere Arbeitswelt, andere Grundsicherung
Geschenke für Reiche?
Verdeckte Armut und allgemeines Armutsprinzip
Der technische Fortschritt kann kommen – die Arbeit bleibt trotzdem, nur anders und woanders. Aber: Gegen ihre kulturelle Überhöhung
Neoliberalismus bedeutet: Armut als Bestrafung auf der einen und ungebremstes Geldscheffeln auf der anderen Seite. Er macht krank und zerreißt unsere Gemeinschaft. Sozialschmarotzer und Leistungsträger – aber wer ist wer? Kulturelle Symbolproduzenten: Angepasste Aufsteiger und freie Reiche
Bedingungsloses Grundeinkommen und anderes. Autoritäre Vollbeschäftigung. Volkswirtschaftliche Einsprengsel
Erste, grobe Schussrichtung: Würde und Freiheit
Das bedingungslose Grundeinkommen ist keineswegs eine notwendige oder gar automatische Folge gesellschaftlicher Veränderungen, etwa des Wegfalls von Arbeitsplätzen oder der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Der Kern des BGE, der politisch links, mittig und rechts Anstoß erregt, ist die neue Freiheit des Individuums. Einen Schutzraum zu errichten gegen Paternalismus und Konformismus unter dem Label des solidarischen Sozialstaats oder des neoliberalen Wettbewerbs, ist ein wichtiger Leitgedanke meiner Bemühungen. Dieser Essay spürt den Blockaden und den Blockierern nach, die ein bedingungsloses Grundeinkommen verabscheuen. Ich seziere kleinmütige Bedenkenträger, bornierte Funktionäre, verknöcherte Eliten und kaltherzige Autokraten.
Der schlichteste Gedankengang zum bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) ist dieser: Jeder Mensch, den wir zu unserer Gemeinschaft zählen (langfristig also die Menschheit), muss in allen gesellschaftlichen Bereichen umfassend teilhaben können, weil er Mensch ist und in Würde seine Möglichkeiten kennenlernen, sie entfalten und frei sein will. Für diese Teilhabe braucht er ein ausreichend hohes Einkommen – denn ohne Einkommen kann man nicht leben. Eine Kürzung oder gänzliche Verweigerung dieses Einkommens, um (erpresserische) „Arbeitsanreize“ zu schaffen, muss verfassungsrechtlich verboten werden. Nur ein System, in dem jeder Mensch dieses Einkommen erhält, darf sich als legitimiert betrachten. Nur das BGE kann dies gewährleisten und hat auch in weiteren Aspekten jeder anderen Grundsicherung vieles voraus.
Die Idee ist so einfach, dass sie das Misstrauen gewiefter Politschlachtschiffe erregen muss und Enttäuschung produziert: direkt Geld geben, ohne viel Aufhebens? Die banale Kausalkette akzeptieren: „Mensch muss leben. Leben geht nur mit ausreichend hohem Einkommen. Also jedem Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen“? Das darf die Lösung doch nicht sein. Es muss einfach schiefgehen. Kann ja nur. Kommt von den anderen, also ist es schlecht. Linke lassen sich einen neoliberalen Trojaner unterjubeln, wenn sie es befürworten. Rechte verfallen in gefährlichen Sozialismus, wenn sie die Idee unterstützen. So schlagen die Granden munter aufeinander ein.
Das bedingungslose Grundeinkommen entspringt der egalitären, solidarischen Freiheit des Individuums und dem bedingungslosen Menschenrecht auf Leben – dieser Gleichmacherei bekenne ich mich schuldig: Grundrecht Grundeinkommen, direkt und klar und unantastbar. Es besitzt die nötige Frechheit, um die ganze Idee der Mindestsicherung, ob nun Armut verfestigend oder bedarfsdeckend, mit oder ohne Sanktionen, zum Duell zu fordern. Die bedarfsdeckende, sanktionsfreie Mindestsicherung, wie Die Linke als auf diesem Gebiet progressivste Kraft sie derzeit fordert, ist ein gewaschenes und geföhntes Arbeitslosengeld II. Auf ihren Grabstein vielleicht: Sie war besser als nichts.
Ein menschenwürdiges Dasein muss man sich weder auf dem Markt verdienen noch in der Behörde erbetteln beziehungsweise genehmigen lassen oder vor Gericht erstreiten. Eine selektive, bedingte Grundsicherung wie die Mindestsicherung lindert die materiellen Schmerzen der Gescheiterten, erzeugt aber neues Leid – etwa durch die Aussage, ein Gescheiterter zu sein, und die Praxis, ihn als unmündiges, schwer erziehbares Kind zu behandeln. Mindestsicherung, die berüchtigte „Stütze“, ist eine Demütigung, eine Entwürdigung nicht zuletzt des Erwachsenen in uns. Eine universelle Grundsicherung wie das bedingungslose Grundeinkommen in ausreichender Höhe behauptet, zum freien Leben, Streben und Leisten in Würde und Sicherheit zu ermutigen. Ein Leben in Eigenregie versprechend, ist es viel mehr als die Beseitigung von Armut. Locker überschreitet es die Grenzen der Sozialpolitik und wandert auf die Felder der Gesellschaftspolitik und der Kultur.
Der Neoliberalismus setzt zwei Alternativen: wirtschaftliche Stärke oder soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit wurde lange als Nice-to-have angesehen, als etwas, das man sich gönnt, wenn die Wirtschaft gut läuft: als Umverteilung der Güter, die eine starke, auf Unerbittlichkeit beruhende Wirtschaft hervorgebracht hat. Sie stand sogar im Verdacht, die Forderung der schlechtweggekommenen Leistungsverweigerer oder Underachiever zu sein.
Ein Relaunch glaubwürdiger progressiver Positionen wird die Klugheit der umgekehrten Reihenfolge betonen: Erst soziale Gerechtigkeit bringt ein Land auch wirtschaftlich nach vorne. Soziale Gerechtigkeit ist kein Image-Accessoire, das am Ende der Tagesordnung ansteht, wenn noch 10 Minuten Zeit sind. Sie ist nicht der sich ergebende Spielraum in Boomzeiten, sie folgt nicht nach der Berücksichtigung vermeintlicher Sachzwänge. Sie ist die Voraussetzung für eine friedliche, funktionierende Gesellschaft und damit für eine florierende Wirtschaft. Denn die Prosperität einer Gesellschaft hängt in jeder Hinsicht maßgeblich davon ab, dass möglichst viele Menschen genügend kaufen können und außerdem denken: Ich bin nicht ausgeschlossen, ich gehöre in meiner vollen Freiheit dazu – da mache ich mit, das Leben birgt Möglichkeiten, hier lohnt sich Anstrengung, denn es geht gerecht zu.
Aufgabe der Politik ist es, Hindernisse abzubauen, die diesem Zustand im Weg stehen. Erst dann hat ein Land die Chance, den nachhaltigen Fortschritt zu sichern. Ansonsten erstickt es Leistung, befasst sich zur Wahrung des inneren Friedens ständig mit den Problemen der Desintegration und Demontage vorhandener Fähigkeiten vieler Gesellschaftsmitglieder und tritt auf der Stelle. Wer eine Gesellschaft nicht ganzheitlich denkt, sondern ihre stärksten Gruppen überprivilegiert, während er die Schwächsten vergisst oder niedermacht, der wird uns nicht helfen, sondern spalten.
Leistung ermöglichen, alle mitnehmen, um gemeinsam vorwärts zu gelangen, wirtschaftlich wie kulturell wie sozial, ohne Ausgrenzung, basierend auf dem Vertrauen in die Leistungswilligkeit des Einzelnen, auch weil wir ohnehin keine andere Wahl haben und nie eine hatten – darum muss es uns gehen. „Miteinander füreinander leisten“, wie Götz Werner Wirtschaft definierte.
Eines der vielen hehren Ziele dieser (freejazzig geratenen) Schrift – ich sage es am besten gleich ganz offen – ist daher die Implantierung eines schlechten Gewissens wegen der geduldeten, sogar geforderten Drangsalierungen von Arbeitslosen sowie der wuchernden materiellen Ungleichheit. Insgesamt kann man den Text lesen als Aggression gegen die Unfreiheit durch Mindestsicherung, Marktradikalismus (Neoliberalismus) und Erwerbsarbeitszentrierung, inklusive der von Regierenden wie Regierten geteilten Mentalität, die diese Verhältnisse stützt – naja, und Kapitalismus natürlich, den wir tilgen müssen, um die richtigen Anreize zu setzen. Kapitalismus definieren wir einfach als eine Organisationsform, in der das Kapital einiger weniger Menschen Vorrang vor den Bedürfnissen der Mehrheit hat.
Hauptanliegen dieses Textes ist es, die Grundversorgung so zu gestalten, dass individuelle Freiheit durch fraglose gesellschaftliche Teilhabe entsteht, die durch die uneingeschränkte Erlaubnis zum Neinsagen zu allen Arbeiten, die dem jeweiligen Individuum nicht entsprechen, das positive Hinwenden zu eigenen Zielen grundiert. Denn neben all den vielen wunderbaren Funktionen, die ein sozial gerecht finanziertes BGE in ausreichender Höhe erfüllt, ist dies sein starkes Herz: Freiheit des Individuums – Herz auch dieses Textes.
Statt Arbeitshaus: Selbstbestimmte Individuen im solidarischen Miteinander
Wer gegen die Sanktionen und für die Bedarfsorientierung bei Bürgergeld-Empfängern kämpft, der kämpft für Millionen Bürgerinnen und Bürger. Aber noch mehr Menschen sind von dieser Not gar nicht betroffen – jedenfalls nicht unmittelbar und nicht auf den ersten Blick erkennbar. Man ruft ihnen zu: „Soziale Gerechtigkeit!“ Und sie verstehen: „Ach, ich soll Almosen abgeben.“
Solange wir die Unterscheidung zwischen Leistungserbringern und Leistungsempfängern, zwischen Gebern und Nehmern, anhand des Vorhandenseins eines Erwerbsarbeitsplatzes vornehmen, wird das auch so bleiben. Das entsolidarisiert unsere Gesellschaft.
Die Mindestsicherung, auch wenn wir sie bedarfsorientiert und sanktionsfrei ausgestalten, zementiert diese soziale und mentale Spaltung zwischen „Gebenden“ und „Nehmenden“. Die Empfänger würden weiterhin als „der Gesellschaft auf der Tasche“ liegende Nutznießer der „sozialen Mildtätigkeit“ der „Leistungsträger“ diffamiert werden können, die „in diesem Land noch Steuern zahlen“, und vor der rhetorisch eigentlich langsam mal durchgelegenen „sozialen Hängematte“ würde selbstverständlich gewarnt.
Die Mindestsicherung hebt die Zwei(und mehr)-Klassen-Gesellschaft nicht auf. Sie kann die kurzsichtige „Erwerbseinkommen=nützlich, kein Erwerbseinkommen=nutzlos“-Perspektive nicht aufbrechen, da weiterhin zuvorderst gefragt werden würde: „Hast Du einen Job?“ bzw. „Kannst Du davon leben?“, um den Beitrag eines Individuums zum Gemeinwohl zu ermessen.
Das BGE hingegen lenkt den Blick durch den Steuerzahler- und Erwerbsarbeiter-Schleier hindurch auf den fraglos anzuerkennenden Menschen und auf die von ihm gewählte Tätigkeit (die der eigentliche Beitrag zur Gesellschaft ist!), um seinen allgemeinen „Nutzen“ einzuschätzen. In einer BGE-Kultur haben alle Menschen die Chance, die Anerkennung zu erfahren, die für die psychische Entwicklung und damit für das Gelingen des Lebens von entscheidender Bedeutung ist. (Soziale Anerkennung ist das Rückgrat des Lebens, sie erzeugt Selbstbewusstsein, Attraktivität, legt den Grundstein für Erfolg. Das kann nur geringschätzen, wem sie noch nie tiefgehend und dauerhaft entzogen wurde.) Das BGE operiert mit der intrinsischen Motivation, ohne äußere Anreize wie z. B. Entlohnung abzuschaffen: Es erfüllt eine Bedingung, um dort Leistung zu ermöglichen, wo wir als Bürgerinnen und Bürger es für sinnvoll halten.
Eine Mindestsicherung kann dies nicht bewirken, da die „Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“, meint: die Aufnahme einer Vollerwerbsarbeitsstelle (ggf. zu allen Bedingungen), weiterhin im Vordergrund stünde. Das aber widerspricht der Unterschiedlichkeit der notwendigen Tätigkeiten und negiert die Bedeutung des freien, selbstbestimmten Entschlusses, um eine Tätigkeit produktiv und in Würde ausüben zu können. Denn eine mögliche Entfremdung (um hier einen alten marxistischen Hit in dem engen Rahmen, in dem er nützlich ist, an den Start zu schicken) findet nicht erst während der Arbeit statt. Sie beginnt bereits im Vorfeld, wenn ich sie unter Zwang aufnehmen muss. Entfremdung, also das Gefühl, Betroffener, aber kein Beteiligter zu sein, nicht der Träger meiner Entscheidungen, sondern ein passiver Empfänger von Entscheidungen – ein Individuum, das entschieden wird –, beginnt mit der Unmöglichkeit, nein zu sagen. Freie Berufswahl haben wir schon. Und bei allen „Fehlallokationen“ von menschlicher Arbeitskraft, die bei dieser Lösung anscheinend immer wieder auftreten (aber auch nicht immer unbedingt auf sie zurückzuführen sind), macht es uns glücklicher und produktiver, keinen nach Marktlage und vermeintlichen Fähigkeiten ausgewählten Beruf verpflichtend zugeteilt zu bekommen.
Das BGE geht einen Schritt weiter und schreibt, ohne dass Erwerbsarbeit ihren Reiz verliert, keine bestimmte Tätigkeit oder Tätigkeitsform mehr vor, in der wir gefälligst Sinn zu entdecken haben. Die Vermehrung der Autonomie des Individuums ist eine Geschichte des Erfolges der westlichen Welt. Filmische und literarische Dystopien sind fast immer mit dem Gegenteil verbunden. Das Grundeinkommen in die Siegesgeschichte des sich selbst lenkenden Staatsbürgers einzuordnen, kann dabei helfen, das Revolutionäre seiner Bedingungslosigkeit zu denken.
Eine gesellschaftliche Ordnung mit Mindestsicherung erschwert die soziale, kulturelle und sogar unternehmerische Initiative der Menschen, da sie ihnen suggeriert, dass jede Aktivität, die nicht in Form eines Erwerbsarbeitsplatzes geregelt ist oder nicht unmittelbar und garantiert in einen mündet, maximal zweitrangig sein kann, wenn sie sich zum höchsten anzustrebenden Ziel nicht sogar parasitär verhält. Bildungsbemühungen belastet eine solche Ordnung mit der Frage nach der Finanzierung des Lebensunterhaltes. Der Geist der Mindestsicherung für all diejenigen, die „sich nicht selbst versorgen“ können (welch ein fabelhafter Quatsch in der Fremdversorgungsgesellschaft), übt damit Druck auf jeden Bürger und jede Bürgerin aus, ein Erwerbsarbeitsverhältnis zu suchen, um ihr Leben nicht als defizient wahrnehmen zu müssen. Sie bleiben mental, finanziell und in ihrer vollen Anerkennung als Mitglied unserer Gemeinschaft von den Herren der Arbeitsgesellschaft abhängig, die ihr Ja oder Nein zur Anstellung geben und damit per cäsarischem Daumen über den gesellschaftlichen und finanziellen Status sowie das Selbst- und Fremdwertgefühl der Menschen befinden. Ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen entscheidet, sofern man nicht reichlich geerbt hat, die kapitalistische Nützlichkeit, die Marktgängigkeit, darüber, ob wir jemanden (uns selbst und andere) respektieren oder nicht. Unsere Verachtung für die Armen ist frappant.
Die Mindestsicherung proklamiert, in totaler Verkennung der vollständigen Wertschöpfungskette – man denke zum Beispiel an Reproduktionsarbeit – und der sonstigen gemeinwohlbildenden Notwendigkeiten, eine unangemessene Hierarchie der Tätigkeiten und betreibt eine antifreiheitliche Engführung menschlicher Orientierung auf permanente Erwerbsarbeit, die finanziell und ideell zunehmend unter Druck gerät. Vielen geht es so: Ich rief nach einer guten, sicheren Arbeit, die mich lange ausfüllt. Und hörte nur das Echo.
Das lähmt die Menschen, zehrt an ihrer Kraft und verstellt ihren Blick für notwendige, manchmal Mut zum Risiko erfordernde Aufgaben, zu denen etwa auch das freie Suchen der eigenen Fähigkeiten und Interessen gehört, bei dem Scheitern und Irrwege wieder erlaubt sein müssen. Es macht sie außerdem erpressbar für schlechte Arbeitsbedingungen.
Ein Arbeitsmarkt, der diesen Namen verdient, da die Begegnung der Verhandlungspartner auf Augenhöhe geschieht, kann mit einer Mindestsicherung niemals realisiert werden. Wo Erwerbsarbeit sozial, kulturell und finanziell oberste Pflicht bleibt und ihr Nichtvorhandensein einen Absturz in allen drei Sphären nach sich zieht, bestimmen die „Anbieter“ von Erwerbsarbeit sowie das politische und gewerkschaftliche Führungspersonal über die Würde des Menschen.
Jede Form von Mindestsicherung unterwirft sich diesem Machtgefüge. Nur das BGE weist in eine andere Richtung; nur mit einem BGE sind bessere Arbeitsbedingungen langfristig durchsetzbar.
Bewerbungsratgeber präsentieren sich in erschlagender Fülle. Zielgruppe sind fast immer die Jobsuchenden. Bewerbungsratgeber für Unternehmen jeder Branche – das wäre ein Novum.
Erst mit dem bedingungslosen Grundeinkommen konstituiert sich das souveräne demokratische Subjekt, das unter Anerkennung der anderen Subjekte sein Leben in der Gemeinschaft selbstbestimmt entwirft, ohne dafür den Umweg über die Erwerbsarbeit einschlagen zu müssen – die in ihrer heutigen Form ohnehin nicht Selbstbestimmung zum Ergebnis hat. Der Mensch mit BGE gebietet über ausreichende Ressourcen, um die Entscheidung, welche Tätigkeit unter welchen Bedingungen mit welcher Bezahlung angemessen ist, nach persönlichem Urteil zu fällen und um als Einzelkämpfer oder im Verbund mit anderen für bessere Bedingungen zu streiten oder sich in Ruhe etwas anderes zu suchen. Durch ein entsprechend hohes BGE geben wir die Festlegung von Zumutbarkeitskriterien und die Definition von „guter Arbeit“ direkter als heute in die Hände des einzelnen Individuums, das sich zur besseren Durchsetzung seiner weiteren Vorstellungen jederzeit mit Gleichgesinnten zusammenschließen kann. Gestärkt auch hier durch den lebenslangen bedingungslosen Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe.
Das mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ausgestattete Individuum kann sofort ablehnen, wenn ihm aus seiner Sicht unangemessene Entlohnungen oder Arbeitsbedingungen angeboten werden, ohne auf die Ebene des Sozialfalls, deutlicher: des „Sozialschmarotzers“ abzurutschen. Muss der Einzelne heute seine Vorstellung von schlechter Arbeit, die man ablehnen darf, in langwierigen und kraftraubenden Verfahren über Mehrheiten in den Parteien und bei den Wählern mühsam erkämpfen, kann er mit einem unantastbaren BGE „Nein“ sagen, wo er „Nein“ empfindet, ohne von gesellschaftlicher Teilhabe abgeschnitten zu sein und einen Rechenschaftsbericht vorlegen zu müssen. Jeder hat dieses Recht – ein zivilisatorischer Fortschritt, den es unabhängig vom jeweiligen Wirtschaftssystem, in dem wir leben, zu verteidigen gilt. Es wird normal sein und nicht anrüchig, eine bestimmte Arbeit abgelehnt zu haben, weil sie als nicht sinnvoll erkannt wurde oder die Bedingungen nicht stimmten. „Anrüchig“ beschreibt die derzeitige gesellschaftliche Wertung der Arbeitsablehnung nur sehr mager. Wer sich heute zu den guten Menschen zählt, der dreht durch und bekommt Wutanfälle, veritable Prügelphantasien, wenn er davon hört, dass ein Arbeitsloser ein Arbeitsangebot ausgeschlagen hat. Der Problemkomplex aus Arbeit und Freiheit ist in meinen Ausführungen deshalb auch ein permanenter Gast, der mal deutlich zu erkennen ist und mal nur im Hintergrund mitläuft.
Im neoliberalen Kapitalismus ohne BGE verkauft man seine Arbeitskraft zu jedem Preis an eine mächtige Minderheit. In einem demokratischen Sozialismus ohne





























