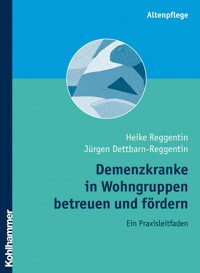Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In die Versorgung pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen werden zunehmend Freiwillige einbezogen. Veränderte und steigende Erwartungen an die Pflege bei gleichzeitiger Kostenbegrenzung stehen ebenso hinter den Forderungen nach einem Ausbau des Laienhelfersystems wie abnehmende Pflegepotenziale in der häuslichen und stationären Pflege. Dieses Buch zeigt Notwendigkeiten, Chancen und Risiken der Pflege und Betreuung durch Laienhelfer auf. Die Autoren gehen den Fragen nach dem Bedarf, den Potenzialen, den Qualitätsstandards und der Motivation Freiwillig Engagierter nach und werfen die Frage auf, welchen Einfluss der Einsatz Freiwilliger auf das Kosten- und Leistungssystem nehmen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In die Versorgung pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen werden zunehmend Freiwillige einbezogen. Veränderte und steigende Erwartungen an die Pflege bei gleichzeitiger Kostenbegrenzung stehen ebenso hinter den Forderungen nach einem Ausbau des Laienhelfersystems wie abnehmende Pflegepotenziale in der häuslichen und stationären Pflege. Dieses Buch zeigt Notwendigkeiten, Chancen und Risiken der Pflege und Betreuung durch Laienhelfer auf. Die Autoren gehen den Fragen nach dem Bedarf, den Potenzialen, den Qualitätsstandards und der Motivation Freiwillig Engagierter nach und werfen die Frage auf, welchen Einfluss der Einsatz Freiwilliger auf das Kosten- und Leistungssystem nehmen wird.
Heike Reggentin, Dipl.-Pol., Sozialwissenschaftlerin, Gerontologin. Jürgen Dettbarn-Reggentin, M.A., Sozialwissenschaftler, Gerontologe, Architekt, Gesellschafter des Instituts für sozialpolitische und gerontologische Studien (ISGOS) Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Forschungen zu Pflege, Wohnen und Demenz, Milieutherapie, alternative Wohnformen für Menschen mit demenziellen, geistigen und körperlichen Erkrankungen, Ambient Assisted Living (AAL), Beratung und Begleitung bei deren Umsetzung.
Heike Reggentin Jürgen Dettbarn-Reggentin
Freiwilligenarbeit in der Pflege
Pflegearrangement als zukünftige Versorgungsform
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2012 Alle Rechte vorbehalten © 2012 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Umschlagsabbildung: © tiero-Fotolia.com Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN: 978-3-17-019306-2
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-026527-1
epub:
978-3-17-027896-7
mobi:
978-3-17-027897-4
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
1 Grundfragen in der Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
1.1 Demografischer Wandel und Entwicklung der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
2 Solidarität im System häuslicher Pflege
2.1 Privathaushalte und Haushaltstypen
2.2 Solidarpotenzial und Motive zur Pflege von Angehörigen
2.3 Gesellschaftliche und milieuspezifische Einflussfaktoren auf die Pflegebereitschaft
2.4 Familienunterstützende Pflegenetzwerke
2.5 Quartiersbezogene Netzwerke
2.6 Flankierende und entlastende Maßnahmen für pflegende und betreuende Familienangehörige
3 Freiwilligenarbeit, Freiwilliges Engagement, Ehrenamt
3.3 Motive für das Freiwillige Engagement
3.4 Neues Ehrenamt – neue Motive?
3.5 Einfluss des Lebensalters auf das Freiwillige Engagement
3.6 Beteiligung nach Geschlecht
3.7 Zeitaufwand und Zeitverfügung
3.8 Zugangswege zum ehrenamtlichen Engagement, früheres Engagement
3.9 Ehrenamtliches Engagement und Erwerbstätigkeit
3.10 Regionale Unterschiede und milieuspezifische Einflüsse
4 Engagementbereiche in der Pflege und Betreuung
4.1 Personen in institutionellen Versorgungsformen
4.2 Formen des Freiwilligen Engagements in der Pflege
4.3 Motive freiwillig Engagierter in der Pflege und Betreuung
4.4 Können freiwillig Engagierte das soziale Netz stärken und die Arbeit von Pflegekräften ergänzen?
4.5 Pflegearrangements und beteiligte Personen
4.6 Aufgaben professioneller Pflege im Rahmen von Pflegearrangements
4.7 Pflege und Betreuung durch Angehörige
4.8 Pflege und Betreuung durch Ehrenamtliche
4.9 Pflege und Betreuung durch bezahlte Laien und angelernte Kräfte
4.10 Abgrenzung Ehrenamt und professionelle Pflege
4.11 Schulung und Qualifikation von Angehörigen und Ehrenamtlichen
4.12 Entgelt im Ehrenamt – Monetarisierung des Freiwilligen Engagements
4.13 Pflegearrangement/Pflegemix – Perspektiven
4.14 Was bewirkt Freiwilliges Engagement?
5 Freiwilliges Engagement als Lernfeld in einem handlungsbezogenen Bildungsansatz
5.1 Empowerment durch Bildung
5.2 Gesellschaftlicher Bezug – Bezug zur Arbeitswelt
6 Soziale Netzwerke und Kommunikation im Freiwilligen Engagement
6.1 Merkmale von Netzwerken
7 Gemeinwesenbezogene Netzwerke – Freiwilliges Engagement – Bürgerschaftliches Engagement
8 Was fördert ein Freiwilliges Engagement in der Pflege?
8.1 Entlastungsmaßnahmen für Pflegepersonen – Einbindung freiwilliger Helfer
8.2 Erwerbsarbeit und Freiwilliges Engagement im Gesundheits- und Sozialbereich
8.3 Unterstützungen durch Engagement in Selbsthilfegruppen
8.4 Ausbau der Vermittlungsstellen
8.5 Hilfen für alleinlebende Pflegebedürftige ohne familiale Pflegepotenziale
8.6 Familienstützende Leistungen – familienähnliche Zusammenlebensformen
8.7 Tagespflege und Tagesbetreuung mit Laienhilfe
8.8 Freiwilliges Engagement in stationärer Versorgung
8.9 Aufgaben der Unterstützung durch Institutionen – Versorgung mit Alltagshilfen, komplementären Diensten und Ehrenamtlichen
9 Perspektiven der Freiwilligenarbeit in der Pflege und für die soziale Sicherung
9.1 Verbesserungswünsche
9.2 Konkurrenz am Markt und marktbeeinflussende Wirkung
Zusammenfassung und Diskussion
Literatur
Konzepte
Stichwortverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Vorwort
Warum befassen wir uns mit der Freiwilligenarbeit und dem Freiwilligen Engagement in der Pflege? Vor dem Hintergrund demografisch bedingter Einflüsse auf die Strukturen sozialer Gemeinschaften rücken deren mögliche Folgen in den Blickpunkt. Die grundsätzliche Verlässlichkeit sozialer Sicherungssysteme wird zwar nicht in Frage gestellt, jedoch wird deren Umfang an Leistungen in Zukunft nicht mehr in dem bisherigen Ausmaß zu erwarten sein. Grenzen der Kosten und der Pflegepersonalressourcen wie auch sich abschwächende häusliche Pflegepotenziale rufen nach weitergehenden Unterstützungsstrukturen.
Umstrukturierungen begründen sich auf Personen und ihre Bereitschaften, Veränderungen mitzutragen. Da sind in erster Linie die Angehörigen zu nennen, deren Pflegebereitschaft auch in Zukunft die tragende Säule in der Pflege sein kann, wenn sie in ausreichendem Maße unterstützt werden. Es ist heute bereits absehbar, dass ein wachsender Bevölkerungsteil auf die Leistungen von Angehörigen aus unterschiedlichen Gründen verzichten muss. In beiden Fällen sind Versorgungsangebote zu schaffen, die den Anspruch auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen und ihrer Angehörigen erhalten.
Im Zuge der Neuorientierung sind nicht nur die Betroffenen und ihre Angehörigen gefordert, sondern die Bürger in ihrem sozialen Nahbereich, die sich verantwortlich für einander einsetzen. Hierzu werden sozialpolitische Steuerungsleistungen gefragt sein, die den Zusammenhalt fördern. In erster Linie werden die Kommunen angesprochen, die auf verschiedenen Ebenen die Voraussetzungen dafür stellen müssen, denn es wird zukünftig eine Konzentration auf die Förderung von Solidarität für Hilfe- und Pflegebedürftige in der Kommune und eine Verantwortung für das Gemeinwesen erforderlich. Hilfebedürftige und ihre Angehörigen müssen eine verlässliche Unterstützungsstruktur vorfinden.
Den in der folgenden Darstellung im Fokus stehenden freiwillig Engagierten und der Freiwilligenarbeit kommt in dem Angebots- und Leistungsspektrum des Sozial- und Gesundheitsbereichs eine zunehmend tragende Rolle zu. Der Entlastungseffekt des freiwilligen Engagements in der Pflege liegt in der Stützung des sozialen Zusammenhalts durch neue Formen der Solidarität und Integration. Ein weiterer Aspekt liegt in der Sicherung der Individualität bzw. der individualisierten Lebensweise auch bei Pflegebedürftigkeit. Soziale Ungleichheiten, die durch Pflegebedürftigkeit verschärft werden, könnten damit etwas an ihrer Brisanz verlieren. Nicht zuletzt verschaffen sich freiwillig Engagierte auch selbst einen Gewinn durch die Erweiterung ihres persönlichen Netzwerkes und den Erwerb sozialer Kompetenz.
Das Ausmaß des Bedarfs an Laienhilfe wie aber auch die Bereitschaft zum Freiwilligen Engagement führt zu der Frage, ob Humankapital zukünftig verfügbar sein wird oder ob verpflichtend ein Freiwilligendienst in der Pflege eingeführt werden muss. Nicht zu übersehen ist die Gefahr einer Vereinnahmung der Freiwilligenarbeit durch Organisationen und Träger der Alten- und Behindertenhilfe, denn Tendenzen in dieser Richtung bestehen.
Eine mögliche Chance, Freiwilliges Engagement als zivilgesellschaftliches Korrektiv institutionalisierter Versorgungsstrukturen im Altenhilfe- und Behindertenbereich einzusetzen, könnte durch Verpflichtungs- und Verrechtlichungstendenzen gefährdet werden.
Das Humankapital des Freiwilligen Engagements beruht auf Partizipation und Freiwilligkeit. Es steht an der Schnittstelle zwischen konventionellen Versorgungsstrukturen und freiwillig erbrachten Leistungen. Beide Seiten, Gebende wie auch Empfänger, sollten ohne Druck miteinander abstimmen, welche Aufgaben wahrgenommen werden. So könnten erweiterte soziale Netzwerke entstehen und aus denen heraus verlässliche Verantwortungsstrukturen erwachsen.
Berlin, Januar 2012
Heike Reggentin
Jürgen Dettbarn-Reggentin
Einführung
Freiwilligenarbeit und somit das Freiwillige Engagement gewinnt mit der Diskussion um die zukünftige Gestaltung und Neuorientierung des Sozial- und Gesundheitssystems an Bedeutung. Aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln wird die Gemeinschaft auf ihre Solidarstrukturen hin geprüft und hinterfragt, inwieweit sie in Zukunft den Herausforderungen des demografischen und sozialen Wandels gewachsen sein wird. Dabei erhält die Frage nach der Versorgungssicherheit alter, pflegebedürftiger wie auch behinderter Menschen in diesem System höchste Priorität.
Die Bereitstellung notwendiger Ressourcen zur Sicherung der Pflege und Betreuung wird daher eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Zukunftsaufgaben darstellen.
Es ist zu erwarten, dass die Zahl Pflegebedürftiger in den kommenden Jahren und Jahrzehnten demografisch bedingt erheblich zunehmen wird. Obwohl die Pflegeversicherung weiterhin auf die familiale Unterstützung pflegebedürftiger Menschen setzt, wird schon heute klar, dass diese Aufgabe zukünftig nur schwer in dem derzeitigen Ausmaß allein von Familienangehörigen zu bewältigen sein wird. Verschiedene Einflussfaktoren begrenzen die häuslichen Pflegeressourcen.
Zuvorderst ist die Pflegebereitschaft innerhalb der Familien und Partnerschaften zu nennen. Wie wird sich die Versorgung Pflegebedürftiger, auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Pflege, gestalten? Werden weiterhin genügend häusliche Ressourcen verfügbar sein?
Anforderungen an das Versorgungssystem
Die Pflege- und Betreuungsleistungen für schwer- und schwerstpflegebedürftige Menschen stellen hohe fachliche Anforderungen und erfordern einen erheblichen zeitlichen Pflegeeinsatz. Insbesondere Pflegebedürftige mit einer demenziellen Erkrankung führen die Hauptpflegeperson bald an die Grenzen ihrer Kräfte.
Welche formellen und insbesondere informellen Unterstützungssysteme sind entwickelbar und in der Lage verlässlich Versorgungsaufgaben zu sichern?
Eine weitere Anforderung an das soziale und gesundheitliche Versorgungssystem resultiert aus dem wachsenden Anteil alleinstehender pflegebedürftiger Personen, die in großstädtischen Ballungsgebieten und deren Randlagen bereits zwei von drei Personen in der Altersgruppe der über 80-Jährigen ausmachen. Bei ihnen ist eine Versorgung über grundpflegerische Leistungen hinaus erforderlich. Bisher sind Hilfestrukturen oder -kulturen nicht erkennbar, die den Personenkreis Alleinstehender mit Hilfebedarf ausreichend absichern.
Nicht nur der häusliche Pflegebereich, sondern auch die institutionelle Pflege ist auf die Solidarität externer Helfer angewiesen. Die Mitwirkung von Angehörigen, Laienhelfern und Ehrenamtlichen wird zunehmend gesucht werden müssen, zumal die bisherige Ausrichtung der Pflege auf verrichtungsbezogene Tätigkeiten eine Lücke in der psychosozialen und emotionalen Betreuung hinterlässt, die vom professionellen Pflegepersonal nur schwer geschlossen werden kann.
Schon heute werden im Zuge des konzeptionellen Wandels mit der Einführung kleiner Wohneinheiten, personenzentrierter Versorgungsstrukturen und der Betonung des „Wohncharakters“ externe Betreuungskräfte auf ehrenamtlicher Basis eingebunden. Die Mithilfe freiwillig Engagierter soll eine neue Verantwortungskultur eröffnen. Hierin ist auch eine höhere Bewertung der Laienhilfe zu erkennen. Damit ist nicht ein Rückzug aus der professionellen Pflegearbeit gemeint, sondern die notwendige Ergänzung verrichtungsbezogener Pflegeleistungen, da zwar psychosoziale Betreuung propagiert wird, aber in den Leistungskatalogen ambulanter Vergütungskriterien bisher nicht enthalten ist. Nicht zuletzt wird mit dem Einsatz unbezahlter Kräfte in der Betreuung ein wirtschaftlicher Nutzen erzielt, ohne den häufig keine ausreichende kostendeckende Versorgung möglich wäre.
Mit dem demografischen Wandel kommen somit Gestaltungsaufgaben auf das Gemeinwesen zu, die als Ziel die Stärkung der privaten Hilfenetzwerke, insbesondere durch eine kommunale Alterssozialpolitik, haben. Gestaltungsaufgaben erwachsen jedoch nicht allein aus den individuellen Anforderungen in bestimmten Lebenslagen, zusätzlich sind Anpassungsprozesse auf nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen zu vollziehen. Die Ausdifferenzierung der Lebensphasen bezieht auch die Lebensphase des höheren Erwachsenenalters und somit thematisch immer neue Bevölkerungsgruppen ein. Damit werden nicht Ressourcenmängel, sondern auch Ressourcenüberschüsse in der Zielgruppe Alter thematisiert.
Der demografische Wandel fördert gewissermaßen zwei Seiten ein und derselben Medaille. Er fordert nicht nur neue Formen der Fürsorge, sondern bringt zugleich die Kräfte hervor, die diesen Wandel mit gestalten sollen. Letztere bilden den Kern aktiven gestalterischen Mitwirkens in Form Freiwilligen Engagements, um den es in diesem Band vorrangig gehen soll.
Freiwilligenarbeit/Freiwilliges Engagement
Das Freiwillige Engagement wird als gesellschaftliche Ressource angesehen, um die Betreuung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen zu stärken. Freiwilliges Engagement in Form von Ehrenamt und Selbsthilfe kann helfen, Ausgrenzungen und soziale Isolation pflegebedürftiger Menschen zu vermeiden. Es ist in ein Konzept sozialer Interaktion und Kommunikation eingebunden. Mit dem sich aufbauenden Kommunikationssystem wird die Welt des Bekannten und Vertrauten erhalten und Wissen verbreitet, das wiederum handlungsleitend sein kann. Der Einsatz von Laienhelfern kann somit auch als Lernmodell angesehen werden, in dem die eine oder auch beide Seiten im Kommunikationsprozess durch „Empowerment-Erfahrung“ gestärkt werden kann.
Unter dem Aspekt des Netzwerk-Ansatzes wird mit der Verfügbarkeit ehrenamtlicher Helfer das persönliche Netzwerk des Pflegebedürftigen wie auch das des Helfers erweitert. Gerade bei hochaltrigen wie auch bei behinderten Menschen im Alter können die sich verringernden sozialen Beziehungen kompensiert werden.
Eine weitere Frage stellt sich bezüglich der zukünftig benötigten Helfer: Werden genügend Personen verfügbar und auch motiviert sein, Pflege und Betreuung zu übernehmen, auch für Personen außerhalb ihres persönlichen Netzwerkes? Zukünftig muss von einem erheblichen Fachkräftemangel ausgegangen werden.
Die Darstellung in diesem Band geht von einem Modell des Freiwilligen Engagements als Interaktionssystem aus, das zur Sicherung der Kommunikation und des Alltagslebens bei eingeschränkter Selbstständigkeit (Pflegebedürftigkeit) beiträgt. Die Einschätzung des Bedarfs, der Bereitschaft und der Förderung sozialen Freiwilligen Engagements wird im Hinblick auf seine Einordnung in ein Gesamtsystem helfen, Qualität, Grenzen und Risiken der Freiwilligenarbeit in Form von Laienhilfe im Pflegebereich zu erkennen.
In einen erweiterten Bezugsrahmen der Betrachtung des Freiwilligen Engagements als Bestandteil des sozialen Sicherungssystems sollen folgende Aspekte einbezogen werden:
Das Freiwillige Engagement im Pflegebereich kann das soziale Netzwerk der Hilfebedürftigen wie auch das eigene soziale Netz der Helfer erweitern.
Freiwilliges Engagement stellt ein Lernfeld dar. Es ist handlungsbezogen und insofern lebensweltorientiert. In der Interaktion wird erfahren, dass sich Hilfesuchende und Helfer als Teil eines gemeinsamen Prozesses anerkennen, in dem die Rollen als Helfender und als Hilfesuchender weitgehend aufgehoben werden.
Freiwilliges Engagement stärkt die Verantwortungskultur innerhalb der Gesellschaft. Es gründet auf Solidarität.
Freiwilliges Engagement vermittelt Kompetenz durch Interaktion.
Mit Freiwilligem Engagement wird das System der Subsidiarität gestärkt. Es stützt den Vorrang der selbstbestimmten Lebensgestaltung vor überformenden Eingriffen durch Institutionen.
Das Freiwillige Engagement erweitert den durch das SGB XI auf verrichtungsbezogene Tätigkeiten eingegrenzten Pflegebegriff auf kommunikative, emotionale und sozialpsychische Handlungsebenen. Es leistet einen Vorgriff auf den zu erwartenden veränderten Pflegebegriff.
Freiwilliges Engagement im stationären wie auch im ambulanten Versorgungsbereich schafft neue Formen gemeinschaftlichen Miteinanders. Diese Formen brauchen jeweils eine eigene Struktur und eine gemeinsame Kultur.
Vornehmlich sind Menschen im höheren Alter von Pflegebedürftigkeit betroffen, denn Hochaltrigkeit gilt als gesundheitliches Risiko. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen stellt etwa die Hälfte aller pflegebedürftigen Personen. Freiwilligenarbeit in der Pflege spricht jedoch nicht nur die Hilfebedürftigen selbst, sondern auch deren Angehörige an, soweit sie als Hauptpflegepersonen einbezogen sind. In nicht wenigen Fällen bilden sie eine eigene Gruppe mit Hilfebedarf.
Eine weitere Personengruppe mit Unterstützungsbedarf sind Menschen mit einer spezifischen Behinderung, psychisch Kranke und Demenzkranke, deren Zahl zukünftig erheblich steigen wird.
Alleinstehende Menschen im Alter, Pflegebedürftige wie auch behinderte Menschen laufen Gefahr, ausgegrenzt zu werden. Dies gilt es zu vermeiden und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Würde zu bewahren.
Von der Sicherung der Leistungen pflegender Angehöriger sowie ergänzend hierzu der Gewinnung von externen freiwillig ehrenamtlichen wie auch professionellen Hilfen wird es abhängen, ob zukünftig eine ausreichende wie auch qualitätsvolle Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen gegeben werden kann.
In Kapitel 1 werden zunächst einige Grundprobleme in der aktuellen wie auch der zukünftigen pflege- und betreuerischen Versorgung dargestellt. Die Pflegepotenziale, die zukünftigen Veränderungen in der Familie und deren mögliche Auswirkungen auf die Pflege und die Hauptpflegepersonen sind Gegenstand des Kapitels 2.
In Kapitel 3 wird gefragt, welche Unterstützung pflegende Personen bekommen und wie freiwillige Helfer gewonnen werden. Sind freiwillig Engagierte bereit, prekäre soziale Netzwerke pflegebedürftiger Menschen zu stärken und zu erweitern?
Freiwillig Engagierte, ihre Motivation, Tätigkeit und Qualifikation, stehen im Mittelpunkt von Kapitel 4. Als Bestandteil von Pflegemix-Strukturen wird das Freiwillige Engagement gegenüber professionellen Dienstleistungen abgegrenzt.
Selbstgesteuertes Lernen stellt eines der zentralen Merkmale Freiwilligen Engagements dar. In Kapitel 5 wird vor dem Hintergrund eines handlungsbezogenen Lernmodells der Ansatz der Bildung von Empowerment verfolgt.
Kapitel 6 beschreibt die Entstehung von Netzwerkstrukturen zwischen freiwillig Engagierten im häuslichen oder auch im stationären Umfeld und den von ihnen betreuten Menschen. Diesem Ansatz wird auf übergeordneter Ebene, dem Gemeinwesen, in Kapitel 7 nachgegangen; in Kapitel 8 werden in verschiedenen Zusammenhängen und Beispielen fördernde Strukturen aufgezeigt. Schließlich werden in Kapitel 9 und Kapitel 10 zusammenfassend Perspektiven des Freiwilligen Engagements diskutiert und schließlich resümiert, inwieweit unser Pflege- und Gesundheitssystem ohne Freiwilligenarbeit heute noch denkbar ist.
Die Darstellungen basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Freiwilligensurveys 1999–2009, dem Soziökonomischen Panel sowie weiterer kleinerer Studien. Sie wurde angeregt durch die Expertise „Freiwilliges Engagement in der Pflege und Solidarpotenziale innerhalb der Familie“, die von Dettbarn-Reggentin & Reggentin für die Enquetekommission Pflege des Landtages in Nordrhein-Westfalen erstellt und auf die sich in Teilen gestützt werden konnte.
1 Grundfragen in der Versorgung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
Das Leben mit einer gesundheitlichen, körperlichen oder geistigen Einschränkung erfordert nicht nur in alltäglichen Verrichtungen, sondern häufig auch begleitend psychischen und emotionalen Beistand, wenn auch individuell in unterschiedlichem Ausmaß.
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit verbreitet sich unter dem Einfluss demografischer Entwicklungen, die aufgrund gravierender Umwälzungen in der Bevölkerungsstruktur auch als demografischer Wandel bezeichnet werden. Der Umfang und die Anforderung an die Qualität der Unterstützung unterliegen stetigen Veränderungen. Die Versorgungsarrangements werden hierdurch in ihrer Struktur beeinflusst.
Um die Auswirkungen des Wandels im Hinblick auf die Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zu ermessen, werden gemeinhin Vorhandensein und erwartbare Entwicklungen von Pflegebedürftigkeit anhand von Bevölkerungszahlen ermittelt und auf dieser Basis Prognosen erstellt. Den Anhaltspunkt für zukünftige Prävalenzen bilden altersspezifische Pflegebedürftigkeitsquoten sowie die altersbezogene Verbreitung von Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Solche Prävalenzraten sind weitgehend bekannt und zur Orientierung in Bezug auf den zukünftigen Bedarf an Versorgungsleistungen geeignet.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!