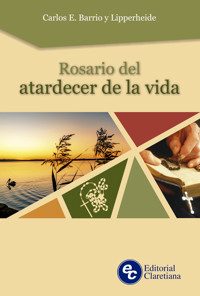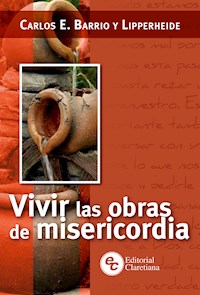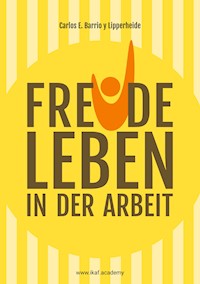
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
"Freude leben in der Arbeit" In einer Zeit, wo so vieles still steht- wo die Welt gleichsam den Atem anhält im Griff der Corona-Krise, bekommt die Freude an der Arbeit eine ganz neue Bedeutung. In dieser Zeit wächst das Bewusstsein und der Wunsch, dass es nach dem fast weltweiten Lockdown nicht mehr so weiter gehen kann wie zuvor. In einer Zeit, in der das Reisen nahezu unmöglich geworden ist, nimmt uns das Buch mit auf eine Reise des vertieften Betrachtens und hin zu einem kraftvollen Neu-Aufbruch. Mit Hilfe der Pädagogik von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der internationalen Schönstattbewegung, führt uns das Buch zu einem vertieften Erkennen innerer Zusammenhänge. Eine Einladung zur vertiefen Reflexion, um das persönliche Führungsverhalten zu überdenken und um so der wahren Freude an der Arbeit auf die Spur zu kommen - neue, innere Kraft entdecken und mobilisieren. Möge dieses Buch zu einem neuen Frühling der wahren Freude in der Arbeit führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Danksagung
Von Herzen danken wir Carlos E. Barrio y Lipperheide für das große Geschenk, das er uns mit diesem Buch macht! Danken möchten wir besonders auch Maria Fischer für ihre großartige, kraftvolle, getreue und wochenlange Übersetzungsarbeit in die deutsche Sprache. Franziska Thurm danken wir herzlich für ihre kreative Layout-Arbeit und ihrem unermüdlichen, geduldigen „Dranbleiben“ bis zur Fertigstellung dieses Buches. Ein herzliches Danke sagen wir auch Sarah Becker für ihr gewissenhaftes Korrekturlesen des Buchtextes. An dieser Stelle möchten wir ebenfalls Felix Miller Dank sagen für seine Vorbereitungsarbeit der E-book-Version.
Freude ist die Quelle der Kraft
Pater Josef Kentenich
… ein Buch für alle Menschen, die Verantwortung tragen, für Unternehmer, für Führungskräfte, für Menschen, die die Welt gestalten in Wirtschaft, Ehrenamt und Apostolat…
Inhalt
Freue Dich
DIE KRANKHEIT UNSERER ZEIT: DER MECHANISTISCHE MENSCH
ORGANISCHE ARBEIT ALS WEG ZUR FREUDE
1) Affektbetonte Teilnahme
2) An der schöpferischen Tätigkeit
3) Sich verschenkende Tätigkeit
4) Die Arbeit soll naturgemäß mit dem Werk verbunden sein
5) Sie sollte den schöpferischen Gestaltungswillen wecken und befriedigen
Der Freude entgegen
SELBSTERKENNTNIS UND ORIGINALITÄT
FRUCHTBARE KREATIVITÄT
DIE DREI ORGANISCHEN KRÄFTE, DIE ZUR FRUCHTBAREN KREATIVITÄT FÜHREN
GANZHEITLICHE KOMMUNIKATION
DIE KUNST DES HÖRENS
DIE KUNST DES SPRECHENS
DIE KUNST DES BEFREIENS
DIE KUNST DES WECKENS
BINDUNGSORGANISMUS
1) BINDUNG AN PERSONEN
2) BINDUNG AN ORTE UND DINGE
3) BINDUNG AN WERTE (IDEEN)
4) BINDUNG AN GEMEINSCHAFT
5) BINDUNG AN GOTT
Arbeitslied
Vorwort
„Freude leben in der Arbeit“
In einer Zeit, wo so vieles still steht – wo die Welt gleichsam den Atem anhält im Griff der Corona-Krise, bekommt die Freude an der Arbeit eine ganz neue Bedeutung. In dieser Zeit wächst das Bewusstsein und der Wunsch, dass es nach dem fast weltweiten Lockdown nicht mehr so weiter gehen kann wie zuvor.
In diese Zeit kommt die deutsche Übersetzung des Buches von Carlos E. Barrio y Lipperheide „Freude leben in der Arbeit“ wie ein Geschenk, wie eine Einladung.
In eine Zeit, in der das Reisen nahezu unmöglich geworden ist, nimmt es uns mit auf eine Reise des vertieften Betrachtens und hin zu einem kraftvollen Neu-Aufbruch.
Mit Hilfe der Pädagogik von Pater Josef Kentenich, dem Gründer der internationalen Schönstattbewegung, führt Carlos uns zu einem vertieften Erkennen innerer Zusammenhänge. Er lädt in einzelnen Reflexionen dazu ein, die eigene Arbeit und das persönliche Führungsverhalten neu zu überdenken, um so der wahren Freude an der Arbeit auf die Spur zu kommen – neue, innere Kraft zu entdecken und zu mobilisieren.
Möge dieses Buch zu einem neuen Frühling
der wahren Freude in der Arbeit führen.
Melanie & Ulli Grauert
mphcev | Ostern 2020
Freue Dich
„Freude heißt, in jedem Augenblick in Gott beheimatet zu sein.
Der Vater liebt mich.“1
„Freue dich“ ist das erste Wort, das Gott im Neuen Testament an den Menschen richtet.2 Er sagt, dass es etwas zum Freuen gibt, eine Frohe Botschaft zum Leben. Er verspricht uns, dass diese Frohe Botschaft unser ganzes Sein mit Freude erfüllen und unserem Leben Sinn geben wird. Keine Frage, Gott kennt uns und weiß, wie sehr wir uns von ihm beheimatet und geliebt fühlen müssen, um Sinn für unser Leben zu entdecken.
Doch warum müssen wir uns „froh“ fühlen? Was ist das Neue an dieser Botschaft? Warum ist es eine frohe Botschaft? Was ist der letzte Grund, um „froh“ zu sein?
Gott sagt uns durch den Engel, dass nicht Egoismus, Zerstörung, das Böse, das Nichts und der Tod das Letzte sind, sondern das Leben, die Liebe, die Auferstehung des Menschen und aller Dinge. Er sagt uns, dass alles gut ausgehen wird, dass am Ende des Weges Licht ist.
Das alles kann und darf uns mit Freude erfüllen. Damit dies aber geschieht, müssen wir diese Wahrheit wirklich leben. Es reicht nicht, sie zu verkünden und rein „intellektuell“ zu kennen. Wir müssen die „Freude“ in der Tiefe des Herzens leben und erfahren. Entdecken, dass das Letzte nicht der „Big Bang“ des Universums ist, das immer weiter und immer kälter wird, weil er die Galaxien voneinander ins Nichts hinein entfernt, wie viele Wissenschaftler annehmen,3 sondern dass ein neuer „Big Bang“ geschehen ist, der Mensch und Universum radikal transformiert hat. Und dieser neue „Big Bang“ ist die Inkarnation des Wortes und seine Auferstehung, die den Tod, die Zerstörung und die Abkühlung, in die uns der erste „Big Bang“ führt, überwunden hat. Sein Weg ist der der Liebe, die den Tod besiegt, der alles wiederherstellt und alles wandelt, der uns Mut und Hoffnung gibt und uns verbindet.
Wir müssen diesen neuen „Big Bang“ leben und allen Menschen auf neue und kreative Weise verkünden, und dies vor allem in der Welt der Arbeit, die sich in vielerlei Hinsicht und an vielen Orten kalt und leer zeigt.
Es scheint allerdings, als hätten wir in großem Maß Richtung und Sinn der Freude in unserem Leben und in der Arbeit verloren. Wir leben und erleben unsere Arbeit als eine Tätigkeit ohne Sinn. Oft deprimiert sie uns regelrecht und bringt uns in eine existentielle Leere. Nur die dunkle Seite der Arbeit ist übriggeblieben, entleert von der schöpferischen Lust, und so hat der Mensch ihren Sinn verloren.
Josef Pieper bestätigt diese Situation des faktischen Ausschlusses der Freude in der Arbeit, wenn er sagt, dass „‘sinnvolle Arbeit‘ mehr als das bloße Faktum des werktäglichen Leistens und Tuns“ sei. Damit verweist er darauf, dass „der Mensch die Arbeit verstehe und ‚annehme‘ als das, was sie wirklich ist – als die ‚Bestellung des Ackers‘ nämlich, die immer beides in sich schließt: Glück und Mühsal, Befriedigung und Schweiß des Angesichts, Freude und Aufzehrung der Lebenskraft. Wird eines davon unterschlagen und also die Realität der Arbeit gefälscht, dann ist zugleich das Fest unmöglich geworden.“4
Freude und Schmerz kommen zusammen. Wir können keinen der beiden Aspekte unterschlagen. Mehr noch, ich wage zu behaupten, wenn wir Arbeit mit Sinn erfüllen, dann können wir auch den damit verbundenen Schmerz mit Freude leben. Mit einer tiefen Freude, nicht mit einer oberflächlichen und leichten.
Ich glaube, die große Aufgabe heute ist es, die Freude in und an der Arbeit zurückzuerobern.Anselm Grün macht darauf aufmerksam, dass wir Freude nicht machen können. Was wir tun können, ist intensiv und kreativ leben. Dann kommt Freude spontan, als Ausdruck von Vitalität und Kreativität,5 als Ausdruck in der Arbeit gefundenen Sinns als Teils des neuen „Big Bang“. In der gleichen Linie sagt Kentenich: „Wo die Freude in tiefgreifender Weise gepflegt und anerzogen wird, da dürfen wir erwarten, die Gewähr für Qualitätsarbeiten und -leistungen zu haben. ... Ist es nicht so: Wo die Freude am Ruder ist, ist auch mit dem Arbeitswillen der Gedanke verbunden: Leisten wir Qualitätsarbeit!“6
Daher muss die Idee, Reichtum zu produzieren, verknüpft sein mit den materiellen und geistigen Faktoren, die im Unternehmen zu entwickeln sind. Wenn wir bei der Produktion von Reichtum den Blick ausschließlich auf das Materielle reduzieren, das heißt, auf die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, verarmen wir das Konzept und verfälschen seine wahre und vollständige Dimension.
Josef Pieper sagt: „Der Grund der Freude aber ist, obwohl er in tausend konkreten Gestalten begegnen kann, immer der gleiche: dass einer besitzt oder empfängt, was er liebt.“7 Darum wächst Freude in und an der Arbeit, wie Josef Kentenich sagt, wenn der Mensch aus ganzem Herzen an einer schöpferischen Tätigkeit teilhaben kann, indem er seinen Hingabewillen beiträgt und spürt, dass seine Arbeit verbunden ist mit dem Werk, das er gestaltet, was seinen schöpferischen Gestaltungswillen weckt.
Damit dies geschieht, besteht eine doppelte Verantwortlichkeit. Einerseits seitens dessen, der arbeitet, und andererseits seitens des Unternehmens, das erlauben und begünstigen muss, dass diese Bedingungen umgesetzt werden können.
Es nützt nichts, wenn ein Einzelner seine ganze Begeisterung beiträgt, um schöpferisch und gestaltend zu wirken, wenn das Unternehmen ihm nicht ermöglicht, seine Kapazitäten und seine Originalität zu entfalten, wie sich auch keine sinnerfüllte Arbeit entfalten kann, wenn der Einzelne nicht gewillt ist, all seine schöpferischen Fähigkeiten und Kräfte einzubringen. Wir müssen neu entdecken, was das ist, wodurch wir uns bei der Arbeit lebendig und angezogen fühlen; was das ist, was uns Begeisterung und Vitalität spüren lässt. Von dort aus wächst die Freude.
Wir sind Zeugen der alarmierenden schädlichen Wirkungen, die gewisse Formen der Arbeit auf Menschen haben können, die zur Erschöpfung führen, Hoffnung und Lebensfreude nehmen und die Person ausschließlich als austauschbares Objekt oder Ware betrachten. Diese Sichtweise hat zur „Verdinglichung“ des Menschen geführt. Ich erinnere konkret an die Selbstmorde bei Telecom France im Jahr 2009.
Die Entlassungen, die plötzlichen Versetzungen von Menschen von ihren bisherigen Arbeitsplätzen an andere Standorte, erzwungene Umzüge und eine radikale Veränderung des Managements führten zu der dramatischen Konsequenz, dass 23 Mitarbeiter in einem Unternehmen, in dem damals 65.000 Menschen arbeiteten, sich das Leben nahmen.
Die Gewerkschaften und die Mitarbeiterschaft von Telecom France verknüpften diese Selbstmorde mit einem Modernisierungsprogramm des Unternehmens, das 10.000 Angestellte zwang, alle drei Jahre ihre Arbeit zu ändern, wobei hochqualifizierte Techniker auf Büroposten und in Call Center versetzt wurden.
Viele Angestellte empfanden, dass ihnen kaum erreichbare Ziele gesteckt wurden und die Arbeitsbedingungen so stressig geworden waren, dass sie zu Antidepressiva greifen mussten.
Die spanische Zeitung „El País“ schrieb dazu: „Ein internes Unternehmensprogramm, im Englischen „Time to move“ (Zeit für Bewegung) genannt, verpflichtet Führungskräfte im mittleren Management, alle drei Jahre ihren Posten zu wechseln. Inspiriert ist es vom Militär, wo verhindert werden soll, dass Chefs ihre Mitarbeiter mögen und sich darum gegen Personalabbau oder deren Versetzungen an andere Standorte wehren.“ 8
Ein Unternehmen am Modell der Streitkräfte auszurichten, hat Konsequenzen und verweist auf eine bestimmte Sicht des Menschen im Unternehmen und eine dahinterstehende Weltanschauung. Abraham H. Maslow sagt in Blick auf diese Art Unternehmen: „Wie sollte ein menschliches Wesen sich nicht beleidigt fühlen, wenn es wie ein austauschbares Stück behandelt wird, wie ein einfaches Rädchen einer Maschine, wie ein Zubehörteil am Fließband (und mit weniger Wert als eine gute Maschine)?“ 9
Die Grundursache all dessen ist das, was Josef Kentenichmechanistischer Mensch nennt. „Man hat die Arbeit ihres naturgemäßen Sinnes entkleidet, hat sie herausgelöst aus dem inneren Zusammenhang mit ihrer Wurzel, dem Leben, mit dem Werk und den Konsumenten. Man hat sie auf diese Weise entpersönlicht und zum Werkzeug allseitiger Entpersönlichung gemacht.“10
Enrique Shaw sagt: „Der Hauptgrund dafür, dass so viele Menschen unproduktiv sind, liegt in der brutalen Tatsache, dass sie Arbeit hassen. Die Arbeit, vor allem in der Industrie, ist oft eine mühsame Arbeit, eintönig und daher schwer in ihrem Sinn und ihrer Bedeutung zu sehen.“ 11
Ein Mensch, der sich so verstanden sieht, kann keine Freude in und an seiner Arbeit empfinden, sondern erlebt sich trübsinnig und seiner Würde beraubt.
1 Josef Kentenich. „Las Fuentes de la Alegría“. Editorial Patris (2006), Seite 165; (Deutsch: Josef Kentenich. „Vollkommene Lebensfreude“. Vallendar 1984).
2 „Sei gegrüßt, Gnadenvolle“, Lukas 1,26, auch zu übersetzen: „Freue dich, Gnadenvolle“.
3 Vortrag Edgar Morin. „El Método“. Editorial Cátedra (2009), Seiten 51 ff.
4 Josef Pieper. „Una teoría de la fiesta“. Editorial Rialp. (1974), Seite 13. Deutscher Originaltext: Josef Pieper. „Zustimmung zur Welt: Eine Theorie des Festes“. Kösel, München 1964/Topos-TB 2012, Seite 12.
5 Anselm Grün. „Recuperar la propia alegría“. Editorial Verbo Divino (1999), Seite 13; (Deutsch: „Die eigene Freude wiederfinden“, Herder-Verlag).
6 Josef Kentenich. „Las Fuentes de la Alegría“. Editorial Patris (2006), Seite 110; (Deutsch: Josef Kentenich. „Vollkommene Lebensfreude“. Vallendar 1984).
7 Josef Pieper. „Una teoría de la fiesta“. Editorial Rialp. (1974), Seite 32; (Deutsch: „Zustimmung zur Welt. Eine Theorie des Festes“. Topos-TB, Seite 27).
8 Zeitung El País, Spanien, 15. September 2009.
9 Abraham H. Maslow. „El Management según Maslow“. Editorial Paidós Empresas (2005), Seite 92.
10 Josef Kentenich. „El Pensamiento Social del P. José Kentenich“. Verlag Nueva Patris (2010), Seite 103; (Deutsch: Oktoberbrief 1949, Seite 74).
11 Enrique Shaw. „... y dominad la tierra“. ACDE-Verlag (2010), Seite 27. Enrique Ernesto Shaw wurde am 26. Februar 1921 in Paris geboren und starb am 27. August 1962 in Buenos Aires. Er war ein argentinischer Laie, Marineoffizier und Unternehmer, verheiratet mit Cecilia Bunge, mit der er neun Kinder hatte. Wegen seines vorbildlichen Lebens eröffnete die Kirche seinen Seligsprechungsprozess, seit 2001 gilt er als Diener Gottes. Er förderte, motiviert von der Christlichen Gesellschaftslehre, die menschliche Entfaltung seiner Arbeiter, gründete die Vereinigung christlicher Unternehmer (ACDE), die Teil der Internationalen Vereinigung christlicher Unternehmer (UNIAPAC) ist, schrieb zahlreiche Bücher und war ein gesuchter Redner.
DIE KRANKHEIT UNSERER ZEIT: DER MECHANISTISCHE MENSCH
Dieser mechanistische Mensch hat den Sinn der Arbeit verloren und darum die Freude, die diese von ihrem Wesen her mit sich bringt. Freude, so sagt Kentenich, müsse als Frucht genossen werden. 12 Diese Frucht ist Folge einer schöpferischen, sinnerfüllten Arbeit.
Das Mechanistische schafft einen „Filmmenschen“, einen Menschen, der das Leben als eine Folge von aufeinanderfolgenden Einzeleindrücken erlebt, die sich gegenseitig löschen, ohne dass er sich an irgendeinem davon festmacht und so die Idee vom Leben und den Lebensvorgängen trennt. Die Arbeit ist von ihrem Werk und ihrem lebensmäßigen Gleichgewicht gelöst.
Der Verlust des organischen Sinnes der Arbeit hat dazu geführt, dass der Mensch sich fremd und fern von dem erlebt, was er produziert, was zu einer Grundhaltung von Trauer und Verlust des Sinnes dessen, was er tut und schafft, führt.
Kentenich deutet bereits 1949 auf Rationalisierungsverfahren hin, welche „die Produktion steigern, den Menschen aber wachsend entpersönlichen. Er arbeitet am laufenden Band, setzt in endloser Wiederholung immer wieder denselben mechanischen Griff, bekommt deswegen nie ein Verhältnis zum Werk seiner Hände. Die in ihm schlummernden schöpferischen Kräfte werden nicht ausgelöst, die Arbeit macht keine Freude, sie wird nie zum wahren, echten Beruf.“ 13
Enrique Shaw macht darauf aufmerksam, dass „ein rein wirtschaftlicher Fortschritt, der als Ziel an sich betrachtet wird, früher oder später die Konsequenzen seiner Unverhältnismäßigkeit dem Menschen gegenüber zu spüren bekommt und auf fatale Weise zu Unordnung und Tyrannei führt.“14
Die Folge dieses übertriebenen wirtschaftlichen Fortschritts hat uns in den Sinnverlust der Arbeit geführt und die resultierende Schwierigkeit der Verwurzelung in Werten. Wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato Si“ sagt, ist eine „Rapidación“ (Beschleunigung) des Lebens und der Arbeit erfolgt. „Die ständige Beschleunigung in den Veränderungen der Menschheit und des Planeten verbindet sich heute mit einer Intensivierung der Lebens- und Arbeitsrhythmen zu einem Phänomen, das einige als „Rapidación“ bezeichnen“, so erklärt er. 15
Wir leben in dem, was Zygmunt Baumann als flüchtige Moderne bezeichnet, ein entwurzelter globalisierter Mensch, der Angst davor hat, dauerhafte Verpflichtungen einzugehen.
Das Mechanistische erzeugt die Trennung von Bereichen, die von Natur aus zusammengehören. Papst Franziskus beschreibt es so: „Die der Technologie eigene Spezialisierung bringt eine große Schwierigkeit mit sich, das Ganze in den Blick zu nehmen. Die Aufsplitterung des Wissens erfüllt ihre Funktion, wenn sie konkrete Anwendungen erzielt, führt aber gewöhnlich dazu, den Sinn für die Gesamtheit, für die zwischen den Dingen bestehenden Beziehungen, für den weiten Horizont zu verlieren, der irrelevant wird.“ 16
Das mechanistische Denken manifestiert sich hauptsächlich in der Loslösung zweier Bereiche:
im
Objekt
des Denkens, dem „Sehen“, dem kognitiven Blick, indem es die kausalen Beziehungen, die Bindungen, die organischen Beziehungen, die Idee vom Leben trennt. „Das Leben wird atomisiert, was den Weg freimacht zu einem vielfältigen unpersönlichen Stil und als natürlicher Folge einer Entpersönlichung. Diese Haltung atomisiert letzten Endes auch die Ideen. Sie vermag die verschiedenen Ideen nicht im Zusammenhang zu sehen, zu sagen und zu verwirklichen.“
17
Und im denkenden
Subjekt
, dem „Leben“, dem lebensmäßigen Blick, indem es „in unangemessener Weise Kopf und Herz und einfach die seelischen Kräfte voneinander trennt. Es sieht sie nicht in einer Spannungseinheit und entdeckt noch weniger in ihnen eine Ordnungseinheit. Darum ist ihm eine gesunde Harmonie zwischen der Art des Denkens und der Art des Lebens ... vollkommen fremd.“
18
Ich erinnere mich an den Systemadministrator einer bedeutenden Supermarktkette Argentiniens, der mir erzählte, dass er mit Schrecken an die Zahl der täglich nicht gelesenen Mails denke. Er kam auf einen mittleren Wert von 1300 ungelesenen Mails. Dass er seine Arbeitstätigkeit nicht in der erwarteten Art und Weise erfüllen konnte, hinderte ihn, seine Arbeit mit Freude zu leben, er fühlte sich blockiert, diese Situation zu verändern und seine Tätigkeit mit größerer Freiheit zu leben.
Das mechanistische Leben hat zerstörerische Auswirkungen auf den Menschen mit folgenden Konsequenzen:
es atomisiert die Lebensvorgänge,
zertrennt die Ideen,
trennt Erst- und Zweitursache, das heißt, die Vorgänge, die natürlicherweise verbunden sind.
Das mechanistische Arbeiten führt dazu, das Kapital von der Arbeit zu trennen und den Arbeiter von seinem Werk, und es trennt auch die Person in ihrem Innern, nämlich den Intellekt vom Herzen, ohne eine schöpferische Spannungseinheit zu kennen. So sagt Kentenich: „Die Gefühle sind nicht tief, sind nicht dauernd; sie sind nicht warm, sie wechseln sehr schnell. Einerseits können Verstand und Wille die Regungen des Gefühls nicht mehr gesund klären und regulieren, und andererseits kann das Gefühl nicht genügend den Verstand und Willen gefangen nehmen. Das Gemüt kann nicht empor.“19
In der gleichen Denkrichtung unterstreicht Sergio Sinay, dass „die spirituelle Entleerung der Arbeit, die Überzeugung, dass diese nur ein einziges Ziel habe (Geld verdienen, Rendite und wirtschaftliche Gewinne produzieren) und dass jegliche andere Vorstellung sich diesem unterzuordnen habe, ist in der Gesellschaft, in der wir leben, weit verbreitet.“ 20 Diese Haltung erinnert mich an die überraschende Erfahrung eines argentinischen Unternehmers, Federico Boglione, bei einer Geschäftsreise nach China. Er entdeckte, dass der „Chinese keine Geschäfte mit dir macht, solange er sich nicht als dein Freund fühlt. Zuerst kommt die freundschaftliche Beziehung, sonst gehen die geschäftlichen Beziehungen nicht voran.“21
Kentenich erkannte, dass die mechanistische Marktmentalität die Art und Weise beeinflusst, wie der Mensch sich selbst und den Nächsten sieht. Der moderne Mensch, so sagt er, habe den Sinn für jede Beziehung, die zur Selbsthingabe führe, verloren. Er suche nur, was er besitzen und beherrschen könne; darum verdingliche er die Mitmenschen, indem er rein nutzenbestimmte Beziehungen eingehe. Im besten Falle könne er „bei“ ihnen leben, miteinander „Dinge tun“; aber er sei unfähig, eine Herzensgemeinschaft 22 zu begründen, in der jeder wirklich in-, für- und miteinander leben könne. Schließlich verdingliche er sein eigenes Sein bei dem Versuch, die eigene Wirklichkeit durch die Art des Wissens zu begreifen, die er erfunden habe, um die Dinge zu kennen und zu beherrschen.23
Auf diese Art und Weise manifestiert sich das Mechanistische als Entwurzelung. „Der kollektivistische Mensch ist der radikalisierte Massenmensch, der von innen her alle gottgewollten Bindungen verneint.“ 24
Eine konkrete Veranschaulichung des Mechanistischen, des Ungleichgewichts, in das der Mensch in seinen Beziehungen geraten ist, bringt Zygmunt Bauman auf den Punkt, wenn er sagt: „Eine Untersuchung des World Institute for Development Economics Research der Vereinten Nationen hat kürzlich Folgendes ergeben: Im Jahr 2000 besaßen die reichsten Menschen der Welt – das sind gerade ein Prozent der Weltbevölkerung – 40 Prozent der globalen Vermögenswerte; weiterhin entfallen mehr als 85 Prozent des Gesamtvermögens auf die reichsten zehn Prozent. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt, dass drei Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze leben, die mit einem Einkommen von zwei Dollar pro Tag definiert wird.“25
Was ist passiert? Wie konnte der Mensch zu einem solchen wirtschaftlichen und menschlichen Ungleichgewicht kommen? Ist es überhaupt möglich, Freude zu entwickeln in einem Ambiente himmelschreiender Ungerechtigkeit? Es scheint schwierig, um nicht zu sagen unmöglich.
Mit Bezug auf den Geist unserer Zeit sagt Kentenich: „Der wirtschaftliche Gesichtspunkt ist überall der ausschlaggebende, der tragende und beherrschende. Der Wirtschaft gilt die meiste geistige Energie begabter Menschen. Sie bestimmt die Politik, sie füllt die Presse, sie entscheidet über Krieg und Frieden, sie ist das Hauptthema internationaler Beratungen. Sie ist der Gradmesser für Wert und Würde einer Persönlichkeit und einer Nation.“26
Heute sehen wir, dass die arbeitenden Menschen Seele, Innenleben und Sinn verloren haben. Die Unternehmen werden mit hoher Effizienz und wirtschaftlich erfolgreich verwaltet, aber ohne dass in ihnen die Kraft fließen würde, die sie mit Energie und Freude an der entwickelten Arbeit erfüllen würde. Der gemeinsame Traum ist verloren gegangen. Es scheint, als sei das Tun von dem inneren Leben entleert, das notwendig ist, um andere so zu inspirieren, dass sie sich für ein gemeinsames Projekt mobilisiert und geeint erleben. Es fehlt eine Motivation, die aus dem Innern kommt, ein Ideal des Projektes, das anregt, über die rein wirtschaftlichen Anreize hinaus zu arbeiten, ein Ideal, das anreichert und begeistert.
Es scheint, dass heutige Unternehmen als Ziel und erstrangigen, ja fast ausschließlichen Wert, wirtschaftlichen Gewinn anstreben, und aus diesem Grund die Effizienz der Geschäftsführung an oberster Stelle steht. Man sucht die Besten, die Fähigsten, diejenigen, die die besten Talente besitzen, um die Ziele zu erreichen und wirtschaftlich zu wachsen.
All das ist zweifellos notwendig und wesentlich, damit das Unternehmen bestehen und Fortschritte machen kann und hat verdient, als Wert herausgehoben zu werden, der ungemein wichtig ist für Erfolg und Bestand des Unternehmens. Doch wenn wir die Arbeit nur auf diese Dimension reduzieren, dann wird sie zu einem bloßen Tun, bei dem nur das wirtschaftliche Ergebnis und die Effizienz der Aufgabe zählt.
Diese übertrieben einseitige, rein ökonomische Sicht ist nach meiner Auffassung eines der größten Probleme im Hinblick auf das Verständnis der Arbeit. Jene, die das Unternehmen führen, leben beim alleinigen Verfolgen des Profits (des Tuns und nicht des Seins) innerlich nicht die Vision des Unternehmens als ein motivierendes, Kreativität weckendes Ideal, und können diejenigen, die darin arbeiten, folglich auch nicht für die Größe des unternehmerischen Projektes begeistern. Sie inspirieren und motivieren nicht, und die Aufgabe, die sie erfüllen – wenngleich hoch effizient – erzeugt keine Magie, kein Leben, keine Freude.
Auf diese Weise hat sich die Arbeit vom Leben losgelöst. Der ökonomische Mensch hat den phantasievollen, kreativen Menschen geblendet, der träumen möchte, der fliegen und sich mit Freude und Größe neue Zukunft und einen weiteren Horizont vorstellen möchte und darum Teil eines Teams sein muss, das für ein unternehmerisches Ideal zusammenarbeitet, in dem ein Klima herrscht, in dem seine tiefsten Wünsche Gestalt annehmen und Gestaltungskraft wecken können.
Wahrscheinlich hat diese eingeschränkte Sicht auf die Arbeit dazu geführt, dass sie zu einem reinen Machen degradiert wurde, das nur noch auf die materielle Produktion von Gütern und Dienstleistungen ausgerichtet ist, wo es keinen Raum gibt für den Ausdruck des Inneren der Person.
Die notwendige Konsequenz aus diesem Tätigkeitsmodell ohne Seele ist eine tiefgreifende Schwächung der Bindungen derer, die an der gemeinsamen Arbeit wirken. Wo kein gemeinsamer Geist ist, wo kein Ideal der Arbeit existiert, keine Mission, kein motivierender Sinn, was verbindet dann die Menschen, die arbeiten? Was ist die treibende Kraft? Reicht allein der wirtschaftliche Anreiz?
Dazu erklärt Enrique Shaw: „Es ist recht verbreitet, dass ein Unternehmen ausschließlich von den Besitzern der Produktionsmittel konstituiert wird, denen daher auch exklusiv alle Geschäftsführungs- und Verfügungsrechte zustehen, und die mit den bezahlten Arbeitern und Angestellten ein Arbeitsverhältnis eingehen mit dem alleinigen Zweck, mit ihrer Arbeit die bestmögliche Ausnutzung eben jener Produktionsmittel zu erlangen. (...) In einem solchen Konzept verwundert es nicht, dass die Arbeit als reine Ware betrachtet wird, als „Kostenfaktor“, ohne auch nur einen Moment dabei zu verweilen, die Geistesgabe zu betrachten, die jedes menschliche Tun bereichert; man sieht die Arbeit als etwas rein Materielles, Unbewusstes, auf Maschinen-Niveau reduziert. (...) Frucht dieser falschen Auffassung ist es, dass ein solches Unternehmen dazu tendiert, den Arbeiter als bloßes Rädchen im Getriebe zu betrachten, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, selbst den Pulsschlag des Unternehmens, für das er sich engagiert, zu kennen, zu verstehen und zu fühlen; mehr noch, es bremst die Entfaltung der Persönlichkeit der Menschen durch ihre Arbeit.“27
Diese Leere zeigt den großen Bedarf an einer Neudefinition der Arbeit, an Personen, die fähig sind, ihre Mitarbeiter zu motivieren, zu träumen und an ein Projekt glauben zu lassen, für das sie gerne das Beste aus sich geben.Philippe Rosinski sagt in dem Zusammenhang, IBM habe belastbare Ergebnisse dafür, dass „zwischen 28 und 36 Prozent des Unternehmenserfolges ursächlich mit dem Klima im Unternehmen zusammenhängen“,28 und dieses Klima hängt direkt zusammen mit der Fähigkeit, den Sinn der Arbeit zu wecken und wiederzubeleben.
Der heutige Mensch sieht und erlebt sich vereinzelt, isoliert und dazu gezwungen, allein seinen Weg zu suchen.
Die Unternehmen leiten heute ihre Mitarbeiter dazu an, ihre professionelle Karriere zu bauen, wobei sie stärker eine individualistische Haltung fördern als die der Zugehörigkeit, eine Flucht vor Bindungen und Idealen anstelle eines Wiederaufbaus vitaler Arbeitsbindungen im Unternehmen. In diesem Sinne sagt Kentenich, dass unsere Zeit kein Empfinden für Bindungen habe, sondern eher von Bindungsflucht gekennzeichnet sei.29 Darum arbeitet der Mensch, ohne sein ganzes Wesen einzubringen, verschlafen und schwerfällig, ohne Motivation, mit gewisser Tristesse und Lustlosigkeit und ohne sich als Teil eines Leben erzeugenden, motivierenden Projektes zu fühlen.
Die geistentleerte Professionalitäts- und Perfektionismus-Kultur hat zu einem ständigen, übertriebenen Blick auf das, was schlecht läuft, geführt und das Vertrauen untergraben, die unverzichtbare Haltung für Freiheit und als Folge davon Kreativität der Mitarbeiter. Leider wird bis heute in einer großen Zahl von Unternehmen übertrieben und einseitig Effizienz und Leistung gesucht und durch Druck und Machtmissbrauch angezielt, was Angst und Schuldgefühle schafft als eindeutiger Spiegel einer autoritären Führungskultur. Ganz deutlich macht Kentenich dies, wenn er sagt: „Weil wir zu viel mit dem Furchtmotiv arbeiten, deswegen erziehen wir so viele Krüppel, deswegen sind wir selbst so krüppelhaft, kommen nicht hinaus über eine gewisse Grenze unseres Wesens.“30
Der CEO des deutschen Unternehmens Puma, Jochen Zeitz, erklärt mit einer organischen Sichtweise, dass „wir die Perspektive weiten und unsere innere und äußere Welt als ein globales Ganzes verstehen, dessen Wachsen simultan geschieht. Wir müssen aufhören, uns auf unsere mikroskopisch kleine Welt des Unternehmens zu begrenzen, um auf der makroskopischen Ebene das holistische Bild der Wirklichkeit zu betrachten.“31
Auf der gleichen Linie der Sicht auf die Welt als eine vernetzte Wirklichkeit betont Papst Franziskus im Blick auf die ökologische Krise: „Wenn die ökologische Krise ein Aufbrechen oder ein Sichtbarwerden der ethischen, kulturellen und spirituellen Krise der Moderne bedeutet, können wir nicht beanspruchen, unsere Beziehung zur Natur und zur Umwelt zu heilen, ohne alle grundlegenden Beziehungen des Menschen zu heilen.“ 32
Vielleicht liegt der Schlüssel für eine organischere Sicht im Bewusstmachen dessen, was Enrique Shaw sagt: „Niemand kann sich in der Weise als Besitzer des Unternehmens ansehen, wie er sich als Besitzer seines Eigenheims versteht: Das Unternehmen ist offensichtlich nicht so „privat“ wie „mein Haus“.“ 33 In der christlichen Gesellschaftslehre gilt: „Das Prinzip der Unterordnung des Privatbesitzes unter die allgemeine Bestimmung der Güter und daher das allgemeine Anrecht auf seinen Gebrauch ist eine ,goldene Regel‘ des sozialen Verhaltens und das ,Grundprinzip der ganzen sozialethischen Ordnung.‘ (...) Die Kirche verteidigt zwar den berechtigten Anspruch auf Privateigentum, lehrt jedoch ebenso unmissverständlich, dass jedes Privateigentum immer mit einer „sozialen Hypothek“ belastet ist, damit alle Güter der allgemeinen Bestimmung dienen, die Gott ihnen zugeteilt hat.“ 34 Damit will ich nicht sagen, dass ich mich gegen privatkapitalistische Unternehmen wende, im Gegenteil: Ich bin überzeugt, dass es der Impuls aus privater Tätigkeit ist, der Steigerung von Reichtum und Fortschritt bewirkt. Shaw selbst bekräftigt, dass „das Unternehmen in der Regel in privater Hand sein und seine Sozialfunktion in einem Ambiente der Freiheit wahrnehmen sollte.“ 35 Doch wir müssen uns bewusst werden, dass Erfolge und Reichtum des Unternehmens Frucht gemeinsamer Arbeit sind und nicht einsamer Arbeit von Aktionären, weshalb die Früchte dieser gemeinsamen Arbeit in irgendeiner Weise geteilt werden müssen, sei es mit einem angemessenen Gehalt, Prämien oder anderen Maßnahmen, die das Ergebnis der geteilten Anstrengung widergeben, was fraglos ein stolzes Gefühl der notwendigen Teilhaberschaft und Mitwirkung weckt und nicht das Empfinden, nur Gegenstand des erreichten Erfolges zu sein.
Diese organische Sicht von Leben und Arbeit ist es, die uns dazu bringt, Sinn zu finden in unseren Aufgaben und sie mit unserem Leben als ein Ganzes zu verknüpfen, das uns zur Freude führt.
Ist es in unserer mechanistischen Welt möglich, dass Menschen all ihre Fähigkeiten entfalten können? Ist es möglich, als Menschen mit eigener Initiative und Motivation zu arbeiten, die von innen her Antwort geben auf ihre Ideale? 36 Menschen, die ein seelisches In-, Mit- und Füreinander leben und zugleich innerlich zentrierte Persönlichkeiten sind? 37
Fragen zur Reflexion:
Welche mechanistischen Aspekte entdecke ich an meiner Art zu arbeiten?Welche Aspekte kann ich in meiner Art der Beziehungsgestaltung so verändern, dass mein Umgang mit Kollegen in der Arbeit weniger „kaufmännisch“ ist?Wie kann das Erzeugen von Bindungen mir helfen weniger „mechanistisch“ zu leben?Was kann ich tun, um mehr Bindungen mit meinen Arbeitskollegen zu schaffen?Was kann ich tun, um meine Arbeit und mein Privatleben mehr zu verknüpfen, sodass ich „ein einziges und ganzes Leben“ (Arbeit und Privates) lebe?Welche konkreten Aspekte kann ich fördern, um das Arbeitsklima in meiner Arbeit zu verbessern?Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um eine kreativere Arbeit zu stärken?Macht das mechanistische Arbeiten es mir schwer, meine eigene persönliche Originalität zu entdecken? Wenn dem so ist, warum?Meditation: Ich betrachte meine mentalen Modelle
„Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so wie wir sind“ Talmud
Ich beobachte meine Art und Weise, die Realität zu betrachten, wie ich die Ereignisse meines Lebens und alles, was geschieht, interpretiere und erlebe, und ob diese Art gesund oder eingrenzend ist. Ich entdecke, dass ich sehr oft eine Interpretation der Realität mache, die alles, was ich beobachte und erlebe, aus einem kritischen Blickwinkel heraus zusammenbringen möchte, wobei ich immer etwas finde, was schlecht ist oder verbessert werden müsste ... Ich nehme auch wahr, wie meine mentalen Modelle, heißt, die Art und Weise, wie ich die Welt anschaue, wie ich die Realität betrachte, von meiner Geschichte, meiner Kultur, meinem Studium, meiner Lektüre geprägt sind ... Ich sehe, wie mein Blick auch von meinen Gefühlen beeinflusst wird, von Freude und Trauer ... wie meine Arbeit sich gestaltet nach dem, wie ich mein Tun und das der anderen wahrnehme ... Ich entdecke, dass die Art und Weise, wie ich beobachte (Beobachter-Ich) mein Handeln eingrenzt, verengt oder weitet ... indem ich neue Welten und Möglichkeiten entdecke oder unbeschrittene Wege von vorneherein ausschließe ... wie ein grauer und kalter Tag voller Sonne werden kann, wenn ich meinen Blick auf die Realität verändere ... Diese beengenden Voreinstellungen prägen meine Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie machen aus der Realität eine begrenzte und langweilige Welt ... Ich frage mich, welche Voreinstellungen ich konkret in diesem Moment in meinem Leben habe ... Ich zähle sie auf ... Ich versuche zu entdecken, wie sich meine Voreinstellungen zeigen, wenn ich unter Druck stehe oder eine Angst in mir aufsteigt ... Ich frage mich, welche Voreinstellungen in mir aufsteigen, wenn ich bestimmte Personen auf der Arbeit hart beurteile oder wenn ich indifferent bin gegenüber anderen Personen, die mir in meinen Beziehungen keinen Vorteil bringen. Wieviel Frust und Unfähigkeit übertrage ich auf andere, als wären sie verantwortlich für das, was ich verabscheue oder was mich frustriert? Ich versuche zu entdecken, wie sie sich zeigen, wenn ich unter Druck stehe oder eine Angst aufsteigt … Ich weiß, dass meine begrenzten Voreinstellungen meinen Blick auf die Wirklichkeit beschränken. Sie machen aus der Realität eine begrenzte, vorhersehbare, graue, langweilige und oberflächliche Welt …
Heute beschließe ich, meine Vorurteile und begrenzten Voreinstellungen aufzugeben und mit größerer Offenheit den anderen zuzuhören … Raum schaffen in jenem Teil meines Lebens, in dem ich mich geliebt fühle und mich selbst liebe und respektiere …
12 Josef Kentenich. „Las Fuentes de la Alegría“. Editorial Patris (2006), Seite 129; (Deutsch: Josef Kentenich. „Vollkommene Lebensfreude“. Vallendar 1984).
13 Josef Kentenich. „El Pensamiento Social del P. José Kentenich“. Editorial Nueva Patris (2010), Seite 104; (Deutsches Original des zitierten Textes in: Josef Kentenich. Oktoberbrief 1949).
14 Enrique Shaw. „... y dominad la tierra“. ACDE-Verlag (2010), Seite 147.
15 Papst Franziskus. Enzyklika „Laudato Si“, Nr. 18.
16 Papst Franziskus. Enzyklika „Lautato Si“, Nr. 110.
17 Vgl. Horacio Sosa. „El desafío de los valores. Aportes de José Kentenich a la pedagogía actual“. EDUCA Ediciones de la Universidad Católica Argentina 2000, Seiten 105 ff.
18 Vgl. Horacio Sosa. „El desafío de los valores. Aportes de José Kentenich a la pedagogía actual“. EDUCA Ediciones de la Universidad Católica Argentina 2000, Seiten 105 ff.
19 Josef Kentenich. „Que surja el Hombre Nuevo“. 1971, Seite 72; (Deutsch: Kentenich, „Dass neue Menschen werden“. Seite 69).
20 Sergio Sinay. „Para qué trabajamos?“. Paidos-Verlag (2012), Seite 36.
21 Zeitung La Nación vom 20. August 2016, Seite 3, Rubrik „Campo“ (Landwirtschaft).
22 Der Ausdruck „Herzensgemeinschaft“ beschreibt metaphorisch eine innige und tiefe Verbundenheit in voller Harmonie der Personen untereinander.
23 Zusammenfassung von Aussagen Pater Kentenichs in einem Vortrag von P. Horacio Sosa.
24 H. Sosa „La vinculación a las cosas, dinámica de la relación y múltiple mensaje“. 2.1.2., Zeitschrift Carisma, Nr. 30.
25 Zygmunt Bauman. „¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?“. Paidos-Verlag (2014), Seite 11; (Deutsch: „Retten uns die Reichen?“. Herder 2015).
26 Josef Kentenich. „Desafíos de nuestro tiempo“. Editorial Patris, Seite 14. Sammlung verschiedener pädagogischer Texte aus den Jahren 1948 – 1950. Zitat aus Oktoberbrief 1949, Seiten 72f.
27 Enrique Shaw. „Y dominad la tierra“. ACDE-Verlag (2010), Seiten 82f.
28 Philippe Rosinski. „Coaching y Cultura“. Editorial Gran Aldea Editores (2008), Seite 39.
29 Josef Kentenich. „En libertad plenamente hombres“. Editorial Patris, (2003), Seite 64.
30 Josef Kentenich. „Textos Pedagógicos“. Editorial Patris (2008), Seite 374. Text entnommen aus El Hombre Redimido (1935), 100f; (Deutsch: „Der erlöste Mensch“. Seite 233).
31 Jochen Zeitz, Anselm Grün. „Gott, Geld und Gewissen: Mönch und Manager im Gespräch“. Seiten 231f.
32 Papst Franziskus. Enzyklika „Laudato Si“. Nr. 119.
33 Enrique Shaw. „Y dominad la tierra“. ACDE-Verlag (2010), Seite 85.
34 Papst Franziskus. Enzyklika „Laudato Si“. Nr. 93.
35 Enrique Shaw. „Y dominad la tierra“. ACDE-Verlag (2010), Seite 90.
36 vgl. Josef Kentenich. „En libertad plenamente hombres“. Editorial Patris (2003) Seite 166.
37 vgl. Josef Kentenich. „En libertad plenamente hombres“. Editorial Patris (2003) Seite 57.
ORGANISCHE ARBEIT ALS WEG ZUR FREUDE
Die Art, wie wir arbeiten, ist ein Ausdruck unserer selbst.Papst Franziskus sagt in „Laudato Si“: „Jede Form von Arbeit setzt eine Vorstellung über die Beziehung voraus, die der Mensch mit dem anderen aufnehmen kann und muss.“ 38
In der gleichen Richtung macht Enrique Shaw deutlich: „Man muss die Fabrik vermenschlichen. Um einen Menschen zu beurteilen, muss man ihn lieben. Darum muss man die Mechanisierung der Arbeit verhindern, diesen Zustand latenter Demütigung der Arbeiter, der darin besteht, auszublenden, wofür man arbeitet, dass die Arbeiter nicht zählen, diese Ungleichheit der Lebenssituationen, die fast immer jegliche individuelle oder kollektive menschliche Entfaltung unmöglich macht und damit jede Hoffnung und den besten Lebenssinn nimmt.“ 39Kentenich bietet eine Synthese, in welcher der Sinn organischer Arbeit und organischer Unternehmensführung zusammengefasst ist. Es ist ein Unternehmensleitbild, ein Kompass für Führungskräfte. Er sagt: „Nach Gottes Absicht soll sie (die Arbeit) affektbetonte Teilnahme sein an der schöpferischen und sich verschenkenden Tätigkeit Gottes. (...) Die Arbeit soll naturgemäß mit dem Werk verbunden sein, sie sollte den schöpferischen Gestaltungswillen wecken und befriedigen.“40
Diese Vision findet sich genauso bei Papst Franziskus, der deutlich macht: „Die Arbeit sollte der Bereich dieser vielseitigen persönlichen Entfaltung sein, wo viele Dimensionen des Lebens ins Spiel kommen: die Kreativität, die Planung der Zukunft, die Entwicklung der Fähigkeiten, die Ausübung der Werte, die Kommunikation mit den anderen, eine Haltung der Anbetung.“41
Analysieren wir Schritt für Schritt die zentralen Konzepte, mit denen Kentenich organische Arbeit umschreibt:
1) Affektbetonte Teilnahme
Was bedeutet affektbetonte Teilnahme in der Arbeit? Affektbetonte Teilnahme ist Arbeiten mit ganzem Herzen, das heißt, dass wir unsere ganze Person mit zur Arbeit nehmen und nicht nur den Körper oder den Verstand oder beides. Affektbetonte Teilnahme heißt, auch all unsere Affekte und Emotionen mit in die Arbeit zu nehmen, uns mit unserem ganzen Sein in die täglichen Aufgaben hineinzugeben. Das ist nur möglich, wenn wir fähig sind, tiefe Bindungen an die Arbeit und an unsere Arbeitskollegen zu entwickeln und auch unsere Gefühle und Empfindungen in das Handeln einzubeziehen. Im Kleinen Prinzen zeigt Antoine Saint Exupéry uns den Weg, und zwar im Abschnitt über die Begegnungen des Fuchses mit dem Kleinen Prinzen:
„Komm und spiel mit mir“, schlug der kleine Prinz vor ...
„Ich kann nicht mit dir spielen“, sagte der Fuchs. „Ich bin nicht gezähmt.“
„Was bedeutet ,zähmen‘?“
„… Es bedeutet ,sich vertraut miteinander machen‘.“
„Vertraut machen?“
„Natürlich“, sagte der Fuchs. „Du bist für mich nur ein kleiner Junge, ein kleiner Junge wie hunderttausend andere auch. Ich brauche dich nicht. Und du brauchst mich auch nicht. Ich bin für dich ein Fuchs unter Hunderttausenden von Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, dann werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig sein. Und ich werde für dich einzigartig sein in der ganzen Welt.