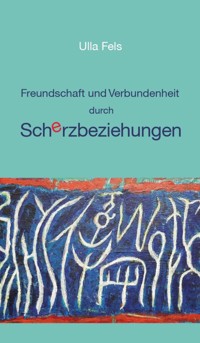
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Humor lassen sich Widrigkeiten und Konflikte leichter bewältigen. Menschliche Schwächen, soziale Unterschiede und Tabus können angesprochen und besser toleriert werden. In vielen außereuropäischen Gesellschaften wurden deshalb sogenannte Scherzbeziehungen entwickelt und in das soziale Leben eingebunden. 2014 wurden sie von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Am Beispiel Westafrikas zeigt Ulla Fels, dass diese originelle, kommunikative Methode erlernbar ist, wann sie angewandt wird und weshalb sie in Beziehungen das Gefühl von Freundschaft und Verbundenheit fördert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gewidmet allen Menschen,
die gerne neue Wege gehen.
Ulla Fels
Freundschaft
und Verbundenheit
durch
Scherzbeziehungen
© 2021 Ulla Fels, Hamburg, [email protected]
Umschlag/Layout: Susanne Goldstein
Umschlag/Bild: Werner Götz, 2010
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback 978-3-347-05724-1
e-Book 978-3-347-05726-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Im Spaß kann vieles gesagt werden – der Nutzen von Humor und Lachen
Scherzbeziehungen? Noch nie gehört!
Scherzbeziehungen – wie, wann, mit wem und warum überhaupt?
Scherzallianzen außerhalb der Familie
Einseitige Scherzallianzen
Mediation durch Scherzpartner*innen
Koloniales Erbe und Ausblick in die Zukunft
Danksagung
Bibliografie
Prolog
Weil es der Zufall oder das Schicksal so wollte, arbeitete ich schon während meines Ethnologie Studiums in verschiedenen Funktionen bei Filmproduktionen. Geblieben bin ich letztendlich beim Dokumentarfilm. Als Tonfrau und Kameraassistentin kam ich so in verschiedenste Länder der Welt. Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, begann ich eigene Radio- und Fernsehbeiträge zu produzieren und reiste weiterhin viel.
In Westafrika begegnete ich jeden Tag Menschen, die sich gegenseitigen mit provokativen Sticheleien verspotteten. Alle Anwesenden lachten nur darüber. Die Beteiligten selbst aber blieben immer freundschaftlich miteinander verbunden. Mich faszinierte diese Art des Umgangs. Kurze Zeit später fand ich heraus, dass es sich bei den frechen Späßen zwischen bestimmten Personen um klar definierte Scherzbeziehungen1 handelte. Da ich immer ein Tonband dabeihatte, begann ich derartige Situationen aufzuzeichnen. Ich war überzeugt, nur eine möglichst genaue Wiedergabe der kurzen Wortgefechte und des dahinterstehenden Konzeptes könne uns Nordeuropäern diesen uns unbekannten, aber inspirierenden Kommunikationsstil näherbringen.
Aus diesen Aufnahmen ist das folgende Buch entstanden. Es erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Abhandlung, auch wenn ich mich darin auf einige Wissenschaftler und ihre Forschungsergebnisse beziehe. Nach einer Einführung über den „Nutzen von Humor und Lachen“ besteht der Hauptteil des Buches aus Gesprächen mit Westafrikaner*innen über die Geschichte und die friedliebenden Absichten, die hinter den Scherzbeziehungen stehen. Hinzu kommen vom Originalton transkribierte Dialoge zwischen Scherzpartner*innen. Diese Passagen werden ergänzt durch persönliche Überlegungen und Erkenntnisse zu diesem uns fremden Umgang mit Humor und Lachen. Er kann uns anregen, auch in unserer westlichen Kultur weitere Spielarten von Humor zu entwickeln. Das Wissen über und der Umgang mit dem heiteren Spott in den Scherzbeziehungen kann sowohl in der alltäglichen Kommunikation als auch im interkulturellen Dialog und in der sozialen und pädagogischen Arbeit von großem Vorteil sein.
„Das Lachen ist ein besonderes Wort, es befreit und wirft die Fesseln ab, ist ungebunden wie ein Fluss. … Es ist eine lebendige Wirkkraft, eine Zaubermacht, die das Unheil bannt, die Spannungen löst, auf magische Weise die Welt wieder ins Lot rückt.“2
1 Englisch: Joking Relationship. Französisch: Parenté à Plaisanterie oder Alliance à Plaisanterie.
2 Jahn, Janheinz, Muntu, 1986, S. 144, und Afrika lacht, 1968, S. 7.
Im Spaß kann vieles gesagt werden – der Nutzen von Humor und Lachen
In vielen außereuropäischen Gesellschaften zeigen sogenannte Scherzbeziehungen, dass Humor und Lachen nicht nur spontane Reaktionen sind. Im Scherz geäußerte Provokationen und Verunglimpfungen werden dort bewusst und systematisch eingesetzt, um durch gemeinsames Gelächter Beziehungen und Situationen zu entspannen. Emotionale Dissonanzen, Meinungsverschiedenheiten und Interessenkonflikte können so friedlich gelöst oder auch ganz vermieden werden. Hinter dieser Kulturtechnik steht die Einsicht, dass kein Mensch perfekt ist. Jeder von uns hat sowohl positive als auch negative Eigenschaften, Makel und Schwächen. Über diese „Schattenseiten“ des Menschen machen sich die Scherzpartnerinnen und –partner in aller Öffentlichkeit lustig. Dabei ist keiner der Beteiligten beleidigt oder setzt die enge, soziale Verbundenheit durch Wut und Rache aufs Spiel. Im Gegenteil - alle Scherzpartner*innen sind zur gegenseitigen Hilfeleistung und Schlichtung von Konflikten verpflichtet.
Vor einigen Monaten fragte ich zwei junge Freunde aus Mali, ob sie Scherzbeziehungen kennen, und ob diese heute noch in ihrer Heimat vorkommen. Der eine schaute mich verwundert an und sagte: „Natürlich gibt es sie immer noch überall! Habt ihr denn keine Scherzbeziehungen mehr?“ Und als ich ihm daraufhin antwortete, wir hätten nie welche gehabt, war er noch erstaunter und konnte dies gar nicht glauben! Der andere antwortete: „Bei unseren Scherzpartner*innen können wir uns alles erlauben und alles nehmen, was wir möchten!“ Dabei ging ein strahlendes Lachen über sein Gesicht!
Schon im 13. Jahrhundert sprach Sundiata Keïta, der Herrscher des Malireiches, in seiner weltweit ersten Menschenrechtscharta3 von Scherzbeziehungen als „Pfand des Friedens und des sozialen Zusammenhalts“. 2014 nahm die UNESCO die Scherzbeziehungen in das immaterielle Weltkulturerbe auf. Bereits seit Ende der neunziger Jahre diskutieren und nutzen auch westafrikanische Politiker*innen diese Beziehungen wieder vermehrt als Mittel zur Konfliktbewältigung.
In Europa und Nordamerika kennen wir alle Menschen, die gut Witze erzählen können. Der eine oder die andere vermag vielleicht auch Situationskomik wunderbar auszudrücken. Deshalb lachen wir immer wieder über irgendjemanden oder irgendetwas in unserem alltäglichen Zusammenleben. Wie in Kindertagen haben wir aber meist Angst davor, selbst Ziel des Gelächters zu sein und auf Grund von Schwächen oder Fehlern ausgelacht und nicht ernst genommen zu werden.
In manchen Gegenden Europas amüsieren sich jedoch Handwerker- und Arbeiter*innen - ähnlich wie in den Scherzbeziehungen - über flapsige Anmachen und bissige Bemerkungen. Die Beteiligten lachen, ohne beleidigt zu sein. Eine dieser Regionen ist das Ruhrgebiet, wo in den ehemaligen Bergarbeitersiedlungen schon vor mehr als hundert Jahren viele, meist arme Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkamen und durch die harte Arbeit unter Tage verbunden waren. Auch in Großbritannien und Skandinavien machen sich die Beschäftigten in einigen Industrie- und Dienstleistungsbereichen die schwere Arbeit durch Scherzbeziehungen erträglicher.4
In Ghettos wie z. B. in Harlem oder in der Bronx vergnügen sich Afroamerikaner*innen mit provokativen Herausforderungen beim „Playing the Dozen“5 oder beim sogenannten „Dissen“. Und Rapper*innen verhöhnen sich im Spaß während ihrer „Battels“. „Gedisst“ wird inzwischen auch unter europäischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Schulpausen und bei anderen Gelegenheiten. Die dreisten, gegenseitigen Verunglimpfungen wirken auf Außenstehende verletzend. Meist sind sie jedoch Ausdruck von Zusammengehörigkeit und Freundschaft. Diese Art der Kommunikation wurde vom Hip-Hop der afroamerikanischen Kultur inspiriert. Ihr Ursprung liegt vermutlich in den afrikanischen Scherzbeziehungen.
Grundsätzlich können wir jedoch davon ausgehen, dass diese in den USA und Europa vorkommenden Varianten der Scherzpartnerschaften nie die verbindliche Verpflichtung zur Solidarität, Hilfeleistung und Streitschlichtung aufweisen wie z. B. in afrikanischen Gesellschaften. Ohne dieses Abkommen besteht die Gefahr, dass aus den ursprünglich lustig gemeinten Provokationen im Lauf der Zeit Konkurrenz, ernsthafte Aggression und tiefe Feindschaft entstehen.
Unter dem Einfluss der christlichen Kirche wurde das Lachen in unserer Kultur schon früh auf die hinteren Bänke der menschlichen Möglichkeiten verwiesen. Allerdings dienten schon im Mittelalter Narrenfeste und Karneval als eine Art Ventil. Sie boten den niedrigen klerikalen Rängen und dem Volk die Gelegenheit, sich durch Parodie des Adels und der Kirchen- und Staatsdiener auszutoben. Darüber hinaus sorgten Hofnarren nicht nur für gute Unterhaltung, sondern übten auch Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Selbst vor großem Publikum konnten sie sich durch Spott und clowneske Ironie über die „Sünden“ und das Fehlverhalten ihrer Herrschaften lustig machen. Den Damen der Oberschicht war es jedoch mehr oder minder verboten, in der Öffentlichkeit laut zu lachen. Sie galten als „Hüterinnen des Anstands“. Auch von den Herren der besseren Gesellschaft wurde außer in bestimmten Zirkeln und bei manchen Anlässen ein ernsthafter und förmlicher Umgang erwartet. Dennoch scherzten die Menschen miteinander, und Heiterkeit und Spaß konnten nicht wirklich aus dem Alltag verbannt werden. Es entwickelten sich jedoch von christlichen Werten der Sittsamkeit geprägte Normen, die humorvolles Verhalten und Lachen in der Öffentlichkeit nicht wirklich begünstigten, geschweige denn sie bewusst förderten. Die Industrialisierung verstärkte diese Tendenz durch feste Arbeitszeiten, Schulpflicht und immer höheren Leistungsdruck.
Auf Grund der historisch gewachsenen Wertvorstellungen wurden Humor und Lachen lange Zeit weder wirklich erforscht noch kultiviert. Manche Autoritäten und Dogmatiker beurteilten sie sogar als unbequem und „gefährlich“. Meist gilt noch heute in der Schule und bei der Arbeit die Devise: Leistung wird nur durch ernsthaftes Bemühen erbracht! Für das der westlichen Kultur immanente Ziel „immer höher, immer weiter, immer besser“ erscheint das Lachen nicht förderlich.
Beim kleinen Kind sind kreatives Spiel und Gelächter noch auf natürliche und uneingeschränkte Weise eng verbunden. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, schrieb Friedrich Schiller.6 Beim Erwachsenen kann die spielerische Seite von Humor und Lachen ein Gefühl von Distanz und Freiheit schaffen, aus dem heraus Ideologien, Lehrmeinungen und Behauptungen hinterfragt und relativiert, aber auch kreativ bearbeitet werden können.
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Schimpansen ihre Jungen kitzeln, um sie abzustillen und um die Mutter-Kind Symbiose aufzulösen. Wie wir alle wissen, ist Kitzeln einerseits ein Angriff und andererseits ein Zeichen von großer Nähe. Durch diese widersprüchliche Information kann das Gehirn die Situation weder mit reflexartiger Abwehr noch durch emotionale Hinwendung lösen. Die dadurch entstehende Verwunderung äußert sich beim Menschen in einem Anfall von Lachen. „Lachen ist Ausdruck von Emanzipation. Lachen entsteht, wenn man Angst hinter sich lassen kann“, erklärt der Lachforscher Rainer Stollmann in einem Interview.7 Außerdem verschafft uns herzhaftes Lachen auch einen Moment der Selbstvergessenheit und Abstand von der eigenen Ichbezogenheit, unserem Ego.
Wie schon Hippokrates in der Antike glauben wir heute, dass Lachen gesund ist! Humor erscheint uns allerdings als eine spezielle Fähigkeit, die nur wenige beherrschen, nämlich auf schwierige Situationen und Menschen heiter und gelassen zu reagieren, und über sie und sich selbst lachen zu können. Diese Fähigkeit ist nicht Ausdruck von Arroganz, sondern zeugt von der Einsicht, dass in jedem Menschenleben Schwächen, Fehler und unbedachte Handlungen vorkommen dürfen. Ausgelacht wird dabei keiner, da eine humorvolle Haltung immer die eigene Person mit einbezieht. Wie sich aber Humor und Lachen entwickeln lassen, und welchen Nutzen sie über den einzelnen Moment hinaus haben, darüber denken wir kaum nach.
Seit einiger Zeit ändert sich diese Einstellung jedoch. Wir verlassen uns nicht mehr nur auf einige Stand-up-Comedians und Entertainer im Fernsehen, um nach getaner Arbeit Unterhaltung und Spaß zu erleben. In einer stressgeplagten Welt sehnen wir uns nach gemeinsamer Fröhlichkeit im Beruf und im Alltag. Nicht nur der materielle Wohlstand ist wichtig, sondern auch die Frage nach dem Betriebsklima und der sozialen Verbundenheit. Diese können durch Wertschätzung, Mitgefühl und humorvollen Umgang entschieden verbessert werden. Deshalb beschäftigen sich inzwischen immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen mit dem alltäglichen Sinn und Nutzen von Humor und Lachen.
Norman Cousin, Herausgeber einer großen amerikanischen Zeitung, war der Wegbereiter der medizinischen Humorforschung. Ende der sechziger Jahre erkrankte er schwer an einer generalisierten und äußerst schmerzhaften Gelenkentzündung, die zu völliger Bewegungsunfähigkeit führen kann. Ein langer Krankenhausaufenthalt in Verbindung mit der Einnahme vieler Medikamente brachte keine anhaltende Besserung. In dieser scheinbar ausweglosen Situation erinnerte Norman Cousin, irgendwo gelesen zu haben, dass die seiner Erkrankung zugrunde liegende Schwäche des Immunsystems u. a. auch durch negative Gefühle wie Stress, Angst und Ärger verursacht wird. Da er derartige Emotionen gut kannte, beschloss er, sich selbst mit humorvollen Büchern und Filmen zu therapieren. Nach kurzer Zeit fand er heraus, dass herzhaftes Lachen über eine Zeitspanne von zehn bis fünfzehn Minuten ihn einige Stunden schmerzfrei schlafen ließ. In Verbindung mit seinen Medikamenten verbesserte diese Form der Lachtherapie seinen Zustand schließlich soweit, dass er wieder arbeiten konnte. Ab Ende der siebziger Jahre widmete er sich dann der weltweiten Koordination von klinischen Untersuchungen über Humor.
Obwohl uns Lachen innerlich ausgeglichen und zufrieden machen kann, kommt es in unserem heutigen leistungsorientierten und schnelllebigen Alltag häufig zu kurz. Untersuchungen aus der Glücksforschung haben ergeben, dass Menschen vor etwa fünfzig Jahren dreimal so viel gelacht haben. Heute lachen Erwachsene nur noch circa fünfzehn Mal am Tag Kinder dagegen bis zu vierhundert Mal. Inzwischen wurde auch wissenschaftlich bewiesen, dass verschiedene Formen von Humor und Lachen ein Mittel gegen Stress sein können. Stress verursacht ungesunde Veränderungen im Körper wie z. B. Muskelverspannungen, Hochdruck und Schwäche des Immunsystems. Lachen dagegen wirkt entspannend und blutdrucksenkend. Dazu verbessert es durch vertiefte Atmung die Durchblutung und Konzentrationsfähigkeit und steigert die Immunabwehr. Humor und Lachen haben außerdem eine starke Auswirkung auf unser emotionales und geistiges Wohlbefinden. Verzieht der Mensch sein Gesicht zum Lachen benutzt er dazu die Mund- und Augenmuskulatur. Selbst wenn kein realer Anlass vorhanden ist, stellt sich dabei durch Ausschüttung von Glückshormonen ein angenehm fröhliches Gefühl ein. Diese innere Entspannung ermöglicht mehr Flexibilität und Distanz zu sich selbst. Neue Perspektiven und kreativere Problemlösungen eröffnen sich.8 Lachen und Humor können so die Aufmerksamkeit und Kommunikation verbessern und die Toleranz gegenüber Fremdem vergrößern. Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur und Interessenslage werden leichter akzeptiert und emotionale Abwehr, Anspannung und Angst verringert.
Ein mir unbekannter Autor schrieb: „Humor öffnet verschlossene Herzen. Humor kann uns aus dem Griff unserer Gedanken befreien. Wenn wir lächeln, haben wir das Gefühl, Dinge akzeptieren zu können, die wir vorher nicht annehmen konnten. Wir haben das Gefühl, jenen, die uns Unrecht getan haben, vergeben zu können. Darum ist Humor ein wesentlicher Teil des Lebens.“
Jeder Mensch hat schon einmal herzlich über eine komische Begebenheit gelacht, auch wenn unser Verständnis für Witz und Humor abhängig ist von unserer sozialen Umgebung und Kultur. Humor eignet sich jedoch überall auf der Welt dazu, sowohl soziale Interaktion zu vereinfachen als auch Widerstand auszudrücken. Wirkt er subversiv, „siegt“ er mit inoffiziellen Werten über offizielle, mit Zwanglosigkeit über die Etikette und kann damit der Egalisierung von Hierarchien dienen. Mit viel Kreativität weist er auf die Relativität der angenommenen Wirklichkeit hin und öffnet die Fantasie für die Idee, dass alles möglich ist.9





























