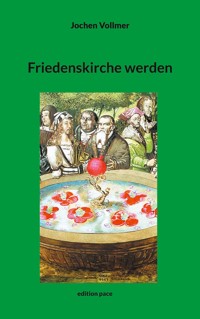
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jochen Vollmer (1939-2014) setzte sich leidenschaftlich für den christlich-jüdischen Dialog ein und für die Überwindung des Antisemitismus in Theologie und Kirche. Auf der Suche nach ihren Ursprüngen ermittelte seine Sonde die Rechtfertigungslehre Luthers. Mit seiner Analyse leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Entgiftung von Theologie und Kirche. Das vermag in gleicher Weise seine Kritik der Kindertaufe gemessen an Luthers eigenem Anspruch und die Auseinandersetzung mit CA 16. Ein Friedenskatechismus rundet das Bild ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herausgegeben von Matthias-W. Engelke
Inhalt
Kirche und Glauben entgiften – Vorwort
Matthias-W. Engelke
Jochen Vollmer – Friedensfreund und Mitstreiter für eine Kirche des Friedens
Harald Wagner
Ist die Taufe von Unmündigen schriftgemäß? – 1998
Erasmus von Rotterdam: Die Klage des Friedens – 2000
Wir glauben an den Gott des Friedens – Bausteine und Impulse zu einem Katechismus Vorwort von
Ulrich Schmitthenner
– (2004) 2011
Israel – Volk, Land und Staat in biblischer Sicht – 2012
Gewalt überwinden – Kritische Anmerkungen zur theologischen Legitimation staatlicher Gewalt nach dem Augsburger Bekenntnis Artikel 16 – 2012
Die Freiheit eines Christenmenschen und Luthers antijudaistische Rechtfertigungslehre – 2013
Statt eines Nachwortes
Bibliografie
Kirche und Glauben entgiften Vorwort
Matthias-W. Engelke
Mit einem mennonitischen Freund hielt ich ein längeres Telefonat. Es ging um John Howard Yoders sexuelle Übergriffe. Dem Gespräch zugrunde gelegt hatten wir die ausführlichen Berichte und Artikel der Mennonite Quarterly Review von Januar 2015. Erschrocken musste ich feststellen, dass sich Yoder eine eigene Theologie zur Rechtfertigung seiner sexuellen Missbräuche zurechtgelegt hatte. Dies erinnerte mich an eine offene Frage, die den Judenhass Luthers betraf, und die mich schon viele Jahre beschäftigte. Ich konnte nicht annehmen, dass der Judenhass Luthers nichts zu tun habe mit seiner Theologie. Ich vermutete Weichenstellungen in Luthers Denken, durch die er seinen Judenhass mit seiner Theologie in Übereinstimmung bringen konnte. Die Vermutung blieb ohne Beleg. Dies berichtete ich meinem Gesprächspartner und er antwortete, ob ich denn nicht den Aufsatz von Jochen Vollmer zur Rechtfertigungslehre Luthers kennen würde, im Deutschen Pfarrerblatt veröffentlicht. Meine Recherche ergab, dass ich den Aufsatz wohl nach seinem Erscheinen gelesen, ihn in seiner Bedeutung aber nicht wahrgenommen hatte. Die erneute Lektüre elektrisierte mich: Luthers Rechtfertigungslehre anitjüdisch? Das „solus Christus“ gegen Juden und das Alte Testament gerichtet? Auch wenn ich mit Vollmers Argumentation – in diesem und anderen Beiträgen – nicht in allen Teilen übereinstimme, in ihren Grundzügen leuchtete sie mir ein. Sie sollte nicht in Vergessenheit geraten. Dieses Vorhaben war der Grundstein für den vorliegenden Sammelband ausgewählter Aufsätze von Jochen Vollmer.
Von diesem Projekt erfuhr der ehemalige Friedenspfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Ulrich Schmitthenner. Dies regte ihn an, Kontakt mit der Familie des 2014 Verstorbenen aufzunehmen. Auf diese Weise kam ich in den Besitz aller Aufsätze, die sich auf dem Computer von Jochen Vollmer befanden. Die Sichtung dieser Beiträge von 1992 bis 2013 ergab, dass – zunächst – eine Auswahl der bereits erschienenen friedenstheologisch relevanten Aufsätze veröffentlicht werden soll, ergänzt um zwei bislang unveröffentlichte. Sollte diese Publikation dazu führen, dass ein vermehrtes Interesse an den weiteren Arbeiten von Jochen Vollmer besteht, ist durchaus ins Auge gefasst, diese zumindest im Internet zugänglich zu machen. Interessenten wenden sich bitte an den Herausgeber.1
Vollmer weist gewiss nicht als Erster schlüssig nach, dass sich die Praxis der Kindertaufe nicht auf das Neue Testament berufen kann. Er belegt darüber hinaus, dass nach Luthers eigenem Verständnis die Kindertaufe zu unterlassen sei, da von einem Kinderglauben der Säuglinge – eine ad-hoc-Konstruktion Luthers – nicht auszugehen sei. Vollmer lehnte folglich die Taufe von Unmündigen in seiner Gemeinde ab. Dies brachte ihm den Widerspruch seiner Kirchenleitung ein. Vollmers Argumentation ist m. W. bis heute unwiderlegt.
In seinem Friedenskatechismus – der auch auf Englisch vorliegt2 – führt Vollmer behutsam ausgehend von den Herausforderungen der Gegenwart zu einer differenzierten Kultur der Bibellektüre. Auf diesem Weg erläutert er die Bedeutung der vorausgehenden Befreiungstaten Gottes, das Evangelium, und vermittelt ein Verständnis für die Gebote, den Glauben, das Beten und die Kirche.
Jochen Vollmer war Mitglied des deutschen Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes. Dort unterstützte er die Kommission Friedenstheologie, das der Gründung des Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie, OekIF, vorausging, von Anfang an. Im Versöhnungsbund wurde er aber besonders durch seine eindringliche Analyse des Bekenntnisartikels 16 der Augsburger Confession (CA) bekannt, nachdem dieser sowohl biblischer Überlieferung als auch der für Vollmer wesentlichen Teile christlichen Glaubens widerspricht. Er beförderte damit wesentlich den Prozess zur Infragestellung dieses Artikels, der eine Zeit lang sowohl in einigen Landeskirchen als auch im Lutherischen Weltbund geführt wurde. Aus diesem Grunde wird hier ein unveröffentlichter Beitrag zu der abgekürzt „CA 16“ genannten Thematik mit aufgenommen. Seine Datierung beruht auf Vollmers Systematik bei der Benennung von Dateien.
Sein Beitrag zu Erasmus von Rotterdam führte dazu, dass dessen Schrift „Klage des Friedens“ wieder neu in Erinnerung gerufen wurde. Zum 500. Jahrestag dieser Schrift veranstaltete der Deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes 2017 in Halle einen Hochschuldialog in Kooperation mit der Evangelischen Akademikerschaft, der evangelischen Fakultät, Halle, und der Frackeschen Stiftung Halle.3 Damit einher ging eine Neuveröffentlichung dieses Werkes.4
Vollmer setzte sich als promovierter Alttestamentler leidenschaftlich für den christlich-jüdischen Dialog ein und für die Überwindung des Antisemitismus in Theologie und Kirche. Auf der Suche nach ihren Ursprüngen ermittelte seine Sonde die Rechtfertigungslehre Luthers. Mit seiner Analyse leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Entgiftung von Theologie und Kirche.
Umso mehr verletzte es ihn zutiefst als ihm nach einem Beitrag zum Israel-Palästina-Konflikt5 vorgeworfen wurde, er würde „antisemitische Jauche“ 6 verbreiten. Dabei würdigte Vollmer ausdrücklich den Staat Israel als Zufluchtsort für alle Juden auf der Welt, bestritt ihm hingegen – wie jedem Staat – jegliche sakrale Würde. In einem Vortrag nimmt er zu den Vorwürfen Stellung und äußert sich biografisch – in diesen Schriften außerordentlich selten. Hierin gibt er seine Position zusammengefasst wider und entwickelt seine Argumentation über das Verhältnis von Universal und Partikular um einem wesentlichen Aspekt weiter.
Diese und andere Verleumdungen waren es wohl, die ihm zuletzt das Herz brachen.
Die vorausgestellte biografische Skizze zu Jochen Vollmer stammt von Harald Wagner, Pfarrer im Ruhestand in Korntal, von 1986-1995 Beauftragter der evangelischen Landeskirche in Württemberg für Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende.
Die Bibliografie zum Schluss versammelt zum einen die veröffentlichten Beiträge von Jochen Vollmer, für die ein Fundort nachgewiesen werden konnte. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für weitere Hinweise, Ergänzungen und Korrekturen ist der Herausgeber sehr dankbar. Zum anderen werden Arbeiten aufgelistet, die über Ulrich Schmitthenner freundlicherweise von Jochen Vollmers Familie zur Verfügung gestellt wurden. Interessentinnen und Interessenten können auf Nachfrage die einzelnen Beiträge zugesandt bekommen.
Dankbar bin ich Wolfgang Krauß, Bammental, für die Anregung Jochen Vollmer wieder in den Blick zu nehmen.
Ohne die freundliche Unterstützung von Ulrich Schmitthenner, Stuttgart, wäre es niemals zu diesem Band gekommen. Harald Wagner danke ich für die biografische Skizze. Und schließlich danke ich sehr der Familie von Jochen Vollmer für das außerordentliche Vertrauen, seinen digitalen Nachlass sowie eine Fotografie zur Verfügung gestellt bekommen zu haben. Der Dank gilt auch den Verlagen, die den Nachdruck ermöglicht haben. Die Stiftung Evangelische Friedensarbeit in Württemberg hat freundlicherweise einen Druckkostenzuschuss zur Verfügung gestellt.
In dieser Neuveröffentlichung wird nicht die Zitierweise biblischer Stellen gemäß den z. Z. geltenden Loccumer-Richtlinien verwendet, sondern die im Original benutzte beibehalten. Hingegen wurden die Beiträge der gegenwärtigen Rechtschreibung behutsam angepasst.
Aus dem Programm zum Hochschuldialog Halle 2017
1 2015 veröffentlichte Pfarrer Jörg Mutschler eine Sammlung von Predigten, die Jochen Vollmer in der Reutlinger Hohbuchgemeinde von 2002-2012 hielt. Dort enthalten auch ein Vorwort von Pfarrer Eberhard Braun und die Ansprache von Jörg Mutschler zur Trauerfeier von Jochen Vollmer am 31.03.2014.
2https://friedenstheologieinstitut.jimdofree.com/app/download/8475801663/Jochen_Vollmer_Peace_Catechism.pdf - zuletzt eingesehen am 18.09.2023.
3https://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=45141&elem=3035328Vgl. Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens. In: Stammler, Wolfgang Fr./Pagel, Hans-Joachim/Stammen, Theo (Hg.), Über Krieg und Frieden. Die Friedensschriften des Erasmus von Rotterdam, Essen 2017, 281-334.
4 Erasmus von Rotterdam: Die Klage des Friedens. Mit einem Vorwort von Brigitte Hannemann und einem Nachwort von Stefan Zweig. Aus dem Lateinischen übersetzt und herausgegeben von Brigitte Hannemann. Zürich 2017.
5Vom Nationalgott Jahwe zum Herrn der Welt und aller Völker. Der Israel-Palästina-Konflikt und die Befreiung der Theologie. In: Deutsches Pfarrerblatt, 111 (2011), 404409. Im Internet unter:https://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv?tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Baction%5D=show&tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Bcontroller%5D=Item&tx_pvpfarrerblatt_pi1%5BitemId%5D=3030 – zuletzt eingesehen am 18.09.2023.
6https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.balingen-pfarrer-jochenvollmer-loest-bundesweit-hitzige-debatte-aus.5d5cb705-bb50-4c31-8da6-1846b547b220.html - zuletzt eingesehen am 03.05.2023.
Jochen Vollmer – Friedensfreund und Mitstreiter für eine Kirche des Friedens
Harald Wagner
Jochen Vollmer (30.09.1939-26.03.2014) war für mich ein bewundernswerter Theologe, ein leidenschaftlicher Alttestamentler mit einem fast prophetischen Habitus. Er war unser Friedenstheologe der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer in Württemberg (EAK). Er war kämpferisch, wenn er etwas theologisch erkannt und durchdacht hatte und wollte unsere Landeskirche zu einer Kirche des Friedens bewegen. Jochen Vollmer durchforschte die biblischen, theologischen und kirchlichen Traditionen auf ihre Friedensrelevanz für die Gegenwart hin. Er scheute keine Konflikte mit der Kirchenleitung, vor allem nicht mit Bischof HANS VON KELER. Der Confessio Augustana Artikel 16: „dass Christen rechtmäßig Krieg führen dürfen“ war für ihn nicht biblisch, sondern Verrat am Geist der Bergpredigt und eine Irrlehre. Bei seiner Einsetzung als Pfarrer in Balingen bekannte er dies öffentlich zum Entsetzen seines bekenntnistreuen Dekans. Er hatte eine sanfte Seele in einem harten Kern. So war er auch der „Kunst des Friedens“ zugetan. Die Skulptur des David mit der Harfe: „Der dritte Ton“ in Vezelay, Frankreich hat ihn besonders berührt. Er sei zu couragiert, zu kämpferisch befanden staatliche Stellen. Er hatte in der Prüfung seiner Verfassungstreue im Schuldienst das Grundgesetz ganz im Geiste Gustav Heinemann als ergänzungswürdig betrachtet. Jochen Vollmer engagierte sich dafür, die Israelvergessenheit der Theologie zu überwinden und beteiligte sich am christlichjüdischen Dialog. Er trat ein für die Menschenrechte und Menschenwürde, auch der Palästinenser. Mit vielen engagierten Kollegen nahmen wir Abschied von ihm auf seiner Beerdigung in Reutlingen. In seinen Friedenstexten hören und erleben wir ihn ganz lebendig: „Jochen peacefully present“.
Ist die Taufe von Unmündigen schriftgemäß?
An den Anfang sei ein Zitat von Martin Luther gestellt, das diejenigen zu verunsichern geeignet sein kann, die in ihrer noch immer fraglosen Praxis der Säuglingstaufe meinen, sich fraglos auf Luther berufen zu können. In seiner Schrift „Vom Anbeten des Sakraments des heiligen Leichnams Christi“ weist Luther das Taufverständnis der ihm nahestehenden böhmischen Brüder ab, das darin unserem Taufverständnis heute entspricht, dass sie auf zukünftigen Glauben hin taufen:
„Auffs ander, Wie ich von ewrn geschickten horet, szo ist die tauffe auch recht bey euch, on das myr das eyn groß bewegung gibt, das yhr die jungen kinder teufft auff zukunfftigen glawben, den sie lernen sollen, wenn sie zur vernunfft komen, nicht auff gegenwertigen. Denn yhr haltet, die jungen kinder glewben nicht (Wie sie mich bericht) und teufft sie dennoch. Da hab ich gesagt, Es were besser, gar uberall keyn kind teuffen denn on glawben teuffen, Syntemal daselbs das sacrament und gottis heyliger name vergebens wirtt gebraucht, wilchs myr eyn grosses ist. Denn die sacrament sollen und kunden on glawben nicht empfangen werden odder werden zu grosserm schaden empfangen. Da gegen hallten wyr nach den wortten Christi ‚Wer da glewbt unnd getaufft wirtt‘, das zuvor odder yhe zu gleych glawbe da seyn muß, wenn man teufft, oder ein lautter spott Gottlicher maiestet drauß werde, als die da kegenwertig sey und gnade anbiete und niemandt neme sie an. Darumb achten Wyr, die jungen kinder werden durch der kirchen glawben unnd gebet vom unglawben unnd teuffel gereynigt und mit dem glawben begabt und alßo getaufft, Weyl solch gabe auch durch beschneyttung der Juden den kindern geben wartt, sonst hette Christus Matt. 19. nicht gesagt ‚Last die kindlin zu myr komen, solcher ist das hymelreych‘. On glawben aber hatt niemant das hymelreych. Und Wo man solche unßer meynung kundt umbstossen, als ich acht nicht umbzustossen sey, wollt ich lieber keyn kind teuffen leren, denn (wie gesagt) das mans on glawben teuffen sollt. Denn gottis name soll man nicht umbsonst brauchen, ob gleych aller Wellt selik keyt dran lege.“7
I. „EINE ZUTIEFST UNORDENTLICHE TAUFPRAXIS“
1969 nannte EBERHARD JÜNGEL die Säuglingstaufe „eine zutiefst unordentliche Taufpraxis“ 8 und forderte: „Es ist gewiss an der Zeit, dass die Gemeinden, Synoden und Kirchenleitungen die zutiefst unordentliche Taufpraxis der evangelischen Kirche als eine solche erkennen und entschlossen zu fragen beginnen, wie sie sich ändern lasst.“9 Das war vor fast dreißig Jahren. In der Zwischenzeit kann man kaum sagen, dass die Taufpraxis sich zum Positiven gewandelt hat. Im Gegenteil. Jahr für Jahr wissen die Kinder im Religionsunterricht, die Heranwachsenden im Konfirmandenunterricht weniger über die Bibel, den Glauben und die Kirche. Eltern, die der Kirche und ihrem Leben sehr fremd geworden sind, die Kirche für sich nicht brauchen und in Anspruch nehmen, die schon Jahre in der Kirchengemeinde wohnen, aber nicht wissen, wann und wo der Gottesdienst am Sonntag stattfindet, die eine kirchliche Trauung für sich abgelehnt haben, begehren die Taufe ihres Kindes, bewegen sich im Gottesdienst, in dem ihr Kind getauft wird, in der ersten Reihe völlig hilflos und sprechen weder das Glaubensbekenntnis noch das Vaterunser mit.
Der Sinn der Taufe wird schon lange kaum mehr verstanden und kann auch in einem zweistündigen Taufgespräch nicht vermittelt werden. Die Eltern sind zumeist sprachlos und können ihr Taufbegehren nicht artikulieren.10 Der Hinweis auf die Tradition ist oft das einzige Argument. Diffuse Ängste sind spürbar, ihr Kind könne ungetauft nicht den Kindergarten und den Religionsunterricht besuchen, werde zum Außenseiter und, wenn ihm etwas zustoße, komme es nicht in den Himmel. Immer wieder habe ich den Eindruck, dass die Freude bei Pfarrerinnen und Pfarrern darüber, dass Eltern trotz ihrer Entkirchlichung für ihr Kind noch immer die Taufe begehren, größer ist als alle Bedenken und das Bemühen um eine theologisch zu verantwortende Taufpraxis. Die Krise der Volkskirche ist auch eine Krise der Taufe. Die Hausgemeinde, für die Martin Luther einmal seinen Kleinen Katechismus geschrieben hat, besteht nicht mehr. Die Tradition ist abgebrochen.11 Es sind im Besonderen die Höhergebildeten, die aus dem Traditionsabbruch ihre Konsequenzen ziehen und – je höher der Bildungsstand desto mehr – die Kindertaufe ablehnen.12
Die Schuld an der Misere der Taufpraxis liegt zunächst bei den Pfarrerinnen und Pfarrern, die vielfach resigniert haben und der Gemeinde und den Eltern die theologische Problematik der Taufe nicht mehr zumuten, auch für sich selbst in hohem Maße verdrängen. 13 Mit dem sola gratia der Rechtfertigung, dass Gott uns in allem in seiner Gnade zuvorkommt, meint man, dem theologischen Nachdenken über die Taufe Genüge getan zu haben: Gerade dıe Kındertaufe entspreche der Rechtfertigung allein aus Gnaden. 14 Die Misere der Taufpraxis ist aber auch in Kırchenordnungen begründet, die die Unmündigentaufe tabuisieren.15
II. MUT ZU EINER KLAREN TAUFUNTERWEISUNG
Die Unmündigentaufe darf nicht länger apologetisch tabuisiert werden. Wir Pfarrer/innen dürfen der Gemeinde einige theologische Sachverhalte, Ungereimtheiten, Verlegenheiten und auch Aporien unserer Taufpraxis nicht länger vorenthalten.
„Weil auch Kinder der Gnade Gottes bedürfen und nach Christi Verheißung an ihr teilhaben sollen, bringen die Glieder unserer Kirche schon Kinder zur Taufe“16 – dieser theologische Spitzensatz der Taufordnung der Württembergischen Landeskirche soll wohl vom Gemeindepfarrer den Eltern im Taufgespräch ausgelegt und vermittelt werden. Aber was soll damit gesagt werden? Dass die Taufe von unmündigen Kindern heilsnotwendig ist, dass die Kinder nach CA IX erst mit der Taufe „Gott gefällig werden“,“17 dass mit Augustin alle nichtgetauften Kinder vor Gott auf ewig verloren sind? Wer aber wollte heute der Gemeinde sagen, dass die Kinder erst mit der Taufe von Gott angenommen und geliebt sind, dass Gott nicht ein jedes Kind vom Akt der Zeugung an liebt?18 Wenn aber die Unmündigentaufe nicht heilsnotwendig ist, dann können wir Gemeinde und Eltern in dieser Frage nicht länger im unklaren lassen in der Hoffnung, dass die Eltern auch weiterhin die Taufe für ihr Kind begehren, um ja nichts an ihrem Kind zu Versäumen, auch wenn sie für sich selber von der Kirche nichts erwarten.
Das Apostolikum im Taufgottesdienst wird nach der Taufordnung der Württembergischen Landeskirche eingeleitet mit der Wendung „… und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen“,19 und die Taufhandlung an einem unmündigen Kind wird so gedeutet: „Wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst den Getauften reinigen will von Sünde und Schuld. Er will alles widergöttliche Wesen in ]esu Tod versenken«.20 Diese Interpretamente sind entweder im Sinne der Erbsündenlehre Augustins zu verstehen oder aber magisch misszuverstehen, als habe das Böse fortan keine Macht mehr über das Kind. Hier bleibt so gut wie alles unklar und in der Schwebe – theologisches Herrschaftswissen, das zunächst die Ängste beschwört, das ungetaufte Kind stehe unter dem Bann und der Macht der Erbsünde und des Bösen, um dann von diesen Ängsten zu befreien. Eine Taufunterweisung, die sich an dieser Taufagende orientieren soll, muss vor ihrem Auftrag kapitulieren. Wir haben nicht die Taufe im Kontext der Erbsündenlehre Augustins und der Verlorenheit aller Nichtgetauften zu lehren, sondern Gottes unendliche Liebe zu bezeugen, die einem jeden Menschen gilt, dem Gott das Leben geschenkt hat, ob er nun getauft ist oder nicht.
III. DER BIBLISCHE BEFUND
Eine lutherische Kirche, die sich dem Schriftprinzip Martin Luthers verpflichtet weiß, wird in ihrer Taufunterweisung nicht umhinkommen, nach den biblischen Taufzeugnissen zu fragen. Der primäre Ort der Taufunterweisung der Gemeinde heute ist der Taufgottesdienst 21 Nach der Taufagende von Württemberg werden im Taufgottesdienst folgende Schriftzeugnisse angeführt und rezitiert: Mt 28,18-20; Mk 16,16; Mk 10,13-16; Joh 3,16. Diese vier Schriftbelege verfehlen die Situation der Unmündigentaufe und suggerieren wahrheitswidrig eine schriftgemäße Begründung der Unmündigentaufe. Der falsche Sitz im Leben, in dem diese Texte fortwährend zur Sprache kommen, erzeugt und zementiert ein falsches Verständnis dieser Texte in der Gemeinde. Die Taufe von Unmündigen ist das hermeneutische Prinzip des Missverstehens biblischer Tauftexte. Das gilt es im Einzelnen zu begründen.
Mt 28,18-20 ist der einzige Text des Zweiten Testaments, der die Taufe als ein Gebot des auferstandenen ]esus Christus überliefert. Mt 28,19 ist »als Bildung der frühen Christenheit anzusehen, die damit ihren Taufbrauch auf den Auferstandenen und seinen Befehl gründete«. 22 WILLI MARXSEN kann überspitzt, aber treffend formulieren, „dass es sich um eine geschichtliche Zufälligkeit handelte, wenn die Urgemeinde gerade diesen Brauch aufnahm“.23 Der irdische Jesus hat weder getauft noch die Taufe geboten. Die Reihenfolge der vier Imperative „gehet hin“, „machet zu Jüngern“, „tauft“, „lehrt halten alles“ kann nicht zweifelhaft sein. Der Taufe geht der Auftrag, zu Jüngern zu machen, voraus. Gemäß der Parallele Mt 24,14 ist damit die Verkündigung des Evangeliums an alle Völker gemeint. Die Verkündigung zielt auf Glauben. Dann erfolgt die Taufe, nach der Taufe die lebenslange Einübung, Aneignung und Verinnerlichung der Lehre ]esu, der Bergpredigt (im Kontext des Matthäusevangeliums!). Das Verb matheteuein begegnet nur viermal im Zweiten Testament.24 In Mt 28,19 kann der Sinn nur sein, dass die Völker durch die Verkündigung des Evangeliums zu Jüngern für die Basileia bzw. für Jesus gemacht werden. Das Zu-Jüngern-Gemachtwerden geschieht durch die Verkündigung, zielt auf den Glauben, wird mit der Taufe besiegelt und besteht in der lebenslangen Einübung der Lehre Jesu, der Lebensordnung der Basileia. Von Unmündigen kann dies nicht gesagt werden. Der Doppelpunkt in der Übersetzung Luthers „machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie …“ im Sinne von „indem ihr sie tauft“, lässt sich trotz der Partizipialkonstruktion nicht halten, weil diese Interpretation der Eigenbedeutung von matheteueín nicht gerecht wird.25
Das Wort aus dem unechten Markusschluss Mk 16,15f ist ein Missionsbefehl ohne Taufbefehl. Auch hier gehen die Mission als Verkündigung des Evangeliums und der Glaube der Taufe voraus. Nicht die Taufe, der Glaube ist heilsnotwendig. Indem aber im Kontext eines Taufgottesdienstes von unmündigen Kindern Mk 16,16b zitiert wird – „wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“ –, wird die nicht dem Text entsprechende Verbindung von Taufe und Rettung einerseits, Nichttaufe und Verdammnis andererseits im Bewusstsein der Gemeinde erst geschaffen.
Dass Jesus nach Mk 10,13-16 die Kinder nicht abweist, sie vielmehr segnet, ist keine Begründung und Legitimation der Unmündigentaufe. Das Kinderevangelium wird missbraucht, wenn es im Taufgottesdienst von unmündigen Kindern zur Sprache kommt. Wiederum schafft der falsche Sitz im Leben ein falsches Verständnis des Textes. Mk 10,13-16 ist von der Fragestellung der Kindertaufe freizuhalten.26 Das Problem der Kindertaufe ist „für diese frühe Zeit nicht zu erwarten“, „vielmehr wird die Kinderszene transparent für die ]ünger“.27 „Die bewusste Zuwendung zu den Kindern war vermutlich etwas für Jesus ganz besonders Charakteristisches; es gibt keine wirklichen religionsgeschichtlichen Analogien“.28 „Die Verwendung unseres Textes als biblischer Beleg für die Kindertaufe in der reformatorischen und nachreformatorischen Exegese ist ein klassischer Fall für eine ‚sekundäre Legitimation‘ einer längst und ohne biblischen Grund existierenden Institution durch einen biblischen Text.“29 ULRICH LUZ appelliert an die Ehrlichkeit der Amtsträger/innen und Kirchenleitungen: „Ich möchte hier als Exeget unsere Kirchen vor allem um größere und zwar öffentlich bekundete Ehrlichkeit gegenüber dem biblischen Text bitten. Dass Priester und Pfarrer/innen wider besseres exegetisches Wissen unseren Text bei Säuglingstaufen kommentarlos verwenden und so zur biblischen Zementierung einer vermutlich unbiblischen Kindertaufe fortlaufend beitragen und dass Kirchenleitungen dies sogar sehr oft von ihnen verlangen, ist Missbrauch der Bibel. Die biblischen Texte können sich dagegen nicht wehren, und es ist Aufgabe der Exeget/innen, dies stellvertretend für sie zu tun.“30 Dass Jesus den Kindern ohne jede Vorbedingung zugetan ist, befreit gerade von dem Zwang, ihnen als Unmündigen qua Taufe das Heil Jesu erst bzw. schon zueignen zu müssen, weil sie der Gnade bedürftig seien.
Die Summe des Evangeliums nach Joh 3,16 redet nicht von der Taufe, sondern allein vom Glauben. Dass dieser Satz im Taufgottesdienst von unmündigen Kindern zitiert wird, schafft noch einmal den nicht textgemäßen Zusammenhang von Unmündigentaufe und „nicht Verloren werden“. Dieser Zusammenhang ist wahrheitswidrig, aber wohl intendiert.
So geschieht in einer Kirche, die sich auf Martin Luther beruft und sich seinem Schriftprinzip verpflichtet weiß, im Taufgottesdienst von unmündigen Kindern Taufunterweisung, die den Schriftzeugnissen nicht gerecht wird. Befragen wir zunächst die anderen wichtigsten Taufzeugnisse des Zweiten Testaments. Für Paulus scheint die Taufe nicht heilsnotwendig zu sein. Sie ist nirgendwo in seinen Briefen ein selbständiges Thema. Wenn Paulus auf die Taufe zu sprechen kommt, so geschieht dies immer, um andere Sachverhalte zu verdeutlichen. Nach 1 Kor 1,12-17 kann Paulus Gott dafür danken, dass er in Korinth nur wenige Christen getauft hat. „Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden“.31 Freilich ist der Zusammenhang zu beachten: Paulus will sagen, dass er zu den Gruppierungen und Spaltungen in Korinth nicht beigetragen habe, weil er nur Wenige getauft hat, so dassrständnis, sie seien auf seinen Namen getauft worden, gar nicht aufkommen konnte. Wenn das Heil in Jesus Christus in der Taufe begründet wäre, könnte Paulus nicht derart gegensätzlich von der Taufe und der Verkündigung reden.
Auch 1 Kor 12,13 – „Denn durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie“ – ist die Einheit des Leibes Christi das Leitthema, das durch den Hinweis auf die Taufe argumentativ veranschaulicht wird. Der den Glauben wirkende Geist gliedert durch die Taufe in die Gemeinde ein und schafft den einen Leib Christi. Ebenso begründet Gal 3,2628 mit der Taufe das Einssein der Gemeinde, die Überwindung aller Gegensätze, die das außerkirchliche Leben bestimmen. Im Gegensatz zur Praxis der Taufe in der heutigen Volkskirche, die nicht ausgrenzen will und darum nahezu unterschiedslos jedem Taufbegehren stattgibt, grenzt die Taufe nach dem Verständnis des Paulus aus den bisher geltenden gesellschaftlichen Bezügen und Bedingungen aus und gliedert in den Lebensbereich Jesu Christi ein, in dem nun die Lebensordnung Jesu Christi gilt.32
Röm 6,3-11 ist der wohl wichtigste Text des Paulus zur Taufe. Er spielt in unserer volkskirchlichen Taufpraxis keine Rolle und wird verdrängt. Die Konnotationen „Untertauchen“ und „Tod“, „Auftauchen“ und „Leben für Gott in Jesus Christus“sind mit der Unmündigentaufe und der Benetzung der Stirn des Säuglings nicht zu vermitteln. Paulus spricht die Gemeindeglieder in Rom mit der Taufe auf ihren Überschritt von ihrem alten Leben unter der Macht der Sünde in das neue Leben unter der Herrschaft Jesu Christi an. Auf welchen Überschritt sollen Säuglinge angesprochen werden? Paulus begründet hier mit der Taufe die neue Ethik.33 Als Säuglinge Getaufte können gar nicht auf den mit ihrer Taufe begründeten neuen Lebenswandel angesprochen werden, weil die Taufe nie ihre bewusste Entscheidung war. Der für Paulus konstitutive Zusammenhang von Taufe und Ethik wird mit der Säuglingstaufe zerstört. Der so wichtige Tauftext Röm 6, in dem die Taufe ebenfalls kein selbständiges Thema ist, muss in der Taufunterweisung unterschlagen werden, da von einem neuen Lebenswandel der unmündig Getauften nicht die Rede sein kann.
Für Paulus kann „christliche Existenz als solche grundsätzlich nur mit pisteuein sachgerecht beschrieben werden“.34 Wenn Paulus auf die Taufe zu sprechen kommt, so geschieht dies immer rückblickend, erinnernd, nie aber in der Anrede an Taufbewerber, die ihre Taufe noch vor sich haben. Die »Korrelation zwischen Rechtfertigung und Glaube« ist für Paulus „charakteristisch“, „während umgekehrt die Verbindung von Glaube und Taufe eine konstitutive Bedeutung erhält“.35 Für Paulus ist „die iustificatio sola gratia grundsätzlich eine íustificatio sola fide“. 36 Die Taufe ist der Evangeliumsverkündigung und der Rechtfertigungsbotschaft eingeordnet und untergeordnet.37
Die Apostelgeschichte bezeugt die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen.38 Dreimal ist in der Apostelgeschichte und einmal bei Paulus von der Taufe eines ganzen Hauses die Rede. 39 Dahinter steht die griechisch-römische Vorstellung, dass der pater familias die Religion seiner Familie einschließlich der Sklaven und Sklavinnen bestimmt. Diese Vorstellung wird von Paulus und Lukas ohne nähere Reflexion übernommen. Die Taufe wird nur eben erwähnt. Es ist davon auszugehen, dass beim Übertritt einer Familie zum christlichen Glauben die Familie dann nicht in Getaufte und Nichtgetaufte auseinander gerissen wurde, und es kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass auch Kinder mitgetauft wurden. Doch ist im Kontext von Apg 16,33 und 18,8 ausdrücklich davon die Rede, dass das ganze Haus das Wort hörte und zum Glauben kam. Selbst wenn man annimmt, dass die Taufen ganzer Häuser auch unmündige Kinder einschlossen, lässt sich damit die Unmündigentaufe heute gerade nicht begründen. Denn zur Zeit des Zweiten Testaments wurden – wenn überhaupt – die Kinder zusammen mit ihren Eltern getauft, während heute die Kinder längst getaufter Eltern getauft werden. Nach 1 Kor 7,14 – „Sonst wären eure Kinder unrein, sie sind aber heilig“ – kennt Paulus die Taufe von Kindern christlicher Eltern nicht. Im äußersten Fall kann man sagen, dass die vor dem Übertritt der Eltern zum christlichen Glauben geborenen Kinder zusammen mit ihren Eltern getauft, die nach dem Übertritt der Eltern geborenen Kinder aber nicht getauft wurden.“40





























