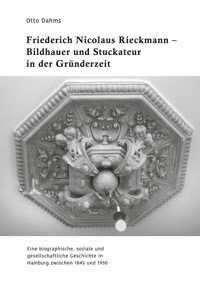
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Strafklasse des Hamburger Werk- und Armenhauses zu einem geachteten, erfolgreichen Handwerker und Immobilienbesitzer. Die Geschichte eines ungewöhnlichen Aufstiegs. Die Biografie des Friederich Nicolaus Rieckmann - ein spannendes Kapitel der Hamburger Sozialgeschichte. 1845 geboren, gelingt es Rieckmann trotz eines großen Bauunfalls in den Jugendjahren sich als Stuckateur in der Hansestadt zu etablieren. Mit Unterstützung Martin Hallers konnte er sich in Architektenkreisen bekannt machen und mit ihnen zusammenarbeiten. Das Buch schildert seinen Lebensweg, der von größten Hindernissen gezeichnet war, zu einem angesehenen Geschäftsmann und sorgenden Familienvater. Der Autor fördert bei seinen akribischen Recherchen vieles zutage, was uns in die Lebens- und Arbeitswelt der Gründerjahre zurückversetzt. Zahlreiche Abbildungen und Kartenausschnitte zeigen den Weg des auch künstlerisch erfolgreichen Handwerkers auf anschauliche Weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel
Kindheit und Jugend; die Verurteilung in die Strafklasse des Werk- und Armenhauses
Wer war Pastor Karl Köster?
Wo war die Strafklasse zu dieser Zeit eingerichtet?
2. Kapitel
Die Lehre des Friederich Nicolaus, der Unfall
3. Kapitel
Eine zweite Chance: der Bildhauer und Stuckateur, seine erste Frau und die ersten Häuser
3.1 Bei den Hütten
3.2 Die neustädter Neustraße
4. Kapitel
Der Aufbau des Geschäfts (mit Unterstützung von Haller und Reichardt)
5. Kapitel
Familie J. H. F. Thomsen: Elbpavillon, Orpheum, Lübbers Salon, Billwärder Park und der Butterbrotschneider
6. Kapitel
Der Witwer, Elisabeth, das Geheimnis der Fruchtallee 32 und die zweite Hochzeit
7. Kapitel
Ein neues Zuhause in der Königstraße
7.1 Die Anweisung der Bauhöhe für den Neubau
7.2 Das neue Zuhause in der Königstraße
8. Kapitel
Der umtriebige Geschäftsmann, seine zahlreichen Immobilien
8.1 Das Haus in der Maria-Louisen-Straße 27
8.2 Das Haus in der Maria-Louisen-Straße 29
8.3 Eine Geldanlage: Rosenhofstraße 10
8.4 Das Haus in der Hagenau 7
9. Kapitel
Das Familiengrab und das Ende der Bildhauerei
9.1 Überlegungen zu weiteren Denkmalen unbekannter Bildhauer auf dem Friedhof
10. Kapitel
Das Haus in der Klosterallee 11 und der frühe Tod; die Witwe, die Kinder und das Erbe
10.1 Die Zeit 1914–1918
10.2 Das Testament und der Nachlass
10.3 Die Vermögensverhältnisse nach dem Krieg
11. Kapitel
Wer war der Mensch Friederich Nicolaus Rieckmann?
12. Kapitel
Nachlese: seine Geschwister, seine Kinder, wichtige Personen. Und was wurde aus seinen Häusern?
Nachwort
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Register
„Mich hat er natürlich, so oft ich ihm mit seinem Stelzbein begegnete, stets an jenen Schreckenstag im Anfang meiner Praxis erinnert.“
Martin Haller 1915
Den Forschenden des Vereins für Hamburgische Geschichte gewidmet
Vorwort
Den Anstoß für dieses Buch gab das Familiengrab des Friederich Nicolaus Rieckmann in Hamburg-Ohlsdorf. Die Grabstelle umfasst das Denkmal eines Blumen streuenden Mädchens, die Marmorfigur wurde von Rieckmann selbst gefertigt. Das Familiengrab wurde im Jahre 2000 von den Nachkommen seiner zweiten Frau nicht weiter verlängert. So übernahm ich als Urenkel aus der Ehe mit seiner ersten Frau das Grab und ließ es instand setzen.
Schon immer waren in der Familie zahlreiche Geschichten über den Urgroßvater erzählt worden, etwa dass er mit Stuckarbeiten zu Reichtum gekommen sein und in der Innenstadt ein Haus besessen haben soll. Als Bildhauer habe er überdies, so die Legende, am Bau des Rathauses in Hamburg mitgewirkt und einen großen Engel auf dem Ohlsdorfer Friedhof gefertigt. Und schließlich das persönlich Gravierendste: Als junger Mann verlor er bei einem Hauseinsturz ein Bein, seit diesem Unfall war er zudem beidseitig schwerhörig.
Wer war dieser Mann? Ich wollte endlich Genaueres herausfinden. Die Spurensuche erwies sich als aufwendig, und immer wieder drohte ich in den vielen Materialien und Archiven verloren zu gehen. Wir sprechen von der Gründerzeit, gerade in diesen Jahren baute Friederich Nicolaus Rieckmann sein eigenes Handwerksgeschäft auf und es gelang ihm, sich zu einem gewissen Wohlstand emporzuarbeiten. Wie sah sein Aufstieg aus, wie lebte es sich damals, wie konnte es sein, dass der schwere Unfall den jungen Mann nicht völlig aus der Bahn warf? Rieckmann heiratete zweimal, er hatte sieben Kinder, er war als Stuckateur sehr erfolgreich, erwarb mehrere Immobilien und war doch wie alle anderen von den schweren Jahren des Ersten Weltkriegs, von Inflation und politischer Unsicherheit betroffen. Ein reiches Leben voller überraschender Details tat sich vor mir auf.
Meine Recherche über die Jahre 1845 bis etwa 1955 begann 2011 im Staatsarchiv Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie in der Bibliothek des Vereins für Hamburgische Geschichte. Die digitale Aufarbeitung der Hamburger Adressbücher im Internet war eine große Hilfe. Die Durchsicht der Zeitungen auf Mikrofilm wuchs sich zu einer nicht zu verachtenden Geduldsarbeit aus. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bibliotheken und der Archive bin ich zu großem Dank verpflichtet, ohne ihre großen und kleinen Hinweise wäre die Arbeit noch aufwendiger gewesen.
Als eigenes Thema stellte sich die Recherche zu Rieckmanns Immobilien heraus. Zur Namenskartei des Grundbuchamtes im Staatsarchiv blieb der Zugang leider verwehrt. Beim Amtsgericht Hamburg musste ein Antrag auf Einsicht in die Grundakten gestellt werden, da dort die Einzelheiten der Verträge einzusehen sind. Über das Geoportal Hamburg konnte auf die Katasterkarten des Landesbetriebs Geoinformation und Vermessung zugegriffen werden. Mit den Angaben zur Gemarkung und dem Flurstück konnten so die Nummern der heutigen Grundbuchblätter ermittelt werden. Auch hier sei den Mitarbeitern der Amtsgerichte auf den Grundbuchämtern und dem Nachlassgericht für die Geduld und Unterstützung gedankt.
Aufgrund meiner Recherchen konnte ich bald belegen, dass Martin Haller der ausführende Architekt des Gebäudeumbaus in der Esplanade war, wo Rieckmann so schwer verletzt wurde. Dies wies den Weg zu den vielen Quellen von Haller im Staatsarchiv Hamburg.
Dieses Buch ist der Versuch, die damaligen zeitlichen und sozialen Bedingungen mit möglichst vielen Quellen einzufangen. Jeder und jede möge sich eigene Gedanken machen, ob er oder sie in jener Glücksritterzeit das gemacht hätte, was man aus heutiger Sicht leicht als selbstverständlich ansieht. Vielleicht kann diese Zusammenstellung auch anderen Mut machen, Archive aufzusuchen und auf Quellensuche zu gehen. Geduld ist gefragt, doch Schlüsselerlebnisse bei Funden entschädigen für viele Stunden vergeblichen Suchens, Blätterns und Lesens. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass auch Archive nur das verwalten, was ihnen übergeben wurde.
1. Kapitel
Kindheit und Jugend; dieVerurteilung in die Strafklasse des Werk- und Armenhauses
Das Leben in den Vier- und Marschlanden war für Rieckmann vorgezeichnet durch seine Urgroßeltern, die 1756 in Ochsenwerder heirateten. Claus Rieckmann, 35 Jahre, stammte aus Tatenberg, seine Frau Anna Semmelhack, vier Jahre jünger, aus Ochsenwerder. Ihnen wurde im Jahre 1762 der Sohn Claus geboren, der 1787 die 21-jährige Anna Schuldt aus Tatenberg heiratete.
Der Wohnort wurde gewechselt, und in Moorfleth gebar Anna 1799 den Sohn Hans Herrman.1 Er wurde wie so viele Männer in dieser Gegend Fischer, in den Zeiten, wo es nichts zu fischen gab, war er zudem als Grünhöker tätig.2 Mit 34 Jahren heiratete Hans Herrman Rieckmann die dreißigjährige Anna Elsabe Riege aus Ochsenwerder, die Trauung fand in der Kirche St. Pankratii zu Ochsenwerder statt.3
Anna Elsabes Vater war Katenbesitzer mit etwas Land zur Selbstversorgung an der Nordseite von Ochsenwerder und dort auch geboren, ihre Mutter stammte aus dem Spadenland.
Alle Vorfahren lebten in einem überschaubaren Bereich in diesem Teil der Landherrschaft der Marschlande von Hamburg, zwischen der Elbe und der Bille.4
Hans Herrman und Anna Elsabe gründeten eine Familie, zu der schließlich insgesamt neun Kinder gehörten. Nicht alle überlebten allerdings die Kinder- und Jugendzeit.
Ein Jahr nach der Heirat erblickte das erste Kind der beiden 1834 das Licht der Welt, der Sohn wurde auf den Namen Hans Hermann Hinrich getauft.5 Zwei Jahre später kam Anna Elsabe mit Zwillingen nieder.6 Das eine Mädchen Anna Catharina Margaretha wurde lebend geboren, die Zwillingsschwester „verstarb ungefähr zweieinhalb Stunden nach der Geburt, ohne die Taufe erhalten zu haben“.7 Doch auch Anna Catharina war sehr schwach, sie erhielt vier Tage später die Taufe, überlebte diesen feierlichen Tag aber nur um eine Woche.8 Sie wurde auf dem Friedhof von St. Nicolai in Moorfleth bestattet.
Ein Jahr später, 1837, half die Hebamme Werner aus Ochsenwerder der Mutter, einen Knaben mit dem Namen Nicolaus Heinrich auf die Welt zu bringen.9 1839 wurde Anna Elsabe erneut schwanger. Sie gebar ein Mädchen, welches den Namen Johanna Catharina Maria erhielt.10 Nach zwei weiteren Jahren wurde der Sohn Johann Peter geboren, doch Johann Peter verstarb schon kurze Zeit später.11 Die Trauer über den Sohn war noch nicht vergangen, da musste im November 1842 auch Johanna, das fünfte Kind, zu Grabe getragen werden.12 1843 erblickte die Tochter Anna Catharina das Licht der Welt.13
Im Sommer 1845 schenkte Anna Elsabe dem Knaben Friederich Nicolaus, der Hauptperson dieser Schrift, das Leben. Über einen Monat später wurde der Junge, das achte Kind des Ehepaares, getauft; er bekam drei Paten, wie es auch bei den anderen Kindern erfolgt war.14
Für dasselbe Jahr halten die Geschichtsbücher ein besonderes wirtschaftliches Ereignis für Europa fest, ein folgenreiches: Mit der Great Britain wird das erste Dampfschiff in Betrieb genommen. Die industrielle Revolution nimmt ihren Lauf. Friederich Nicolaus wird später die Auswirkungen spüren und für sich nutzen.
Inzwischen war die Mutter Anna Elsabe 46 Jahre alt. Sie gebar 1849 eine weitere Tochter mit den Namen Anna Catharina Margaretha.15
Die Familie und vor allem der älteste Sohn Hans Hermann Hinrich mit seinen 15 Jahren hatten bis dahin schon viel Trauer zu tragen. Doch immerhin lebten seine letzten drei kleinen Geschwister. Der Vater war als Fischer auf der Elbe und der Bille unter wegs, oder er verkaufte als Grünhöker Gemüse, Kräuter und Obst aus den Marschlanden. Die Mutter hatte die Kinder unter ihrer Obhut. Ob alle Kinder schon frühzeitig zur Schule gingen, ist ungeklärt, fest steht nur, dass Hans Hermann Hinrich nicht schreiben konnte. Bei seiner Heirat unterschrieb er mit XXX.16 Genauso unterschrieb er als Vater im Zivilstandsregister, als er 1869 die Geburt und den Tod eines Mädchens17 und 1873 die Geburt und den Tod eines Knaben18 meldete.
Im Jahre 1855, im Oktober, starb Anna Elsabe mit 53 Jahren. Als Todesursache bescheinigte Dr. Bahlcke „feb. nervosa“, ein Nervenfieber, das heute als eine Salmonellenerkrankung bezeichnet wird.19 Aus dem Leichenregister von St. Nicolai in Moorfleth ist ersichtlich, dass neben dem Ehegatten noch zwei Söhne unter 22 Jahren und zwei Töchter unter 18 Jahren lebten. Fünf Kinder waren verstorben.
Der Verlust der Mutter, des Hauptpfeilers in der Familie, muss einschneidend gewesen sein. In erster Linie für die Kinder und ganz besonders auch für den Vater, dem nun die Stütze zur Erziehung der Kinder fehlte. Über seinen Lebenswandel zu Lebzeiten seiner Frau ist nichts bekannt, nach ihrem Tod bestand sein Halt offenbar zunehmend im Alkohol. Die Kinder konnten nicht ernährt werden, das Einkommen des Vaters reichte dafür nicht aus. Bald schon sah man die Kinder am Deich betteln, etwas, was die Einwohner von Moorfleth bis dahin nicht von ihnen gekannt hatten.
Wer war Pastor Karl Köster?
Das erfuhr natürlich auch der Pastor der Kirche St. Nicolai in Moorfleth, Karl Köster, obgleich er in der Stadt wohnte und dort zwei Adressen hatte: Alsterthor 18 und Schweinemarkt 23.20 Am Alsterthor lebte er in dem Haus seines Bruders Johann Heinrich (1803–1884), der in St. Thomas, den dänischen Antillen, als Kaufmann tätig war. Im Ersten Weltkrieg erwarben die USA 1917 von Dänemark die Inseln, die heute als Jungferninseln oder Virgin Islands bekannt sind. Johann Heinrich Köster gründete zusammen mit seiner Frau Caroline, die aus Curaçao stammte, die sozial orientierte Köster-Stiftung in Hamburg.
Karl Köster war Sohn der kirchlich geprägten Eheleute J. H. Köster und Henriette geb. Mirow.21 1807 in Hamburg geboren, wurde er Pastor, unterrichtete 1840 bis 1850 in Schulen, heiratete 1844 W. A. Wichern, die viel zu jung mit 38 Jahren verstarb und zwei Söhne im Alter von fünf und zwei Jahren hinterließ. Pastor Köster übernahm im Februar 1853 die Pfarrstelle in Moorfleth von Heinrich Sengelmann, der dort eine christliche Arbeitsschule für sozial benachteiligte Kinder gegründet hatte. Im Oktober 1853 heiratete er K. M. Wolff. Was sollte er tun, um den vier Kindern der Familie Rieckmann zu helfen? Köster hatte selbst früh seine Ehefrau verloren und musste sich vier Jahre allein um seine beiden kleinen Kinder kümmern. Mit dieser Erfahrung, die Parallelen zur Familie Rieckmann zeigten, schrieb er 1857 einen Brief an den Landherrn der Marschlande.
Hamburg hatte für die Landgebiete außerhalb der Stadt Senatoren als Landherren bestellt, die in ihren Bereichen als Gerichtsherren handelten. Sie wurden ehrfürchtig angesprochen.
„Hochweiser Herr!
Die Familie des hiesigen Einwohners Hans Hermann Rieckmann befindet sich hauptsächlich durch die Schuld des Familienvaters in einer so traurigen Lage, dass wir uns genötigt sehen, Eu[re]r Hochweisheit einen Bericht darüber abzustatten, und zur Beseitigung derselben Eur. Hochweisheit Unterstützung zu erbitten. Diese Familie besteht seit dem im vorigen Jahre erfolgten Tode der Hausmutter außer besagtem Hans Hermann Rieckmann selbst aus 4 Kindern. Von diesen dient der älteste Sohn Hermann dem Wirth bei der Handfähre als Knecht und hat hiedurch für sich selbst seinen Unterhalt.
Die anderen drei Kinder: eine vierzehnjährige letzte Ostern konfirmierte Tochter Margaretha [richtig: Catharina], ein bald zwölfjähriger Sohn Nicolaus und eine achtjährige Tochter Margaretha sind im Hause und sollten, da die vierzehnjährige Catharina die Besorgung des Hausstandes zu übernehmen vom Vater bestimmt ist, von diesem ernährt und versorgt werden. Dies aber wird von demselben in unverantwortlicher Weise unterlassen. Was er als Arbeitsmann mit seiner Hände Arbeit verdient und was an und für sich kaum hinreichen möchte, ihn und seine Kinder zu ernähren und erhalten, verausgabt er fast alles wieder für Branntwein und überläßt die Kinder, welche zuchtlos und bettelnd sich am Deich umhertreiben, ihrem eigenen Schicksal oder der Barmherzigkeit der Nachbarn.
Es ist uns unmöglich und möchte bei der, wie es scheint, unheilbaren Krankheit (Trunkfälligkeit) des Vaters überhaupt wohl unmöglich sein, letzteren zur Erfüllung seiner Vaterpf lichten zu bringen.
Darum legen wir Eur. Hochweisheit die Bitte vor, die Aufnahme jener beiden Kinder im Werk- und Armenhaus, wozu aus der Armenkasse der Gemeinde ein mäßiges Aufnahmegeld bezahlt werden könnte, gütigst uns wirken zu wollen.
Moorf leth, d. 22. Juni 1857
Eur. Hochweisheit
gehorsamst untertänig
K. M. L. Köster Pastor“ 22
Dr. Arning, der Landherr für die Marschlande, bestimmte kurz und knapp:
„Ich empfehle die beiden jüngeren Kinder Nicolaus und Margaretha Rieckmann zur gefälligen Aufnahme in das W. u. A. Haus gegen Erlegung der üblichen Beigabe.
Hbg. 23. Juni 1857 /:gez:/ Arning Dr.
Landherr“23
Das war die Weisung, die beiden Kinder in die Strafklasse des Werk- und Armenhauses aufzunehmen. Als Anlage zur Bittschrift waren die Taufscheine der beiden Kinder nachgereicht worden. In den Aufnahmeunterlagen für die Strafklasse des Werk- und Armenhauses heißt es sodann:
„Am 30. Juni 1857 aufgenommen, verurteilt am 23. Juni von Herrn Senator Dr. Arning, Landherr.“ Und weiter: „Veranlassung der Aufnahme lt. Polizeierkenntnis: Umhertreiben.“
Wenn Kinder leicht aus der Bahn geraten können, muss man sie umso fester bei der Hand nehmen, das war die Einstellung des Landherrn. Das Ende der Strafzeit wurde mit der Konfirmation der beiden Kinder festgesetzt.
Friederich Nicolaus war in der Strafklasse nicht mit Tisch und Bett ausgestattet. Hierfür wurde er dem Schlossermeister J. F. Warncke, Steinstraße Platz 20, Haus 3, in Obhut zugewiesen. (Abb. 1) Die Steinstraße war ein Teil des Gängeviertels in der Hamburger Altstadt. Hier hockten die Menschen dicht gedrängt aufeinander, die Hygiene war mangelhaft, und doch waren viele, zum Beispiel Hafenarbeiter, froh, überhaupt ein Bett zum Schlafen mieten zu können.
Auf der Katasterkarte kann man erkennen, was im Gängeviertel als Platz oder Hof bezeichnet wurde. Die Steinstraße 8 und 20 sind Beispiele für einen Platz, dort war ein großer, freier Raum vorhanden, sodass dort auch gewerkt werden konnte, eventuell sogar ein kleiner eingezäunter Garten angelegt werden durfte. Höfe sind beispielsweise Nr. 5, 13, 25. Dort ist jeweils nur ein schmaler Gang vorhanden, um zu den lang gestreckten Hinterhäusern zu gelangen.
Abb. 1: Verkleinerte Flurkarte 1:1000, von 1872. Steinstr. 20 Haus 3 und Breite Straße 7/9 Maurerherberge
Abb. 2: Hof in der Steinstraße, ähnlich dem Hof Steinstr. 20
Es ist überraschend zu sehen, wie auf diesem Platz auch vier abgezäunte Gärten liegen, die offensichtlich Kleinhandwerkern oder Mietern, beispielsweise dem Schlossermeister Warncke, zur Verfügung standen. Gegenüber seinem Wohnhaus Nr. 3 befand sich ebenfalls eine solche Fläche.
Friederich Nicolaus hatte also Glück, in einer recht offenen, lichtreichen Umgebung untergebracht zu sein und nicht in einem Haus der schmalen Gänge.
Wo war die Strafklasse zu dieser Zeit eingerichtet?
1841 hatte der Senat Neubauten für das Werk- und Armenhaus am Felsenhauerplatz zwischen dem Lübecker und Berliner Tor beschlossen. Kinder sollten dort nicht untergebracht werden, aber die Strafklasse sollte beibehalten werden. Der Hamburger Brand von 1842 zerstörte das alte Werk- und Armenhaus und verzögerte den Neubau.24
Am 28. September 1854 siedelte die Strafklasse in ein auf dem Terrain der Anstalt errichtetes Schulgebäude über. Dies befand sich am Käthnerkamp in Barmbek. Die Schule wurde von 54 Knaben und 26 Mädchen bezogen.25
Im Hamburger Adressbuch von 1857 wird das neue Werk- und Armenhaus beschrieben: „An das weibliche Arbeitshaus schließt sich das Schulgebäude des Werk- und Armenhauses, welches (…) außer den Wohnungen für die Lehrer, Räumlichkeiten zur Aufnahme von 120 Kindern enthält. Im September 1854 ist die Schule bezogen worden, u. ist dieselbe dazu bestimmt, Kinder, welche sich ein grobes Vergehen oder gar ein Verbrechen haben zuschulden kommen lassen, durch Unterricht u. strenge Aufsicht von dem Wege des Lasters zurückzuführen. Die Kinder bleiben bis zu ihrer Confirmation in dieser Anstalt u. werden dann die Knaben in die Lehre, die Mädchen in den Dienst gebracht.“ 26
Abb. 3: Werk- und Armenhus, Strafklasse an der Oberalten Allee
Abb. 4: Grundkarte 1: 5000 (vergr.) heute
Abb. 5: Karte 1: 4000 von Hamburg ca. 1851
Das bedeutete für den 12-jährigen Friederich, täglich von der Steinstraße zum Käthnerkamp zur Schule gehen zu müssen, ein Weg von gut einer halben Stunde. Dass er ein Fahrrad besaß, damals eher ein Luxus, ist unwahrscheinlich. (Abb.3)
Was er bei seinen Wegen zur Schule und vor allem auf dem Rückweg Interessantes am Wegesrand beobachten konnte, welchen Handwerkern er bei der Arbeit zusah, was er vielleicht selbst ausprobierte, wir wissen es nicht. Aufnahmebereit war er aber sicherlich, lernwillig und zukunftsfreudig, wie sein weiteres Leben zeigte. Mit welchen Methoden die Schüler der Strafklasse diszipliniert wurden, wie viele Stockhiebe sie aushalten mussten, wie Lehrer und Erzieher mit ihnen umgingen, dürfte wohl eher dem militärischen als einem sozialen Gedanken zuzuordnen gewesen sein. Ordnung und Struktur von Abläufen waren ganz sicher Ausbildungsinhalte. Über seinen Schulabschluss und sein Verhalten in der Schule lassen sich aus den Schulakten jedoch keine Angaben finden.
So endete eine gestrenge Jugend, in der viel Leid erlebt wurde, nach vier Jahren Strafklasse zu Ostern 1861 mit der „Confirmation“. Friederich Nicolaus wurde am 2. April entlassen und bei seinem Vormund J. F. Warncke, dem Schlossermeister in der Steinstraße, in die Lehre gebracht.
Die unternehmerischen Verflechtungen in dieser dicht gedrängten Wohn- und Arbeitsgegend fallen auf. Direkt neben dem Schlossermeister Warncke wohnte zum Beispiel der Bauunternehmer A. W. Reichardt jun. in der Steinstraße 19. Er wird uns 1862 wieder begegnen.
Anhand der beiden Abbildungen 4 und 5 kann die heutige Situation am Jacobi-Kirchhof mit dem Jahr 1851 verglichen werden. Der Durchbruch der Mönckebergstraße und die damit einhergehende Sanierung des Gängeviertels der Altstadt sowie die Verbreiterung der Steinstraße sind augenfällig.
Friederichs Schwester Anna Catharina Margaretha, die mit ihm seit 1857 in der Strafklasse saß, wurde 1864 konfirmiert, am 29. März entlassen und bei Schmiedecke, Polizeioffiziant in Ochsenwerder, in den Dienst gebracht.27
2. Kapitel
Die Lehre des Friederich Nicolaus, der Unfall
Kaum war die Konfirmation für den fünfzehnjährigen Jungen vorbei, wartete der Ernst des Lebens auf ihn. Der Schlossermeister Warncke blieb weiterhin für ihn zuständig, man wurde damals erst mit 22 Jahren volljährig. So war es naheliegend, dass Friederich Nicolaus eine Lehre als Schlosser absolvierte. Nach den ungeregelten Jugendtagen in Billwerder an der Elbe tat die Arbeit mit Stahl, Blech, Blei, Messing und vielen anderen Utensilien dem immer wachen Geist gut.
In der Werkstatt wurden Gitter, Maueranker, Ösen, Ketten, Rosenbögen und Fenstersicherungen hergestellt, der Lehrling musste die Produkte in einem hölzernen Handwagen mit vier eisenbereiften Speichenrädern ausliefern. Nur wenn die Bestellungen zu groß oder zu schwer waren, wurde eine „Schottsche Karre“ mit zwei großen Rädern auf einer Achse vom Meister und dem Lehrling benutzt; eher selten wurde ein Fuhrunternehmer beauftragt. Bei diesen Zustellungen lernte Friederich die Altstadt und die Neustadt gut kennen.
Neben den ganz praktischen Schlosserarbeiten wurden auch künstlerische Arbeiten für Fenstergitter und feine Treppengeländer mit Verzierungen hergestellt. So bekam Friederich einen Eindruck davon, was Menschen in ihrem Haus gern um sich hatten.
Eines Morgens waren von ihm Maueranker für einen Umbau von Einzelhäusern zu einem Etagenhaus anzuliefern. Am südlichen Ende der Esplanade, dieser prachtvoll ausgebauten Straße, die 1827 dem Verkehr übergeben worden war, erhielt das Schuhmacheramt „einen rund 200 qm großen Eckplatz (…) bei der nachmaligen Unterführung nach dem Alsterglacis. (…) Diese Fläche wurde alsdann nach den gleichen Vorschriften wie die übrigen an der Esplanade gelegenen Plätze bebaut.“ 28 Das Haus Nr. 47 gehörte nun dem Kohlenhändler Sally Elkan.
Martin Haller erinnerte sich später:





























