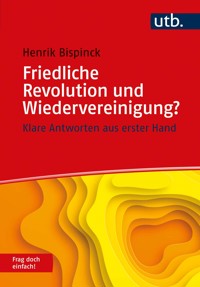
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Vor 30 Jahren brach die DDR innerhalb weniger Monate zusammen. Wie kam es zu dieser rasanten Entwicklung? Wie kam es zur deutschen Wiedervereinigung? Im November 1989 fiel die Berliner Mauer und die SED-Diktatur brach zusammen. Schon ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, wurde die Deutsche Einheit vollzogen. Henrik Bispinck zeigt in seinem Buch, wie es zu dieser Entwicklung kam. Er schildert die Etappen der friedlichen Revolution von der Massenflucht im Sommer 1989 über die Gründung von Oppositionsgruppen bis zu den Demonstrationen im Herbst. Die Ereignisse überschlugen sich und führten innerhalb von wenigen Monaten zur Einheit. Bispinck, der wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neueste und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin ist, beleuchtet auch die Folgen der Wiedervereinigung sowie den Prozess von Aufarbeitung und Erinnerung. In kurzen Porträts stellt er wichtige Persönlichkeiten (Erich Honecker, Günter Schabowski, Lothar de Maizière u. a.) der Einheit vor und klärt Begriffe wie Eiserner Vorhang, Bruderstaaten, Glasnost, Perestroika, Montagsdemonstrationen, Ostalgie. Mit diesem Buch zum 30. Jubiläum der Wiedervereinigung wird ein Stück deutscher Teilungs- und Einheitsgeschichte lebendig. Ein Must-have für Studierende der Politik- und Geschichtswissenschaften und alle, die sich für die Wende interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henrik Bispinck
Friedliche Revolution und Wiedervereinigung? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Hand
UVK Verlag · München
Dr. Henrik Bispinck ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Vermittlung und Forschung des Stasi-Unterlagen-Archivs im Bundesarchiv.
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue – iStock
Abbildungen im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur; Infografik: © bitmedia.dk; Abb. 1: © Danica Jovanov – iStock; Abb. 3: © aprott – iStock; Abb. 6: © ullstein bild – dpa; Abb. 7: © ullstein bild – dpa
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838554457
© UVK Verlag 2023— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5445
ISBN 978-3-8252-5445-2 (Print)
ISBN 978-3-8463-5445-2 (ePub)
Inhalt
Für Anne
Vorwort
Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die UkraineUkraine ein, der Überfall RusslandsRussland auf seinen südwestlichen Nachbarn begann. Drei Tage später gab Bundeskanzler Olaf ScholzScholz, Olaf auf einer Sondersitzung des BundestagsBundestag eine Regierungserklärung zum Krieg gegen die Ukraine ab. Er leitete diese mit den Worten ein: „Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.“ Was er damit meinte, konkretisierte er wenige Sätze später: „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ Der Begriff der „Zeitenwende“ wurde von Presse und Öffentlichkeit rasch – und überwiegend zustimmend – aufgenommen. Er hat es sogar in die Online-Enzyklopädie Wikipedia geschafft – wenn auch noch nicht als eigenständiges Lemma. Auch Historiker übernahmen den Begriff rasch – oder sprachen alternativ von einer „Zäsur“, die der 24. Februar für die europäische und globale Geschichte darstelle.
Doch was ist eine historische Zäsur eigentlich? Und lässt sich nicht erst mit größerem zeitlichen Abstand beurteilen, ob ein bestimmtes Ereignis oder auch eine Kette von rasch aufeinanderfolgenden Ereignissen eine Zäsur darstellt? Das letzte Ereignis, das bereits von Zeitgenossen vielfach als welthistorischer Einschnitt wahrgenommen wurde, waren die Terroranschläge vom 11. September 2001. Hier geronn – wie häufig – das Datum selbst in der englischen Form 9/11 zur Chiffre für die damit verbundene „Zeitenwende“. Damals wurde mit Blick auf die Bedeutung des Ereignisses der Satz „Nichts wird mehr sein, wie es war“ geprägt. Tatsächlich aber änderte sich – trotz Militäreinsatz in AfghanistanAfghanistan und IrakkriegIrak, trotz weiterer Terroranschläge und erhöhter Sicherheitsmaßnahmen, im Alltag der meisten Menschen wenig. Und je länger die Anschläge zurücklagen, desto stärker relativierte sich im Rückblick der historische Zäsurcharakter dieses Datums.
Auch den Fall der MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall am 9. November 1989, genauer: die Öffnung der Grenzübergänge im geteilten BerlinBerlin, nahmen bereits Zeitgenossen, die dieses Ereignis noch dazu live am Fernseher verfolgen konnten, als Ereignis von historischer Dimension wahr – für Deutschland sowieso, aber auch für Europa. Die GrenzöffnungGrenzöffnung (Österreich - Ungarn) ereignete sich im Kontext der friedlichen Revolution in der DDR, die die SED-Diktatur stürzte und binnen elf Monaten in die Vereinigung Deutschlands nach über 40 Jahren der Teilung mündete. In Verbindung mit den Revolutionen in den übrigen kommunistischen Staaten Ostmittel- und Osteuropas, dem Zerfall der SowjetunionSowjetunion und dem daraus resultierenden – aus heutiger Sicht möglicherweise nur scheinbaren – Ende des Ost-West-Konflikts stellen die Jahre 1989/91 eine globalhistorische Zäsur da. Diese Betrachtung manifestiert sich auch in der Rede vom „kurzen 20. Jahrhundert“, das von 1917 (Oktoberrevolution in RusslandRussland, Eintritt der USAUSA in den Ersten WeltkriegWeltkriegErster) bis zum Jahr 1989 bzw. 1991 reicht und auch als „Zeitalter der Extreme“, so der britische Historiker Eric HobsbawmHobsbawm, Eric, bezeichnet wird.
Der vorliegende Band befasst sich mit dem Ende dieses Zeitalters, mit der „Zeitenwende“ der Jahre 1989/90 – und zwar mit Blick auf Deutschland. Er beantwortet Fragen von der Vorgeschichte und den Ursachen der friedlichen Revolution über die Prozesse, die zum Sturz der SED-Diktatur und zur Wiedervereinigung Deutschlands führten, bis hin zu den – teils bis heute nachwirkenden – Folgen. Thematisiert werden strukturelle Entwicklungen ebenso wie das Handeln von Akteuren, Gruppen und Parteien, herausragende, medienwirksame Ereignisse genauso wie solche, die sich eher im Hintergrund abspielten. Der Schwerpunkt liegt naturgemäß auf den Entwicklungen in der DDR, doch auch die westdeutsche Sicht auf die Ereignisse und die Rolle der Bundesrepublik im Wiedervereinigungsprozess werden berücksichtigt. Ebenso Bestandteil des Buches sind Fragen zur Einbettung der friedlichen Revolution in die politischen Umwälzungen des übrigen OstblocksOstblockWarschauer Pakt sowie zu den internationalen Verhandlungen, die die Deutsche Einheit erst ermöglichten. Mag mancher Leser auch den ein oder anderen Aspekt vermissen, so hoffe ich doch, dass das Buch verständliche Antworten auf die wesentlichen Fragen zu seinem Thema liefert.
⁎ ⁎ ⁎
Auch Historiker stehen auf den Schultern von Riesen. Ein Buch wie das vorliegende, das zu komplexen historischen Vorgängen auf knappem Raum Fragen allgemeinverständlich beantworten will, kommt nicht ohne den Rückgriff auf Vorarbeiten aus. Historiker und Sozialwissenschaftler haben sich in den vergangenen dreißig Jahren in einer kaum noch überschaubaren Fülle von Detailstudien und Überblicksdarstellungen mit der Geschichte der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung Deutschlands befasst, zahlreiche Akteure der damaligen Zeit ihre Erinnerungen an die Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 niedergeschrieben. Ihnen allen gebührt Dank. Sämtliche direkt oder indirekt in diese Publikation eingegangenen Veröffentlichungen sind im Literaturverzeichnis am Ende des Buches aufgeführt, auf detaillierte Nachweise in Fußnoten wird in dieser Publikation verzichtet.
Zu danken habe ich weiterhin zunächst Nadja Hilbig, der Lektorin des UVK Verlages, die dieses Buch angeregt und seinen Entstehungsprozess mit Geduld, Engagement und Umsicht begleitet hat. Einen frühen Entwurf des Bandes konnte ich am Lehrstuhl für Neueste und Zeitgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin vorstellen und danke den Kolleginnen und Kollegen für wertvolle Anregungen. Prof. Dr. Hermann Wentker danke ich für wichtige Hinweise zur internationalen Dimension des Vereinigungsprozesses. Dr. Elke Kimmel hat das gesamte Manuskript einer kritischen Lektüre unterzogen, wovon es in inhaltlicher wie sprachlicher Hinsicht sehr profitiert hat – merci! Schließlich danke ich meinem Lebensgefährten Thomas Peter für stete Unterstützung und Zuspruch.
Berlin, März 2023 Henrik Bispinck
Hinweis | In diesem Buch wird jeweils ausschließlich das generische bzw. inhärent generische Maskulinum („Bürger“, „Mensch“), Femininum („Person“) und Neutrum („Mitglied“) verwendet. Diese Formen schließen Männer, Frauen und nichtbinäre Personen ein.
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni verrät dir spannende Literaturtipps, Videos und Blogs im World Wide Web.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an. Das ist eine der Fragen zum Thema, deren Antwort du unbedingt lesen solltest.
Die Lupe weist dich auf eine Expertenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
→
Eine Auswahl wichtiger Menschen der friedlichen Revolution und Wiedervereinigung wird im letzten Kapitel in kurzen Biographien vorgestellt. Die Pfeile zeigen an, über wen es mehr zu lesen gibt.
Zahlen und Fakten zur friedlichen Revolution und Wiedervereinigung
Geschichte der deutschen Teilung
Bevor es in diesem Buch um die friedliche Revolution und die deutsche Wiedervereinigung geht, wird in diesem Kapitel geklärt, wie es überhaupt zur Teilung Deutschlands kam. Darauf aufbauend werden die Unterschiede zwischen den beiden Staaten beleuchtet und die Gründe für den Mauerbau erläutert. Die Auswirkungen der Teilung auf die Deutschen in Ost und West werden ebenfalls thematisiert.
Warum war Deutschland geteilt?
Der Zweite WeltkriegWeltkriegZweiter endete im Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches. Die vier alliiertenAlliierteSiegermächte, alliierte SiegermächteSiegermächte, alliierte USAUSA, SowjetunionSowjetunion, GroßbritannienGroßbritannien und FrankreichFrankreich besetzten Deutschland vollständig. Die Territorien des Reiches östlich der Oder-Neiße-GrenzeOder-Neiße-Grenze kamen unter polnischePolen und sowjetische Verwaltung, die deutsche Bevölkerung dieser Gebiete wurde aus ihrer Heimat vertrieben. Der restliche Teil Deutschlands wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt: die sowjetische im Osten, die britische im Nordwesten, die französische im Südwesten und die US-amerikanische im Süden.
Karte des in vier Besatzungszonen aufgeteilten Deutschlands
Nach den Übereinkünften der Potsdamer KonferenzPotsdamer Konferenz vom 2. August 1945 übernahmen die Besatzungsmächte gemeinsam die oberste Regierungsgewalt für ganz Deutschland. Sie schufen dafür den Alliierten KontrollratAlliierter Kontrollrat als höchstes Entscheidungsgremium. Dessen Beschlüsse waren jedoch nicht bindend, und die Besatzungsmächte verfolgten in ihrer jeweiligen Zone eine eigenständige Politik. Schon bald zeichnete sich ab, dass die Vorstellungen der sowjetischen Besatzungsmacht sich von denen der westlichen Mächte grundsätzlich unterschieden. Im Westen gab es mehr Gemeinsamkeiten: GroßbritannienGroßbritannien und die USAUSA schlossen ihre Besatzungszonen zunächst am 1. Januar 1947 zur Bizone und im März 1948 gemeinsam mit der französischen zur Trizone zusammen.
Seit Mitte 1947 verstärkten sich die ideologischen und machtpolitischen Gegensätze zwischen den Machtblöcken in Ost und West. Sie überlagerten zunehmend die gemeinsame Verantwortung für Deutschland als ehemaligem KriegsgegnerWeltkriegZweiter. Mit dem Scheitern der LondonerLondon Außenministerkonferenz im Dezember 1947 und dem Auszug der sowjetischen Delegation aus dem Alliierten KontrollratAlliierter Kontrollrat im März 1948 wurde der Bruch offensichtlich: Der Kalte Krieg hatte begonnen – und seine Frontlinie zog sich mitten durch Deutschland.
Von nun an steuerte alles auf eine Zweistaatlichkeit zu. Mit der Durchführung einer separaten Währungsreform im Westen – die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) zog wenige Tage später nach – war Deutschland als Wirtschaftsgebiet geteilt. Parallel dazu wurden zwei unterschiedliche Verfassungen ausgearbeitet. Diese Entwicklung mündete im Jahr 1949 in die doppelte Staatsgründung: Am 24. Mai trat im Westen das GrundgesetzGrundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft, der 7. Oktober markierte mit der KonstituierungVerfassung der DDR der provisorischen VolkskammerVolkskammer (DDR) den Gründungstag der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).
Damit war die deutscheBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall Teilung besiegelt, die von den Menschen in Ost und West aber zunächst noch als vorübergehend betrachtet wurde. Die weitere Entwicklung in beiden deutschen Staaten, insbesondere ihre Einbindung in die militärischen Bündnisse NATONATO bzw. Warschauer PaktWarschauer Pakt im Jahr 1955, vertiefte die Spaltung jedoch. Spätestens mit dem Bau der BerlinerBerlin MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall im August 1961 wurde klar, dass die Teilung Deutschlands noch lange Bestand haben würde.
Literaturtipp | Einen guten Überblick über die deutsche Geschichte zwischen Kriegsende und doppelter Staatsgründung bieten folgende Bücher: Wolfgang Benz: Wie es zu Deutschlands Teilung kam. Vom Zusammenbruch zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1945–1949, München 2018, und Matthias Uhl: Die Teilung Deutschlands. Niederlage, Ost-West-Spaltung und Wiederaufbau 1945–1949, Berlin 2009.
Wie unterschieden sich die DDR und die Bundesrepublik voneinander?
Die beiden deutschen Staaten stellten analog zu den Machtblöcken, in die sie eingebettet waren, entgegengesetzte politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme dar.
Im Westen Deutschlands wurde ein föderaler Bundesstaat mit parlamentarischer Demokratie als Regierungsform errichtet. Das Grundgesetz definierte die Bundesrepublik als freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Es garantierte MenschenMenschenrechte- und BürgerrechteBürgerrechte, Meinungs- und PressefreiheitPressefreiheit. Im westdeutschen Teilstaat herrschte Gewaltenteilung, die Justiz war politisch unabhängig und das Wirtschaftssystem folgte dem Prinzip der sozialen MarktwirtschaftMarktwirtschaft, soziale.
Auf dem Gebiet der Sowjetischen BesatzungszoneWeltkriegZweiter entstand hingegen eine zentralistisch verfasste Diktatur, die von der aus der Zwangsvereinigung von KPDKommunistische Partei Deutschlands (KPD) und SPDSozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) hervorgegangenen Sozialistischen Einheitspartei (SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)) beherrscht wurde. Staatliche Institutionen und die Ministerien waren lediglich ausführende Organe der Beschlüsse der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Eine demokratische Mitbestimmung der Bevölkerung war durch die Organisation der Wahlen über Einheitslisten ausgeschlossen. Es gab weder Gewaltenteilung noch eine unabhängige Justiz, die Presse unterlag der Zensur und die Meinungsfreiheit war beschränkt. Die Wirtschaft war nach dem Prinzip der zentralen PlanwirtschaftPlanwirtschaft organisiert, private Unternehmen wurden nach und nach als Volkseigene Betriebe (VEBVolkseigene Betriebe (VEB)) quasi verstaatlicht.
Die Gegensätzlichkeit der politischen Systeme in Ost- und Westdeutschland blieb – ungeachtet der weiteren Entwicklung in beiden Staaten – während der Zeit der deutschen Teilung im Grundsatz bestehen. Die Bundesrepublik entwickelte sich zu einem wirtschaftlich prosperierenden, liberalen Gemeinwesen, das fest in der Wertegemeinschaft des Westens verankert war. Die DDR konnte in ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung zu keinem Zeitpunkt mit der Bundesrepublik mithalten. Sie bot als selbsternannter „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ aber das Versprechen sozialer Sicherheit und Gleichheit sowie Bildungs- und Aufstiegschancen für bisher unterprivilegierte Bevölkerungsschichten. Von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in West wie Ost indes wurde 40 Jahre lang die Bundesrepublik als das attraktivere System wahrgenommen.
Literaturtipp | Wie sich die beiden deutschen Staaten voneinander unterschieden, wie sie konkurrierten, wie sie aber auch miteinander verflochten waren und sich gegenseitig beeinflussten – das zeigen anhand anschaulicher Beispiele die Beiträge in folgendem Band: Udo Wengst/Hermann Wentker (Hg.): Das doppelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Berlin 2013.
Was machte den besonderen Status von Westberlin aus?
Nach dem Ende des Zweiten WeltkriegsWeltkriegZweiter teilten die vier SiegermächteSiegermächte, alliierte die bisherige Reichshauptstadt BerlinBerlin analog zu den Besatzungszonen in vier Sektoren auf. Der östliche Sektor der Stadt wurde von der SowjetunionSowjetunion kontrolliert, die drei westlichen Sektoren von den USAUSA, GroßbritannienGroßbritannien und FrankreichFrankreich. Zunächst wurde BerlinBerlin von einem gemeinsamen Magistrat regiert, der der Kontrolle durch eine Alliierte Kommandantur unterstand. Ebenso bestand ein Gesamtberliner Parlament, die Stadtverordnetenversammlung. Nach Konflikten zwischen der sowjetischen und den westlichen Besatzungsmächten kam es zur Spaltung der Stadt, im Ost- und Westteil etablierten sich getrennte Regierungen.
Sowohl die Verfassung der DDRVerfassung der DDR als auch das GrundgesetzGrundgesetz der Bundesrepublik betrachteten BerlinBerlin bzw. „Groß-Berlin“ als Ganzes als Bestandteil ihres Territoriums. De facto blieb die Stadt jedoch geteilt. Ostberlin wurde zum Regierungssitz des ostdeutschen Teilstaats und firmierte dort zunächst als „(Groß-)Berlin, demokratischer Sektor“ und seit den 1960er-Jahren als „Berlin, Hauptstadt der DDR“.
Der Status von Westberlin war komplizierter. Westberlin galt nicht als eigenständiges Bundesland und wies daher einige Besonderheiten auf. So entsandte die Teilstadt zwar wie die westdeutschen Länder Abgeordnete in den Deutschen BundestagBundestag, doch verfügten diese dort nicht über ein Stimmrecht. Umgekehrt besaßen die vom westdeutschen Parlament verabschiedeten Gesetze für Westberlin keine Gültigkeit. Sie enthielten daher eine „Berlin-Klausel“ und mussten vom Berliner Abgeordnetenhaus eigens in Kraft gesetzt werden. Die Einwohner Westberlins konnten aufgrund des besonderen Status der Teilstadt nicht zur Bundeswehr eingezogen werden, weshalb viele junge Männer aus Westdeutschland dorthin zogen, um sich dem Wehrdienst zu entziehen.
Um deutlich zu machen, dass der westliche Teil der ehemaligen Hauptstadt nicht zur Bundesrepublik gehörte, bezeichnete ihn die DDR offiziell als „selbständige politische Einheit Westberlin“ (ohne Bindestrich). In der Bundesrepublik firmierte er dagegen seit den 1960er-Jahren offiziell als „Berlin (West)“, geläufiger war die Schreibweise „West-Berlin“ (mit Bindestrich).*
Im Alltag von größerer Bedeutung war die Insellage Westberlins, das komplett vom Territorium der DDR umschlossen war. Es war dadurch wirtschaftlich von Subventionen aus Westdeutschland abhängig, die auch großzügig flossen. Denn während des Kalten Krieges galt Westberlin als „Vorposten der freien Welt“ und „Schaufenster des Westens“. In der bis August 1961 noch offenen Stadt konnten sich Ostberliner bei Theater- und Kinobesuchen oder einem Bummel über den Kurfürstendamm einen Eindruck von der Lebenswirklichkeit des Westens, von seiner kulturellen Vielfalt und vor allem von seinem Warenangebot verschaffen.
Zugleich diente Westberlin als letztes Schlupfloch für FlüchtlingeFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge, die in den 1950er-Jahren in großer Zahl aus der DDR in die Bundesrepublik kamen. Mit dem Bau der MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall am 13. August 1961 wurde der Fluchtbewegung ein Ende gesetzt. Die MauerBerlin trennte Nachbarn und Freunde, zerriss Familien und stellte 28 Jahre lang eine offene Wunde dar. Der Eiserne VorhangEiserner Vorhang teilte jetzt nicht mehr allein Deutschland, sondern auch die einstige Weltstadt. Aber er schuf auch klare Verhältnisse: Der Status der geteilten Stadt wurde in Ost wie West von nun an nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt.
Literatur- und Linktipp | Eine ebenso informative wie kurzweilige, mit vielen persönlichen Erzählungen angereicherte Geschichte des Westteils von Berlin bietet das Buch von Elke Kimmel: West-Berlin. Biografie einer Halbstadt, Berlin 2018. Das Buch ist auch vergünstigt über die Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich: www.bpb.de/shop.
Wie durchlässig war die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik?
Die GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche zwischen der Bundesrepublik und der DDR ging aus der Interzonengrenze hervor, die bis 1949 den Übergang von einer Besatzungszone in die andere markierte. Nach der doppelten Staatsgründung wurde sie von beiden deutschen Staaten bis 1956 offiziell als Demarkationslinie bezeichnet. Trotz Kontrollen an den Übergangsstellen war ein Passieren dieser Linie in den frühen 1950er-Jahren ebenso möglich wie üblich. Es gab zahlreiche sogenannte Grenzgänger, die auf der einen Seite der Grenze lebten und auf der anderen arbeiteten.
Im Mai 1952 riegelte die DDR die Grenze zur Bundesrepublik ab. Die Regierung ließ eine Fünf-Kilometer-Sperrzone einrichten, für deren Betreten ein Passierschein erforderlich war. Hinzu kamen ein 500 m breiter „Schutzstreifen“, der unter der unmittelbaren Kontrolle der Grenzpolizei stand, sowie ein 10 m breiter „Kontrollstreifen“, dessen Betreten für jedermann verboten war. Im Zuge der Grenzabriegelung wurden tausende als „unzuverlässig“ geltende Bewohner der Fünf-Kilometer-Zone zwangsweise ausgesiedelt und an Orte im Landesinneren der DDR verbracht. Die Grenzanlagen wurden in den folgenden Jahren weiter ausgebaut und eine gefahrlose Überschreitung der innerdeutschen Grenze war nicht mehr möglich.
Die Grenze in BerlinBerlin blieb demgegenüber offen – und nicht wenige DDR-Bürger nutzten sie, um in den Westen zu gelangen. Innerhalb Berlins gab es viele Menschen, die zwischen den beiden Teilen der Stadt hin- und herpendelten. DDR-Bürger konnten auch offiziell besuchsweise in die Bundesrepublik reisen, doch wurde die Genehmigung entsprechender Anträge zunehmend restriktiv gehandhabt. Die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) wollte die Bürger ihres Staates nicht „westlichen Einflüssen“ aussetzen. Auch kehrten einige DDR-Bürger von ihrem als Besuch beantragten Aufenthalt in der Bundesrepublik nicht zurück. Weniger problematisch war es für Bundesbürger, in die DDR einzureisen; von westdeutscher Seite gab es keine Beschränkungen.
Die Möglichkeit, die DDR über die offene innerdeutsche bzw. Berliner GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche dauerhaft in Richtung Westen zu verlassen, nutzten in den 1950er-Jahren über drei Millionen Menschen. Für die DDR bedeutete der Weggang von überwiegend jungen und gut ausgebildeten Personen einen enormen wirtschaftlichen Aderlass. Umgekehrt stellten die „RepublikflüchtlingeFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge“ für die Bundesrepublik einen Zugewinn an Arbeitskräften dar, die in Zeiten des „Wirtschaftswunders“ dringend benötigt wurden. Zugleich wurde die FluchtbewegungFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge im Zeichen der deutsch-deutschen Systemkonkurrenz auch als „Abstimmung mit den Füßen“ zugunsten des Westens wahrgenommen.
Die Abriegelung der Grenze in Berlin am 13. August 1961 kam über Nacht und für die Menschen in Ost wie West völlig überraschend. Nach und nach wurden noch vorhandene Schlupflöcher in der MauerBerlin gestopft. Parallel dazu wurde auch die innerdeutsche GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche weiter ausgebaut. Beide Bevölkerungen waren von nun an fast vollständig voneinander getrennt und Fluchtversuche von Ost nach West mit einer Gefahr für Leib und Leben verbunden. Besuchsreisen oder ÜbersiedlungenÜbersiedlerAusreise in die Bundesrepublik wurden nur noch in seltenen Ausnahmefällen und überwiegend Rentnern genehmigt. Zugleich war der Zugang zu westlichen Konsumgütern, kulturellen Angeboten und Presseerzeugnissen für DDR-Bürger gänzlich unterbunden. Lediglich über Radio und Fernsehen hatte ein Großteil der DDR-Bevölkerung noch die Möglichkeit, sich über den Westen zu informieren. Brief- und Paketverkehr blieben ebenfalls erhalten, allerdings konnte die Post durch das Ministerium für StaatssicherheitMinisterium für Staatssicherheit der DDR kontrolliert werden.
Im Zuge der EntspannungspolitikEntspannungspolitik lockerte die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) seit den 1970er-Jahren die Restriktionen – allerdings in sehr begrenztem Maße. Übersiedlungen von Ost nach West, etwa zum Zwecke der Familienzusammenführung, wurden häufiger genehmigt, gleiches galt für Besuchsreisen in die Bundesrepublik aus familiären Anlässen. Insgesamt knapp 200.000 Menschen siedelten bis Sommer 1989 mit Hilfe eines AusreiseantragsAusreise in die Bundesrepublik über. Für die allermeisten DDR-Bürger blieb die innerdeutsche GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche jedoch bis ins Jahr 1989 eine nahezu unüberwindbare Barriere.
Warum flüchteten Menschen aus der DDR?
Die Gründe für den Entschluss, der DDR dauerhaft den Rücken zu kehren, waren vielfältig. Sie reichten von direkter politischer Verfolgung über wirtschaftliche Gründe bis hin zu privaten Motiven, wobei dazwischen häufig nicht scharf zu trennen ist. In vielen Fällen hatte sich eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Situation in der DDR über Jahre hinweg angestaut, und es bedurfte nur eines kleinen Anlasses, um die Flucht auszulösen. Manche Fluchtursachen betrafen nur bestimmte Berufe oder gesellschaftliche Gruppen, andere hingen von der jeweiligen politischen Lage in der DDR ab.
In den 1950er-Jahren flüchteten zahlreiche Politiker, die mit dem absoluten Herrschaftsanspruch der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) in Konflikt geraten waren. Sie verließen die DDR zum Teil aus Enttäuschung darüber, dass sie ihre Vorstellungen nicht verwirklichen konnten, zum Teil aus Furcht vor Inhaftierung. Auch außerhalb des engeren Politikbereichs sahen sich viele Menschen in Beruf und Alltag politischem Druck ausgesetzt oder gerieten mit der Staats- und Parteibürokratie in Konflikt. Dies betraf etwa Lehrer, die die neuen, von der marxistisch-leninistischenMarxismus-Leninismus Ideologie geprägten Unterrichtsinhalte nicht vermitteln wollten. Ähnliches galt für christlich orientierte Schüler, die sich in der Jungen GemeindeJunge Gemeinde engagierten oder die Konfirmation der JugendweiheJugendweihe vorzogen. Sie sahen sich nicht selten vor die Wahl gestellt, ihre schulische Karriere aufzugeben oder die DDR zu verlassen. Den auch mit Gewalt durchgesetzten Umgestaltungswillen der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) bekamen in den 1950er Jahren insbesondere Landwirte zu spüren. Selbständige Bauern standen unter dem Druck der Kampagnen zur KollektivierungKollektivierung. Viele gaben ihren Hof lieber ganz auf und flüchteten in den Westen, als ihn in eine Produktionsgenossenschaft einzubringen.
Die politischen Ursachen für die FluchtbewegungFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge lassen sich gut an der zahlenmäßigen Entwicklung ablesen. In Zeiten starker Repression wie in den Monaten vor dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953Volksaufstand vom 17. Juni 1953 waren die FlüchtlingszahlenFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge besonders hoch. Gleiches galt für Phasen außenpolitischer Unsicherheit wie während der zweiten Berlin-KriseBerlin-Krise 1958/61.
Wirtschaftliche Motive spielten für die Fluchtbewegung ebenfalls eine wichtige Rolle. Die ökonomische Entwicklung der DDR hinkte der westdeutschen von Anfang an hinterher. Die Unzulänglichkeiten der PlanwirtschaftPlanwirtschaft führten immer wieder zu Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln und Konsumgütern. Für zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs mussten die Menschen anstehen, auf hochwertige Konsumprodukte gar jahrelang warten. Ersatzteile für Fahrzeuge und technische Geräte waren oft nur unter großen Schwierigkeiten oder mit Hilfe von „Beziehungen“ zu bekommen. Innerhalb des kommunistischen Ostblocks war der Lebensstandard in der DDR zwar am höchsten. Den Bürgern diente als Vergleichsmaßstab aber nicht das sozialistische Ausland, sondern die Bundesrepublik. Besuchsreisen, Westpakete und das westdeutsche Fernsehen führten ihnen das Konsumgefälle zwischen Ost und West immer wieder vor Augen und sorgten für Unzufriedenheit.
Zu den wirtschaftlichen und politischen Gründen traten private Motive. Viele litten unter der Trennung ihrer Familien durch die GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche. Dass gegenseitige Besuchsreisen im Laufe der Jahre erschwert wurden und nach dem MauerbauBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall zeitweise völlig unmöglich waren, machte die Teilung auf der privaten Ebene zunehmend unerträglich. Hier zeigt sich, wie die zunehmende Abschottung der DDR-Bevölkerung nicht selten erst den Grund dafür schuf, die Heimat verlassen zu wollen. Ähnliches galt für den Wunsch nach ReisefreiheitReisefreiheit über die Grenzen der beiden deutschen Staaten hinaus. Doch gab es auch Motive, die nichts mit den politischen Verhältnissen in der DDR zu tun hatten: Hierzu zählten neu eingegangene Ehen und Liebesbeziehungen oder deren Scheitern, die FluchtFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge vor Vaterschaftspflichten oder Familienstreitigkeiten.
Bei allen unterschiedlichen individuellen Motiven und ungeachtet des Auf und Ab der FlüchtlingszahlenFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge sind jedoch die beiden strukturellen Ursachen für die MassenfluchtFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge zu betonen, die die gesamte Bevölkerung der DDR betrafen und sich kontinuierlich durch die Geschichte der Teilung zogen: Zum einen die undemokratischen Verhältnisse und die mangelnde persönliche Freiheit in der DDR, zum anderen die wirtschaftliche Überlegenheit der Bundesrepublik. Solange die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ihren Herrschaftsanspruch nicht aufgab und ihre Politik nicht substanziell änderte, blieben diese Ursachen bestehen.
Flucht und Übersiedlung 1949–1990 (eigene Darstellung), Antragsteller im Bundesnotaufnahmeverfahren, Quelle: Bettina Effner/Helge Heidemeyer (Hg.): Flucht im geteilten Deutschland, Berlin 2005, S. 28
Literatur- und Linktipp | Im ehemaligen Notaufnahmelager für DDR-Flüchtlinge und Übersiedler in Berlin-TempelhofBerlinTempelhof befindet sich die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde. Die Dauerausstellung informiert über die Motive der Flüchtlinge, die Fluchtwege sowie über die Integration der ehemaligen DDR-Bürger in der Bundesrepublik. Nähere Informationen zur Ausstellung und zum Thema insgesamt finden sich auf der Homepage der Erinnerungsstätte: www.notaufnahmelager-berlin.de. Vertiefende Einsichten bietet das Begleitbuch zur Ausstellung: Bettina Effner/Helge Heidemeyer (Hg.): Flucht im geteilten Deutschland, Berlin 2005.
Warum wurde im August 1961 in Berlin eine MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall gebaut?
Die offene GrenzeGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche in BerlinBerlin war die Achillesferse der DDR. Sie bot Ostberlinern und auch zahlreichen DDR-Bürgern die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom westlichen Lebensstil zu machen und sich mit Konsumgütern und Presseerzeugnissen des „Klassenfeindes“ zu versorgen. Vor allem aber stellte die offene Sektorengrenze das letzte Schlupfloch für Fluchtwillige dar. Seit 1953 gelangten jährlich weit über 100.000 DDR-Bürger über Westberlin in die Bundesrepublik. Diesen enormen Aderlass wollte die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) stoppen.
Die sowjetische Führung hatte wiederholt versucht, den Status von Westberlin als De-facto-Exklave der Bundesrepublik auf dem Gebiet der DDR zu beenden. Ende 1958 unternahm der Generalsekretär der KPdSU, Nikita ChruschtschowChruschtschow, Nikita, einen erneuten Vorstoß. Er forderte ultimativ, Westberlin in eine „Freie Stadt“ umzuwandeln und die Truppen der Westalliierten abzuziehen. Zugleich sollte die Bundesrepublik die DDR als eigenständigen Staat anerkennen. Chruschtschow drohte damit, andernfalls einen Separatfrieden mit der DDR zu schließen und dieser die Kontrolle über die Transitwege zwischen Westdeutschland und Westberlin zu übertragen. Die Westmächte lehnten dies ab und bekräftigten die Zugehörigkeit Westberlins zum Schutzgebiet der NATONATO. Weitere Verhandlungen in den Folgejahren blieben ergebnislos, auch ein Treffen zwischen Chruschtschow und dem neu gewählten US-Präsidenten John F. KennedyKennedy, John F. am 3./4. Juni 1961.
Parallel zu diesen internationalen Auseinandersetzungen stiegen die Fluchtzahlen aus der DDR wieder an: Von 144.000 im Jahr 1959 auf 203.000 im Jahr 1960. Die Abwanderung verschärfte die wirtschaftliche Krise im ostdeutschen Teilstaat. SED-Chef Walter UlbrichtUlbricht, Walter hatte MoskauMoskau schon wiederholt dazu gedrängt, einer Abriegelung der Grenze innerhalb BerlinsBerlin zuzustimmen, um die FluchtbewegungFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge zu stoppen. Lange hatten sich die Sowjets in dieser Frage stur gestellt. Vor dem Hintergrund des Misserfolgs seines Berlin-Ultimatums und der sich zuspitzenden ökonomischen Krise der DDR gab Chruschtschow dem Drängen Ulbrichts schließlich nach. Die Entscheidung zum Mauerbau fiel vermutlich in der ersten Julihälfte 1961, offiziell beschlossen wurde er auf einer Konferenz der Warschauer-PaktWarschauer Pakt-Staaten Anfang August. Die von John F. Kennedy am 25. Juli formulierten „three essentials“ (Anwesenheit der WestalliiertenWestalliierte/Westmächte, freier Zugang nach sowie Sicherung der Freiheit und Lebensfähigkeit von Westberlin) standen dem nicht im Wege, sie bezogen sich nur auf den Westteil der Stadt.
Noch am 15. Juni 1961 hatte Ulbricht auf einer internationalen Pressekonferenz verkündet: „Niemand hat die Absicht, eine MauerGrenze/Grenzanlageninnerdeutsche zu errichten.“ Schon wenige Wochen später begannen dessen ungeachtet unter strengster Geheimhaltung die Vorbereitungen zum MauerbauBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall. Nur wenige Personen waren eingeweiht, selbst der engste Führungszirkel von Partei und Regierung wurde erst am Vorabend der Grenzabriegelung informiert, die in der Nacht vom 12. auf den 13. August begann. Angehörige der Nationalen Volksarmee,Nationale Volksarmee der Grenzpolizei, der Volkspolizei und der Betriebskampfgruppen errichteten Zäune, zogen Stacheldraht, sperrten die Zugänge zur U-Bahn ab und mauerten die Eingänge von Häusern zu, die auf der Sektorengrenze standen.
Zitat | „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, Walter UlbrichtUlbricht, Walter, 15. Juni 1961
Diese Aussage, eines der berühmtesten Zitate der Weltgeschichte, fiel auf einer internationalen Pressekonferenz. Mit Blick auf den Vorschlag der SowjetunionSowjetunion, dass Westberlin den Status einer „Freien Stadt“ erhalten solle, fragte die Westberliner Korrespondentin der Frankfurter Rundschau, Annemarie DoherrDoherr, Annemarie, den Staatsratsvorsitzenden der DDR: „Bedeutet die Bildung einer Freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger TorBrandenburger Tor errichtet wird?“ Ulbricht antwortete: „Ich verstehe Ihre Frage so, dass es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht. […] Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ Obwohl der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)-Chef damit die Frage eigentlich verneinte, stand – ob beabsichtigt oder nicht – plötzlich das Wort „Mauer“ im Raum. Die Brisanz der Aussage wurde erst zwei Monate später, nach dem 13. August, deutlich. Bis heute stehen diese Worte sinnbildlich für die Heuchelei des SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)-Regimes in Bezug auf den Mauerbau.
Der MauerbauBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall schockierte die Bevölkerung in beiden Teilen der Stadt. Die MauerBerlin trennte Nachbarn und Freunde, zerriss Familien und schnitt Berufstätige von ihrem Arbeitsplatz ab. Während der Regierende Bürgermeister von Berlin Willy BrandtBrandt, Willy scharf protestierte, reagierte Bundeskanzler Konrad AdenauerAdenauer, Konrad verhaltener. Er rief zu Ruhe und Besonnenheit auf und stattete der eingemauerten Stadt erst neun Tage später einen Besuch ab. Die WestalliiertenWestalliierte/Westmächte sandten – der Form halber – Protestnoten nach MoskauMoskau, akzeptierten den Mauerbau aber im Grunde als Manifestierung des Status quo.
Die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)-Führung rechtfertigte die MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall 28 Jahre lang als „antifaschistischen Schutzwall“. Ihr eigentlicher Zweck, nämlich die FluchtbewegungFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge aus der DDR zu stoppen, wurde mit dieser Bezeichnung verschleiert.
Berliner Mauer am Brandenburger Tor 1980
Linktipp | Über die Geschichte der Berliner Mauer, über geglückte und gescheiterte Fluchten, die Todesopfer an der Mauer sowie viele weitere Aspekte informiert anhand zahlreicher Dokumente in Text, Bild, Ton und Film die Website Chronik der Mauer. Sie bietet zudem eine Fülle von Materialien für Schulunterricht und Studium: www.chronik-der-mauer.de.
Wie veränderte sich das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten nach dem Mauerbau?
Der Bau der Berliner MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall am 13. August 1961 vertiefte die deutsche Spaltung. Die Mauer unterband nicht nur die FluchtbewegungFlucht (aus der DDR)/Fluchtbewegung/Flüchtlinge von DDR-Bürgern weitgehend, sondern auch Kontakte zwischen Ost- und Westberlinern und damit einen wichtigen Kommunikationskanal im geteilten Land. Die Gesellschaften in Ost und West entwickelten sich zunehmend getrennt voneinander, entfremdeten sich. Sowohl in der deutschen Bevölkerung als auch international wurde die Teilung in wachsendem Maße als dauerhaft betrachtet und akzeptiert.
Die Einsicht, dass Deutschland auf absehbare Zeit geteilt bleiben würde, führte allmählich zu einer Neuorientierung der BonnerBonn Politik gegenüber der DDR. Der Regierende Bürgermeister von BerlinBerlin, SPD-Vorsitzende und spätere Außenminister und Bundeskanzler Willy BrandtBrandt, Willy entwickelte gemeinsam mit seinem Sprecher Egon BahrBahr, Egon in den 1960er-Jahren das Konzept des „Wandels durch Annäherung“. Angesichts des Status quo sollten Erleichterungen für die Menschen in der DDR und eine Verbesserung der Kontaktmöglichkeiten zwischen Ost und West im Vordergrund der Deutschlandpolitik stehen. Mit der Übernahme der Kanzlerschaft in einer sozialliberalen Koalition im Jahr 1969 begann BrandtBrandt, Willy dieses Konzept umzusetzen.
In einer Reihe von internationalen und bilateralen Verträgen wurde der Status quo im Hinblick auf die deutsche Teilung festgeschrieben und ein gegenseitiger Verzicht auf die Anwendung von Gewalt vereinbart. Es gab Erleichterungen im Transitverkehr zwischen Westberlin und der Bundesrepublik, BonnBonn und Ostberlin tauschten „ständige Vertreter“ aus und beide deutsche Staaten wurden in die Vereinten Nationen aufgenommen. Eine völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik war damit jedoch nicht verbunden. Die Bundesregierung hielt am Wiedervereinigungspostulat des GrundgesetzesGrundgesetz fest.
Der Prozess erhöhte das internationale Ansehen der DDR, verpflichtete sie aber zugleich zu Zugeständnissen. Mit der Aufnahme in die UNOVereinte Nationen/United Nations Organization (UNO) im Jahr 1973 war für sie die Anerkennung der UN-Charta und der allgemeinen MenschenrechteMenschenrechte verbunden. Diese schlossen das Recht auf Freizügigkeit ein. Und mit der Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZEKonferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)) bekannte sich die DDR zu Erleichterungen bei Besuchsreisen und Familienzusammenführungen.
In der Folge stellten ab Mitte der 1970er-Jahre mehr und mehr Menschen einen Antrag auf AusreiseAusreise aus der DDR. Obwohl diese Anträge von den DDR-Behörden routinemäßig als „illegal“ abgewiesen wurden, konnte die SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)-Führung sich diesen Forderungen nicht gänzlich entziehen. Im Laufe der Jahre wurde eine wachsende Zahl dieser Anträge genehmigt: Im Jahr 1977 gelangten 3.500 DDR-Bürger auf diesem Wege in die Bundesrepublik, sieben Jahre später waren es etwa zehnmal so viele. Bis zum Ende der DDR sank die jährliche Anzahl nur noch einmal unter 10.000. Der Eiserne VorhangEiserner Vorhang war löchrig geworden.
Bei der Integration der ÜbersiedlerÜbersiedlerAusreise in der Bundesrepublik zeigten sich indes die Folgen der langen Separierung der beiden deutschen Staaten. Während eine Arbeit und eine Wohnung zumeist recht schnell gefunden waren, fühlten sich viele der ostdeutschen Neuankömmlinge fremd in der neuen Heimat. Sie hatten Schwierigkeiten, sich sozial und mental an die Gegebenheiten in Westdeutschland anzupassen. Die Probleme, nach 1990 die „innere Einheit“ Deutschlands herzustellen, warfen hier ihre Schatten voraus – zu einem Zeitpunkt, als die Wiedervereinigung in weite Ferne gerückt schien.
Filmtipp | Über die allmähliche Annäherung der beiden deutschen Staaten nach dem Mauerbau und die Gemeinsamkeiten der Deutschen in Ost und West erzählt auf subtile Weise die erste Folge Taxi nach Leipzig der ARD-Krimi-Reihe Tatort aus dem Jahr 1970. Der Fernsehfilm ist als DVD sowie auf einschlägigen Streaming-Plattformen erhältlich. Siehe dazu auch den Podcast Innerdeutsche Beziehungen. Der Tatort Taxi nach Leipzig auf tatort-deutsche-teilung.de sowie den Online-Beitrag Im Zeichen der Entspannungspolitik. Der erste Tatort und die deutsche Teilung auf www.visual-history.de.
Vorgeschichte der friedlichen Revolution
Viele Bürgerinnen und Bürger waren mit den Verhältnissen in der DDR unzufrieden. Während die einen nach Veränderungen im Innern strebten, wollten andere die DDR Richtung Westen verlassen. Gleichzeitig gab es auch in den östlichen Nachbarländern der DDR spannende Entwicklungen, die einen Einfluss auf die friedliche Revolution hatten: In Polen und Ungarn kam es zu demokratischen Reformen und der Eiserne Vorhang wurde löchrig.
Warum war die Bevölkerung der DDR unzufrieden?
Zu Unzufriedenheit hatte es in der DDR zu allen Zeiten vielerlei Anlass gegeben. Hierzu zählten das Fehlen persönlicher Freiheit und demokratischer Teilhabe, aber auch die schwierige wirtschaftliche Situation und die damit verbundene schlechte Versorgungslage. Einige Entwicklungen hatten sich jedoch in den 1980er-Jahren zugespitzt und einzelne Menschen ebenso wie Gruppen begannen, gegen die Machthaber aufzubegehren.
Bei seinem Machtantritt im Jahr 1971 hatte Erich HoneckerHonecker, Erich einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik eingeleitet. Langfristige Investitionen wurden zugunsten einer stärker an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Produktion von Konsumgütern zurückgestellt. Mit dem Versprechen auf baldigen Wohlstandszuwachs und soziale Verbesserungen sollte die Loyalität der Bevölkerung gesichert werden. Auf dem IX. Parteitag der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) im Mai 1976 wurde dieser Kurs in die Formel „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ gegossen. Diese Politik führte zwar tatsächlich zu einer spürbaren Verbesserung des Lebensstandards, ging aber zulasten der ökonomischen Substanz und wurde durch eine höhere Auslandsverschuldung erkauft.
Die negativen Folgen wurden in den 1980er-Jahren sichtbar: Betriebe und Infrastruktur waren marode, was sich negativ auf die Produktionsabläufe auswirkte. Die Beschäftigten waren frustriert, weil sie an schlecht gewarteten Maschinen arbeiteten und häufig lange auf das benötigte Material warten mussten. Zugleich konnte die Produktion von Konsumgütern und Lebensmitteln vielfach nicht mehr mit den steigenden Einkommen Schritt halten: Die Menschen verfügten über Geld, konnten es aber kaum ausgeben. Am deutlichsten zeigte sich dies beim Autokauf: Auf einen Neuwagen der Marken Trabant und Wartburg musste man bis zu 17 Jahre warten – ganz abgesehen davon, dass die stinkenden Zweitakter der globalen technologischen Entwicklung mittlerweile meilenweit hinterherhinkten. Das viel beschworene „Weltniveau“ wurde bei weitem nicht erreicht. Demgegenüber vermochten die „sozialen Errungenschaften“, die subventionierten Lebensmittel und die billigen Mieten nur begrenzt zur gesellschaftlichen Befriedung beitragen – sie wurden von der Bevölkerung längst als selbstverständlich betrachtet.
Eine weitere Folge der auf Verschleiß gefahrenen Wirtschaft waren gravierende Umweltbelastungen. Die Luft in den Städten der Industriereviere, insbesondere im berüchtigten mitteldeutschen Chemiedreieck, war so stark belastet, dass die Bewohner häufig aufgefordert werden mussten, Türen und Fenster zu schließen. Viele Flüsse und Seen waren durch Industrieabwässer verseucht, landwirtschaftliche Flächen von Düngemitteln belastet. Eine öffentliche Diskussion über diese Missstände war nicht möglich. Nicht von ungefähr wurden UmweltschutzinitiativenUmweltgruppen zu einer der Keimzellen der Oppositionsbewegung.
Das soziale Aufstiegsversprechen, mit dem die DDR vor allem in den beiden ersten Jahrzehnten ihrer Existenz noch zahlreiche Menschen an sich binden konnte, stieß mittlerweile an seine Grenzen. In den 1950er- und 1960er-Jahren hatten hunderttausende Menschen aus unterprivilegierten Schichten Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten erhalten, die ihnen in früheren Zeiten verwehrt geblieben waren. Viele hatten diese Chancen genutzt, mittlere oder gehobene Leitungspositionen erreicht – und waren dort verblieben. Die beruflichen Karrierewege waren verstopft, auch weil mit dem drastischen Rückgang der Fluchtbewegung nach dem MauerbauBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall weniger Stellen frei wurden. Dies führte zu Unmut bei ehrgeizigen und gut qualifizierten Nachwuchskräften – insbesondere dann, wenn die angestrebten Positionen weniger aufgrund fachlicher Qualitäten als nach politischer Linientreue vergeben wurden.
Ebenfalls an Integrationskraft verloren hatte die Friedensrhetorik der SEDSozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). Der Widerspruch zwischen der Proklamation der DDR als „Friedensstaat“ bei gleichzeitiger Militarisierung der Gesellschaft war zwar kein neues Phänomen, doch zu Beginn der 1980er-Jahre hinterfragten immer mehr Menschen die Formel, nach der „der Friede bewaffnet“ sein müsse. Es entstand – wie in der Bundesrepublik – eine FriedensbewegungFriedensbewegung/Friedensgruppen. Als Katalysator wirkten hier die Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen in beiden deutschen Staaten sowie die Einführung des Wehrunterrichts als Pflichtfach an den Schulen der DDR im Jahr 1978. Die KirchenKirche(n) protestierten vergeblich dagegen und auch viele Eltern standen dem Wehrunterricht ablehnend gegenüber.
Verbunden waren diese konkreten Missstände insbesondere bei jungen Leuten mit einem allgemeinen Gefühl der Perspektivlosigkeit. Die Menschen waren nicht nur mit den gegenwärtigen Verhältnissen unzufrieden, sie hatten auch die Hoffnung verloren, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändern würde. Eine Stimmung gesellschaftlicher und politischer Stagnation machte sich breit, wofür die Gerontokratie des PolitbürosPolitbüro, dessen Mitglieder im Jahr 1988 durchschnittlich über 65 Jahre alt waren, nur der sinnfälligste Ausdruck war.
Literaturtipp | Eine lebendige, auch aus eigenen Erfahrungen gespeiste und anekdotenreiche Alltagsgeschichte der späten DDR bietet Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989, Berlin 1998.
Zitat | „Die MauerBerliner Mauer/Mauerbau/Mauerfall steht noch 100 Jahre“, Erich Honecker, 19. Januar 1989





























