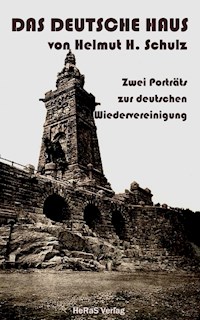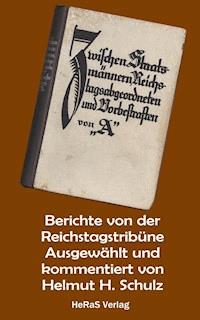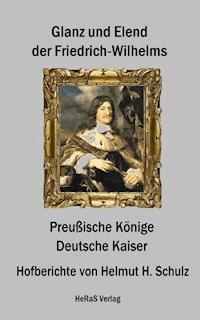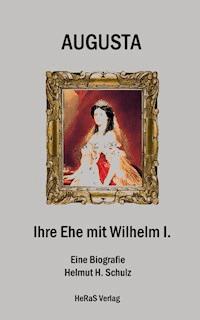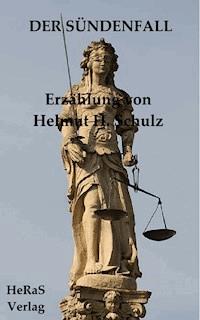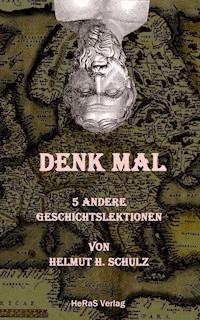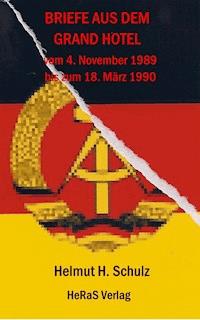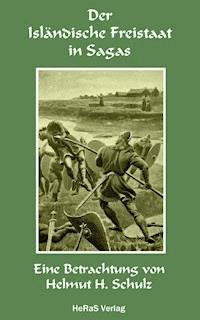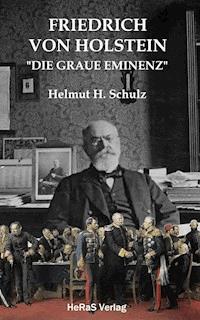
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Den Ehrentitel: "Graue Eminenz" bekam der "Vortragende Rat" im Auswärtigen Amt zunächst Preußens, später des Deutschen Kaiserreiches, früh verliehen, und zwar von aufmerksamen ausländischen Beobachtern, die feststellten, dass die Politik von den Geheimräten des Auswärtigen Amtes gemacht wurde. Diplomaten, Politiker und die Redakteure der Skandalblätter nannten den Mann an der Spitze der Ministerialbürokratie im Auswärtigen Amt, ehrfürchtig erschauernd: Graue Eminenz, Éminence grise und schrieben ihm einen Einfluss zu, den er nie besessen hat. In der Tat aber gab es ein Jahrzehnt, in welchem Holstein die Außenpolitik des Reiches faktisch geleitet hat, wie in den Auslandsvertretungen zu recht geraunt wurde. Es war sein Jahrzehnt, und der Übergang des Jahres 1890 zu 1891 bedeutete nicht nur die Entlassung Bismarcks und den Kanzlerwechsel, sondern auch einen Einschnitt im Leben Holsteins; die absolute Zäsur...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut H. Schulz
Friedrich von Holstein
Die graue Eminenz
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erster Teil: EIN SYSTEM DER ÜBERWACHUNG
Zweiter Teil: DER UNTERNEHMER
Dritter Teil: DIE CAUSA ARNIM
Vierter Teil: KULTURKAMPF
Fünfter Teil: ARNIMS STURZ
Sechster Teil: HOLSTEINS GROSSES SPIEL
Siebenter Teil: HOLSTEINS VOLLENDUNG
Achter Teil: DIE CAUSA EULENBURG
Neunter Teil: DAS ENDE DER DINGE
Benutzte Literatur
Impressum neobooks
Erster Teil: EIN SYSTEM DER ÜBERWACHUNG
Den Ehrentitel: »Graue Eminenz« bekam der »Vortragende Rat« im Auswärtigen Amt zunächst Preußens, später des Deutschen Kaiserreiches, früh verliehen, und zwar von aufmerksamen ausländischen Beobachtern, die feststellten, dass die Politik von den Geheimräten des Auswärtigen Amtes gemacht wurde. Diplomaten, Politiker und die Redakteure der Skandalblätter nannten den Mann an der Spitze der Ministerialbürokratie im Auswärtigen Amt, ehrfürchtig erschauernd: Graue Eminenz, Éminence grise und schrieben ihm einen Einfluss zu, den er nie, den er vor allem in der Bismarckzeit nicht allein besessen hat. In der Tat aber gab es ein Jahrzehnt, in welchem Holstein die Außenpolitik des Reiches faktisch geleitet hat, wie in den Auslandsvertretungen zu recht geraunt wurde. Es war sein Jahrzehnt, und der Übergang des Jahres 1890 zu 1891 bedeutete nicht nur die Entlassung Bismarcks und den Kanzlerwechsel, sondern auch einen Einschnitt im Leben Holsteins; die absolute Zäsur. Die beiden Bismarcks, Vater und Sohn und ihr Legationsrat hatten bis dahin eine merkwürdige Triade gebildet. Überblickt man dieses Leben bis zur Entlassung Bismarcks, so war der Legationsrat lange subaltern, ein stiller Teilhaber, der Mann im zweiten Glied, erfüllte seine Aufgaben korrekt, gewissenhaft und widerspruchlos, ein unangefochtener Kenner der internationalen Politik, und in das Kräftespiel seiner geheimen Verflechtungen eingeweiht. Alle seine späteren Vorgesetzten, die Kanzler, Minister und Staatssekretäre schätzten die Empfehlungen des »Vortragenden Rates«, der, von Bismarck geformt, unter Caprivi und Hohenlohe die Staatssekretäre angeleitet hatte, bis zu Bernhard von Bülow, bei dem das Wirken Holsteins endete. Der Kanzler Bülow sorgte allerdings nicht selbst für die Entfernung des Legationsrates aus dem Ministerium, sondern bediente sich eines Helfers; es war ein abgekartetes, leicht zu durchschauendes Ränkespiel, um einen lästig gewordenen Mann loszuwerden. Holsteins Zeit war zu Ende, er selbst zu keiner Anpassung fähig, da sich die Dinge nicht nach seinem Willen formten. Und dem immer Wachsamen entging, was sich gegen ihn zusammenbraute. Holstein war Teil eines ganzen Systems; ein Ratgeber, immer dabei, aber nie voll verantwortlich, wohl aber für schuldig gesprochen und als intrigant verrufen, wenn die Dinge anders liefen als gedacht. Er irrte wie alle Ratgeber häufig, verfing sich am Ende selbst in den Netzen, die er für andere geknüpft hatte und stellte verwundert fest, keine Freunde mehr zu haben, und »dass alles anders gekommen war«. In dieser Monarchie, dem Kaiserreich, hing viel, wenn nicht alles, von Personen ab, das heißt, von der gesellschaftlichen Stellung. Beginnend an der Spitze einen überhobenen, von sich selbst überzeugten, aber auch an sich selbst zweifelnden Autokraten, bis hinein in die Ministerien und in die politischen Salons und Zirkeln des politischen Berlin, nicht zuletzt bei den Wahrsagerinnen, den okkultistischen Klubs bürgerlicher Sybillen. Gewiss, der Spiritismus war eine europäische Sucht, nicht alle waren ihr verfallen. Holstein hat nie an einer okkultistischen Sitzung teilgenommen, oder an einer Vorhersage geglaubt; er hatte für dieses Treiben nur Hohn und Spott. Seine Ablösung wurde nicht prophezeit, sie kam ihm überraschend, obschon er selbst dem amtierenden Reichskanzler von Bülow seine Entlassung angeboten, nein, mehr angedroht hatte. Aus besonderem Grund, weil die Diplomaten sein Verhandlungsexposé für die Lösung der Marokkokrise verworfen hatten. An der Aufteilung Nordafrikas unter den drei europäischen Großmächten war durch Diplomatie nichts mehr zu ändern. Das nennt man: Kräfteverhältnis. Er, Holstein, ein Zivilist, hätte einen Krieg mit Frankreich in Kauf genommen, und die auf Kante genähte Politik Bismarcks fortgeführt. Bei der Gelegenheit zeigte es sich, dass Paris für einen Krieg nicht gerüstet gewesen wäre. Das Ende seiner Laufbahn: Elf seiner Rücktritte hatten sich im Sande verlaufen, oder Holstein hatte sie zurückgezogen. Niemand nahm seine Kündigungen ernst; doch, einer, ein Neuer, der die Gepflogenheiten im Auswärtigen Amt und den Stil des Vortragenden Rates entweder nicht kannte, oder der sie negierte. Ein Staatssekretär von Tschirschky und Bögendorff, eine blasse Figur im Kanzleramt, wie manche fanden, die an dem Glanz eines Amtes hingen, prüfte gelassen, was ihm zur Entscheidung vorgelegt worden war, und entschied nach Kassenlage. Er nahm das Entlassungsgesuch Holsteins vom Schreibtisch des Reichskanzlers, der zur gleichen Stunde eine seiner Reichstagsreden hielt und überraschend zusammenbrach, nachdem er zuvor in einer Unterredung, dem Gespräch unter vier Augen, seinem Staatssekretär anheimgestellt hatte, mit dem von Holstein eingereichten Abschiedsgesuch zu verfahren wie ihm gut dünke. So kam das Gesuch Holsteins auf den Schreibtisch des Kaisers, wurde noch einmal besprochen und mit Empfehlung Tschirschkys vom Kaiser gegengezeichnet. Mit einem Ordensband geehrt, sah sich Holstein in den ehrenvollen Ruhestand versetzt. Zufall oder Absicht? Beides nicht, und doch mehr Absicht und Gelegenheit mit einem Hintergrund.
Der Reichskanzler von Bülow, nach der öffentlichen Vorstellung eines Zusammenbruchs im Reichstag, genas schnell, das war alles, und es geschah ungefähr zur Marokkokrise und zur Algericas-Konferenz. Jemand erklärte zu diesem Vorfall: »Wussten Sie nicht, dass Bülow auf Verlangen weinen kann?« Später stammelte der Kanzler Entschuldigungen, die Holstein weismachen sollten, alles sei nur ein tragisches Versehen gewesen, der Dummheit eines Staatssekretärs geschuldet, nicht mehr rückgängig zu machen. Sie wollten ihn los sein, den Wegbegleiter, den Chronisten ihrer Verfehlungen, der so viel, der zu viel über sie wusste und dem sie instinktiv zutrauten, von seinem Wissen schnöden Gebrauch zu machen, zu ihrem Schaden. Aber wollte Bülow diesen Legationsrat auch wirklich loswerden? Lavierte er nur? Beide Männer waren lange miteinander bekannt, hatten beruflich und privat zu tun gehabt. Bülow holte auch nach der Entlassung Holsteins Rat bei ihm ein. Der »Aal«, wie der Reichskanzler von Bülow mit einem späten, vom Kaiser verliehenen Fürstentitel von Freunden und Feinden genannt wurde, entschuldigte sich bei Holstein persönlich, auf ein Missverständnis abhebend, von einem Subalternen ahnungslos angerichtet. Der Staatssekretär hatte keinen Kontakt zu Holstein gesucht. Eingestandenermaßen war ihm der Legationsrat unangenehm, unheimlich.
In der Wilhelminischen Ära, einem beinahe noch absolutistischen System, wenn es denn nach der Bismarckära überhaupt noch ein System gewesen ist und nicht eher von Fehl- oder Vorurteilen, von starren Äußerlichkeiten und Zufällen gelenkt, spielte Holstein die Rolle eines Mirakels, eines Allwissenden, des Spiritus Rector. Klugerweise hat er zeitlebens die Verantwortung eines Staatssekretärs abgelehnt, wie ihm mehrfach geboten. Er blieb Referent, Legationsrat, der seinem Kanzler oder dem Kabinett vortrug und im Übrigen an alle Welt mahnende und warnende Briefe verschickte, die von einem anderen Reichskanzler, dem Vorgänger Bülows, dem greisen Hohenlohe-Schillingsfürst, einem weisen alten Mann aus der hohen Schule der Diplomatie und vollendeter Umgangsformen, vertraut mit allen menschlichen Schwächen, als Kindereien höflich abgetan wurden. Er bezeichnete später die Mehrzahl der Ratschläge, die Holstein gegeben habe, als falsch; von seiner hohen Warte sind sie das auch häufig gewesen. Zu anderen Zeiten hatte er seinem Legationsrat Holstein vertraut und auch seinem Sohn Alexander, natürlich auch einem Staatssekretär, geraten, vorsichtig mit Holstein umzugehen, über den in den Salons so viel gemunkelt wurde! Aber es gab in diesem Leben einen frühen Bruch, an dem Holstein schwer trug. Zugeschrieben wurde ihm, die treibende Kraft beim Sturz des kaiserlichen Botschafters in Paris, gewesen zu sein.
Der hohe Diplomat Harry von Arnim, ein Liebling der kaiserlichen Gesellschaft, eine vornehme Figur, Künstler, Komponist, intrigant, reich, unabhängig, arrogant und unbedenklich in seinen Unternehmungen, fiel von der Hand Holsteins. Am Ende entscheidet immer die Persönlichkeit. An dem frühen Tod des Grafen, sprachen seine Standesgenossen Holstein gnadenlos schuldig, es war eine Sünde ohne Vergebung. Die Affäre Arnim holte den Rat, den »Henker Arnims«, immer wieder ein; nein, sie hat ihn seit seiner Lebensmitte begleitet und seine Handlungen beeinflusst. Einen tiefen Bruch, eine letzte Wandlung im Leben dieser Sphinx, wurde durch das Ränkespiel um den »Rückversicherungsvertrag« eingeleitet, Bismarcks Lebenswerk. Als die Frist zur Verlängerung des Abkommens abgelaufen war, schien Holsteins Anteil an der Entscheidung mit Russland zu brechen, immerhin bedeutend, obschon er selbst vehement bestritt, den Vertrag, der Europa kurzfristig ein stabiles Miteinander gesichert hatte, hintertrieben zu haben. Aus persönlichen Briefen Bismarcks an ihn wollte er belegen können, dass er im Gegenteil für die Verlängerung des Vertrages gestimmt habe. Nur, die Tatsachen sprechen dagegen, was auch immer in den Briefen stand.
Bismarcks Nachfolger, Graf Leo von Caprivi, in dessen Amtszeit die Verlängerung des Abkommens fiel, viel mehr, gefallen wäre, bemerkte einsichtig, er sei nicht in der Lage, wie Bismarck mit fünf Bällen zugleich zu spielen, von denen drei immer in der Luft seien. Das System Bismarck war für seinen schlichten Geist zu kompliziert, zu komplex, zu oft wechselten die Situationen. Er begriff nicht, dass hinter dem Wechsel ein flexibles Konzept steckte. Der neue Reichskanzler Caprivi war der gewagten Dreiecksdiplomatie Bismarcks nicht gewachsen, wie er selbst wusste; er hielt diese Art Diplomatie, nach eigenem Eingeständnis überhaupt für unfruchtbar. Er, ein aufrechter Mann, der den Kaiser auf seine mangelhaften Erfahrungen in der Außenpolitik aufmerksam gemacht hatte, erhielt die kaiserliche Antwort, »für die Außenpolitik bin ich zuständig«. Ehrlicherweise trat er gelegentlich ab, viel mehr entließ ihn Kaiser Wilhelm mit der Begründung, dieser Kanzler sei ihm zu unbeweglich, zu langweilig, er könne mit ihm nicht arbeiten.
Bismarck hat den ehrlichen alten General für einen befähigten Unteroffizier gehalten, aber in der Praxis war Caprivi nun einmal ein hoher Militär. Generäle mit dem Begriffsvermögen von Wachtmeistern mag es häufiger gegeben haben. Es gibt sie auch heute; sie sind nicht ausgestorben, sondern unsterblich. Feldherr ist kein Lehrberuf; Diplomat im Grunde auch nicht. Als dem Kaiser Napoleon I. die Beförderung eines seiner Offiziere zum General vorgeschlagen wurde, fragte der Imperator schlicht: »Hat er Fortune?« Er wusste, wovon er redete; als ihn sein Glück verlassen hatte, begannen die Niederlagen. Glück kann man auch nicht lernen; man hat es, allerdings meist nur zeitweise. Dann geht das Privileg auf einen anderen, meist einen jüngeren über. Dennoch hatte Caprivi Gelegenheit, während seiner Amtszeit die Entlassung Bismarcks zu betreiben, sie zumindest nicht zu verhindern gesucht, sicherlich ohne zu wissen, was er tat, ein braver Mann und ein gehorsamer alter General.
Der Altkanzler hatte von seinem Ruhesitz Friedrichsruh aus beobachtet, was sich in Berlin tat, wie die Nachfolger mit seinem Lebenswerk umgingen und wie sie es schließlich ruinierten. Vor Eintritt der Katastrophe schloss er die Augen. Zweifellos hat Friedrich von Holstein die Entfernung des Reichskanzlers, seines Lehrmeisters, ungeachtet seiner langen und engen Freundschaft zur Familie Bismarck, mitbetrieben; es war für ihn eine Überlebensfrage über die Ära Bismarck hinaus zu bleiben, wenn dessen Sturz unvermeidlich war, wie Holstein erkannt hatte. Im Grunde wird er den »Rückversicherungsvertrag«, die Konstruktion Bismarcks, weder für zu komplex, noch für zu kompliziert gehalten haben, wie er unter anderem vorgab. Nur beurteilte er die europäische Bündnislage 1890 anders als zur Zeit des Abkommens drei Jahre zuvor, und er stand mit seinem Urteil über das »Russenabkommen« beileibe nicht allein. Voller Überzeugung erläuterte einer der Staatssekretäre im Außenministerium, von Marschall, dem Reichstag die Gründe, die zur Ablehnung der russischen Wünsche nach Verlängerung des Abkommens geführt hatten; es sei immer misslich, sich nach zwei Seiten hin zu binden, weil man sich in einem solchen Vertrag nur gegenseitig schwäche. Ja, aber genau darauf hatte doch das Konzept Bismarcks beruht, sich gegenseitig zu binden; er wollte keine »Erwerbsgenossenschaft« bilden, sondern die Interessen des einen an die des anderen binden, sodass sich ein überraschender Präventivschlag, ein Überfall nicht lohnte! Gleich nach Abschluss der Vereinbarung wurden die Früchte sichtbar; auf dem europäischen Festland war nichts zu holen, so wendete sich die Diplomatie anderen Weltgegenden zu. Die europäischen Westmächte hatten ein anderes, ein ausbaufähiges Objekt ihrer Begierde entdeckt, den Erwerb ihrer Kolonialreiche! Womit sich die Politik vom Balkan ins Mittelmeerbecken erweiterte, wo in er Tat die Rückversicherung nichts mehr nutzte!
Endlich soll Holstein den Kaisergünstling, den Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld zur Strecke gebracht und damit die schwerste innere politische Krise des Kaiserreiches und Zweifel in die Glaubwürdigkeit seiner Führer, der Fürsten und Junker ausgelöst haben. Die Reihe der Prozesse, die den Kaiser bloßstellten und die Rolle Eulenburgs beendeten, seien Holsteins Werk gewesen. Der Legationsrat hatte in seinen letzten Lebensjahren beide, Kaiser und Harlekin, Wilhelm und Eulenburg, bekämpft, weil er sie, weil er das System für ein Unglück hielt. Fünf Jahre nach seinem Tode, brach der Erste Weltkrieg aus und beendete alle Bündnisse. Das »Palasthündchen«, wie seine Freunde und seine Feinde den Fürsten Eulenburg nannten, hatte ausgebellt, lebte aber gleichwohl noch lange weiter.
An Eulenburg hatte Holstein ein gewisses beobachtendes, misstrauisches und zurückhaltendes Interesse gefunden. Für die Vorzüge und Begabungen Eulenburgs nicht blind, war er ihm ein guter Ratgeber gewesen, und schrieb doch korrekt auf, was er über ihn in Erfahrung bringen konnte, einem schwer Homosexuellen, der seine Beziehungen, zu Schwulen und Okkultisten nicht mehr unter Kontrolle hatte. Holstein leistete denn auch einen erheblichen Beitrag, den Invertierten, den Schädling zur Strecke zu bringen, freilich mithilfe eines ihm, Holstein, ähnlichen Journalisten, Maximilian Harden, alias Witkowsky, einem der gewissenlosesten Pamphletisten und übelsten Schandmäuler des Kaiserreiches. Wollte der Geheimrat im Ruhestand Holstein, Eulenburg und nach ihm die kaiserliche Majestät beseitigen? Unglaublich, aber vieles ist an diesem Leben seltsam widersprüchlich. Noch als alter Mann forderte Holstein Eulenburg zum Duell, das natürlich nicht ausgetragen wurde, weil der Fürst eine Ehrenerklärung abgab. Darüber wird noch zu reden sein. Feige war dieser Holstein nie, er forderte überhaupt leicht, wenn er beleidigt worden war, also im Grunde oft und regelmäßig. Dem Vortragenden Rat im erzwungenen Ruhestand, einem nur aus der Ferne lenkenden Beobachter, wurde angelastet, den Kaiserintimus vom Sockel gestürzt und aus den Wonnen der großen Politik in die Isolierung und Einsamkeit seines Schlosses Liebenberg vertrieben zu haben. Wo er friedlich, schwer krank im Schlosspark wandelte, sich auf einen Stock stützend.
Zu Herbert von Bismarck, dem Sohn des Altkanzlers, einem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, zu Bülow, selbst zu Eulenburg und zahlreichen anderen hatte Holstein das Duzverhältnis gesucht und es lange aufrechterhalten; er ließ seine Freunde fallen, wenn ihre Zeit abgelaufen war oder wenn er ihrer Loyalität nicht mehr vertraute. Im Grunde hatte er recht; seinen Erfahrungen nach, waren sie alle zu jeder Stunde des Verrates fähig, wenn sie sich einen Nutzen versprachen. Alle schätzten seinen Scharfsinn, und alle fürchteten, wie kleine Jungen den Rohrstock des strengen Lehrers, die gnadenlose Bestrafung ihrer Fehler und ihrer Unterschleifen. Sie alle hatten etwas auf dem Kerbholz. Im Senat Roms hätte Holstein das Amt eines Zensors bekommen, in der Französischen Republik das eines Kriegskommissars vom Range eines St. Just.
Die Aufzählung seiner Vergehen ist unvollständig, obschon es kaum denkbar erscheint, dass ein Beamter, wenn auch ein hoher, all dies allein verschuldet haben könnte, Ministerstürze, Berufungen und Bestrafungen, ohne dass sie ihm auf die Sprünge gekommen waren und ihn einfach rausschmissen. Nein, sie waren ihm alle zu ähnlich, nur dass ihnen die Konsequenz fehlte, ihren Machttrieb auszuleben. Sie wollten mit all ihren Fehlern von ihren Mitmenschen geliebt sein! Die dunkle Seite seines Wesens, der verborgene Anarchist, trat spät zutage. Beide Bismarcks haben ihn zuletzt, als seine Eskapaden immer grotesker und unerklärlicher schienen, einfach für verrückt gehalten. Der Altkanzler hatte einmal bemerkt, als ihn die Klagen über den Legationsrat erreichten, dass nur er mit Holstein fertig geworden sei. Und daran ist etwas Wahres, wie sich nach der Entlassung Bismarcks herausstellte. Sie wurden nicht mit ihm fertig; er machte ihnen die Außenpolitik, deren Fehler sie mit ihrem Titel decken mussten!
Als sie in Mode gekommen waren, reihten die Psychoanalytiker Holstein unter die Psychopathen ein, weil sie ihn nicht verstanden und auch nicht damit rechnen konnten, dass er sich zur Beratung auf eines ihrer Sofas legen würde, um ihnen Rede und Antwort zu stehen, ob ihn seine Mutter vernachlässigt hatte, oder ob ihn sein Vater missbraucht habe. Lange hätten sie nicht suchen müssen. Wirklich hat Holstein eine lieblose Kindheit gehabt. Dafür steht die Erzählung seiner Haushälterin, die Holstein als alten Mann in Tränen ausbrechen sah, als ihn nach Jahrzehnten seine treue Amme in Berlin aufsuchte, einfach nur zu Besuch kam, zu ihrem geliebten Milchsohn! Er aber konnte, bei der Erinnerung an glücklichere Zeiten, nicht an sich halten! Sie fanden aber heraus, dass er an einer Paranoia litt, einem störrischen Größenwahn, eine seit dem Altertum beobachtete Geisteskrankheit, bei Kaisern und Vasallen häufig. Sie forschten vergeblich nach den Ursachen; im Grunde litt das zu Ende gehende Jahrhundert insgesamt an der Übersteigerung des Lebensgefühls, einem, nicht-wissen-wohin-mit-sich.
Die Vorwürfe mehrten sich: verfehlte Beratertätigkeit, wenn es um die Besetzung hoher staatlicher Ämter ging, um die Wahl eines Nachfolgers in irgendeinem Amt; abgefeimte heimliche Wühltätigkeit gegen Vorgesetzte, ihm sozial Überlegene, oder auch einfach Ausdruck seiner indifferenten Angstzustände, persönliche Racheakte gegen Personen, von denen er annahm, dass sie ihm geschadet hatten oder ihm schaden könnten. Treulosigkeit, und in einem Falle der Diebstahl persönlicher Briefe mitsamt einer Schatulle aus dem Hotel »Bristol«, in das Bülow, damals noch Botschafter in Rom, und seine Gattin, die »Contessina«, zu einem sogenannte »Tee mit Schleppe« geladen hatten. Was darunter zu verstehen ist, wenn nicht ein Empfang, ein Jour fix, ist leicht zu erraten. Viel Kultur, oder was die Clique darunter verstand, auch unterhaltende Musik, viel Anekdote, kurz, die aufgelockerte Langeweile der Gesellschaft. Die Contessina entstammte einer der ältesten italienischen Adelsfamilien; sie hatte sich scheiden lassen, um sich mit Bülow zu vermählen, nach einem langen Rechtsstreit und dem Dispens Seiner Heiligkeit; für eine Katholikin der einzige Weg, eine neue Ehe zu schließen. Dazu musste die frühere Beziehung für ungültig erklärt und annulliert werden. Das Paar besaß in Berlin keine Wohnung und befand sich auf der Durchreise ins Seebad nach Norderney. Für ihren Tee mit Schleppe nutzte die Contessina das Hotel »Bristol«. Der Diebstahl machte Aufsehen, aber die Bülows machten überhaupt Aufsehen.
An und für sich vermied es Holstein, sich in Gesellschaften zwanglos zu zeigen; aus irgendeinem Grunde aber hatte er die Einladung der Bülows angenommen und sich als Original bestaunen lassen. Nun fiel der Verdacht des Diebstahls auf ihn. Es handelte sich um die »Tausigbriefe«, intime Schriftstücke von der Hand der Dame des Hauses, Liebesbriefe an ihren Klavierlehrer, in ihrer Jugendzeit verfasst, längst vergangen und olle Kamellen. Vergangen? Keineswegs, da niemand die Brieftexte kannte! Und also gern gewusst hätte, was sich ein Klavierlehrer und eine seiner Schülerinnen neben den Übungen auf der Tastatur zu sagen und zu schreiben hatten. Weshalb lagen sie herum, und nicht unter Verschluss gehalten, wenn ihr Inhalt kompromittierend war? Ob Holstein im Besitz der Briefe war, blieb ungeklärt, ist aber wenig wahrscheinlich. Angeblich fand sich die Schatulle mit den Briefen auch wieder an. Bemerkenswert an dem Vorfall ist, dass die Teegesellschaft einem Legationsrat den Diebstahl zutraute, da doch alle in Verdacht kamen. Bülow hat sich übrigens für die unsinnige Verdächtigung bei Holstein entschuldigt.
In den oberen Kreisen der Gesellschaft wurde viel musiziert; es war eine adlige Freizeitbeschäftigung, zu Hause geübt, auf ein Klavier einzuschlagen, schlimmstenfalls zu komponieren, wie weiland der Prinz Louis-Ferdinand, oder der Alte Fritz oder König Friedrich Wilhelm II., dessen Spiel auf dem Cello sogar einen Beethoven beeindruckt haben soll. Andere Nachrichten über den königlichen Virtuosen gibt es nicht. Indessen schmückten sich natürlich auch die bürgerlichen Salons mit ihren musischen Entdeckungen, mit Pianisten zumal, mit Geigern, daher die Bezeichnung Salonmusik, den Violinvortrag, von einen Pianisten begleitet. Wem fällt hier nicht der Namen Paganini ein oder Ludwig Spohr? Auch der größte Salon war zu klein für ein großes Orchester. Auch wurden die Mittel knapp, sich ein Orchester zu leisten. Der Botschafter Harry Graf von Arnim konnte komponieren, er konnte sich selbst präsentieren; der Botschafter Eulenburg konnte es auch. Bismarck konnte es nicht, und er war misstrauisch, was diese adligen Schauobjekte betraf. Jeder Politiker, dem es an einer diplomatischen Karriere lag, und der zugleich öffentlich Klavier spielte, wie ein Zirkusartist, der auf einem Seil tanzt, war ihm verdächtig. Er genoss es aber, wenn seine Frau gelegentlich für ihn allein spielte, Bach, wie berichtet wird; es beruhigte ihn. Ein anderer Komponist als Bach würde die Nachwelt auch enttäuscht haben. Die vollendete Ausgewogenheit der Kompositionen Johann-Sebastians hätte zu dem Rationalisten Bismarck gepasst, falls diese Mitteilung verbürgt ist. Die Fürstin; nun, sie war offenbar mit dem Beifall ihres Gatten zufrieden. Wohl wahr, dass immer alles auf Zeit und Umstände, auf das richtige Maß ankommt. Der Reichskanzler spielte vornehmlich Reichstag und nicht Piano. Dem Nachgeborenen fällt die Psychologie des Zeitalters auf, das ständig Gereizte, das Übersteigerte der Gesellschaft des Kaiserreiches, die Hektik und die Unsicherheit der Entscheidungen, die Großmannssucht, die Nervosität, von der das politische Leben nach dem Tod des alten Kaiser Wilhelms 1888 gleichsam durchfiebert war. Man dachte in Superlativen, in Steigerungen, groß, größer, am größten und am größesten! Im »Untertan«, nach dem Romanentwurf von Heinrich Mann, sieht der Jurist und Schauspieler Wolfgang Buck den Kaiser in der Rolle eines Mimen; das deckt sich mit dem Eindruck eines Diplomaten, der Kaiser wolle überall auffallen. Der Schauspieler hatte sich der politischen Tribüne bemächtigt. Umgekehrt posierte die Politik im Plenarsaal des Reichstages wie auf der Bühne eines Theaters. Weiter fällt der permanente Angstzustand auf, Angst vor dem feindlichen Nachbarn, der jederzeit zum Militärschlag ausholen konnte, gegen den man sich durch Dutzende Abkommen sicherzustellen suchte. In keinem Zeitalter zuvor waren eine solche Menge sinnloser Beistandsverträge geschlossen und natürlich gebrochen worden, Sicherheit vortäuschend. Die großen europäischen Monarchien lagen in Konkurrenz miteinander, im Felde, im Ballsaal, bei feudalen Segelregatten. Indessen das, was man damals als »Proletariat« bezeichnete, in ihrem Schatten gedieh, das, groß geworden und durch den Krieg bewaffnet, zum Untergang der alten Großreiche nicht wenig beitrug und diese durch fragwürdige Republiken ersetzte, in denen nicht weniger posiert wurde. 1887 schrieb einer der Kulturkritiker jener Zeit, Albert Lange die »Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart«; das Buch wurde gelesen, es leitete direkt zu Sigmund Freud über, der dem Zweckgefühl einen Namen gab, Nervosität.
Es sei aus Lange zitiert, aus dem dann doch nichts gelernt wurde: »Ja vielfach ist das, was als lärmende oder sinnlose Freude an eitlen Vergnügen erscheint, eben nur eine Folge der übermäßigen, aufreibenden und abstumpfenden Arbeit, indem der Geist durch das beständige Hetzen und Wühlen im Dienste des Erwerbs die Fähigkeit zu einem reineren, edleren, und ruhig gestaltenden Genusse einbüßt... Die Mittel zum Genuss zusammenraffen, und dann dieses Mittel nicht auf den Genuss, sondern größtenteils wieder auf den Erwerb verwenden: das ist der vorherrschende Charakter unserer Zeit.« Erschütternd an dieser mehr als 120 Jahre zurückliegenden Analyse ist die Erkenntnis, dass von diesem Weg nichts abgestanden wurde, nicht abgestanden werden kann.
In der Wahl seiner Mitstreiter war Holstein nicht wählerisch; er konnte es nicht sein. Wenn ein neuer Kanzler drohte, dann zog mindestens ein neuer Staatssekretär mit ihm ins Amt ein, wenn nicht mehrere, denen es oblag, die Kanzlerdirektive in Aufträge, in Gesetze und in Verordnungen umzusetzen. Ein Stab von Geheimräten paraphierte die Vorlage, sie wurde debattiert, die Argumente für und dagegen abgewogen, über den Kanzler zum Kaiser hinaufgereicht, kamen zurück, mit Wünschen des Herrschers verziert und gelangte endlich zur Lesung in den Reichstag oder landeten im Papierkorb. In diesem Ministerium der Kanzlerschaften nach Bismarck, besser des kaiserlichen Absolutismus der Zufälligkeiten, war ein Geflecht von Abhängigkeiten entstanden, von weitverzweigten Komplizenschaften und starren gegenseitigen Rücksichten, eine Art Klassensolidarität der oberen Schichten. In der Ära nach der Entlassung Bismarcks ging es nicht mehr allein um die Lösung der »deutschen Frage«, sondern um weltpolitische Zusammenhänge, um »globale« Fragen, wenngleich dieser Begriff noch gar nicht zum Vehikel der Diplomatie verkommen war. Deutschland war Großmacht geworden und entwickelte dementsprechend ein Anrecht auf einen der vorderen Plätze in der Rangliste der Imperien. Die anderen blieben eine Nasenlänge vorn; die Queen war Empress of India geworden, eine Kaiserin, Herrscherin über einen Kontinent; ihr Enkel war immerhin Kaiser der Deutschen.
Von Berlin aus, das heißt, nach dem »Berliner Kongress«, verlagerte sich der Schwerpunkt der zentralen europäischen Politik nach Süden, und der eurasisch, östliche nach Asien. Ausgangspunkt wurde die Herrschaft über den Balkan und über das Mittelmeerbecken, somit über die Sicherung der Verkehrswege. Das betraf alle Mittelmächte, Deutschland ausgenommen. Und es war die Neuauflage eines alten Exposés; seit dem Italienfeldzug Napoleons hatte die Admiralität starke Schiffsverbände nach Süditalien gesendet, und es war Nelson auch gelungen, die französische Flotte bei Abukir zu vernichten und die Familie des britischen Geschäftsträgers in Neapel nach England zu evakuieren. Nun ging es darum, die Russen aus dem mediterranen Raum zu vertreiben, ihre Flotte im Schwarzen Meer zu blockieren und sie wie in einem Flaschenhals zu verkorken, nach dem Vergleich eines der alten Diplomaten.
Mag man sich fragen, weshalb der Weltkonflikt dann ausgerechnet auf europäischen Schlachtfeldern ausgetragen wurde, wenn es um Weltpolitik ging. Das Gespenst ging früh um, und Holstein kannte das Syndrom der Angst: Die in Betracht kommenden Kolonialmächte vereinbarten auf der sogenannten Kolonialkonferenz 1884 in Berlin, dass die Kolonien von Kampfhandlungen ausgenommen bleiben sollten, aber natürlich wurde ab 1914 an allen Grenzen gekämpft, an denen die Kolonien aufeinanderstießen. Keiner der Unterzeichnerstaaten dachte auch nur im Traum daran, das 1884 geschlossene Abkommen einzuhalten. Die Kolonien, die sogenannten Schutzgebiete, waren aus dem Konflikt der Großmächte nicht herauszuhalten. Schreibt man sich als Erstsemester in Geschichte die damals anstehenden politischen Probleme für eine Zwischenprüfung auf, dann ergibt es sich verblüffender Weise, dass der Geheime Legationsrat Holstein in fast allen Fällen nach 1891 die diplomatische Vorarbeit geleistet hat. Die Mehrzahl der Entwürfe, Vorlagen und die Exposés tragen seine Handschrift. Vom gewissenhaften aber untergeordneten Sekretär des »Berliner Kongress«, der am 13. Juni 1878 begann und bis 13. Juli 1878 dauerte, von Bismarck inspiriert und dominiert, vom Leiter der Politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes war Holstein zum Verfasser der meisten Referentenentwürfe aufgestiegen. Weshalb eigentlich? Was machten die Minister, was ihre Staatssekretäre? Holstein schrieb dem Kaiser das Protokoll des Tangerbesuches, der auf drängen Bülows zustande gekommen war, viel mehr, auf Betreiben des Legationsrates. Holstein versah die deutsche Delegation mit Vorschlägen zur Lösung der Marokkokrise bei der Algeciras Konferenz. Holstein paraphierte den Björkö-Vertrag, die Vereinbarung zwischen Zar Nikolaus und Kaiser Wilhelm II.. Die Anweisungen für seinen Auftritt in Tanger fand der ahnungslose Kaiser bei seiner Zwischenstation im Hafen von Lissabon vor, auf halbem Wege nach Tanger, als nichts mehr rückgängig zu machen war. Beinahe zeitgleich hatte Holstein das zweiseitige deutsch-russischen Abkommen, den Björkö-Vertrag, entworfen.
Es war sein Jahrzehnt. Die Mittelmächte am Verhandlungstisch im britisch-spanischen Algeciras fanden leicht einen Weg zur Einigung des Westens, wie Nordafrika aufzuteilen war und letztlich zur »Tunikation« Marokkos, anstatt sie zu verhindern. Indessen die deutschen Verhandler beim Abschlussprotokoll am 07. April 1906 leer ausgingen, weil sie, wie Holstein grimmig rügte, sein Exposé missachtet oder es nicht verstanden hatten. Immerhin gaben die kaiserlichen Emissäre den ohne ihren Einspruch ausgehandelten Vertrag für einen Sieg deutscher Diplomatie aus, die öffentliche Meinung, die Presse war anderer Meinung, Holstein auch.
In einem Jahrzehnt hat der Legationsrat praktisch die deutsche Außenpolitik unsichtbar geleitet und gelenkt; er machte Vorschläge, andere brachten sie zur Lesung in den Reichstag. Kein deutscher Ministerialbeamter hat jemals wieder einen solchen Einfluss auf die deutsche und auf die europäische Politik gehabt, den Staatssekretär Meißner 1932 ausgenommen, der zusammen mit dem Sohn Paul von Hindenburgs, den Reichspräsidenten in der Kanzlerfrage beriet. Aber Hindenburg sah sich selbst überhaupt als einen Ersatzkaiser, einen Reichspräsidenten im Wartestand, Platzhalter für die die Wiedergeburt der Monarchie.
Die Betroffenen wussten Bescheid und fingen an, Holstein zu fürchten. Später prahlte Bülow damit, Holstein, der »Aal«, so die unfreundliche aber zutreffende Charakterisierung des Reichskanzlers, durch ein bürokratisches Manöver zu Fall gebracht zu haben. Bis auf einen der Reichskanzler nach Bismarck, mit Hohenlohe-Schillingsfürst, war der »Vortragende Rat« mit allen Regierungschefs lange vor ihrer Amtszeit gut bekannt; befreundet wäre zu viel gesagt. Als Staatssekretär wäre er mit jedem der jeweiligen Kanzler untergegangen. Nicht das Parlament wählte den Kanzler, sondern der Kaiser berief ihn; die Berufung, wie die Entlassung hingen von den Launen des Monarchen ab. Die Staatssekretäre kamen und gingen mit dem neuen Kanzler. Holstein hat stets alles unternommen, die Berufungen zu beeinflussen; so riet er in einem Brief dem Reichkanzler Hohenlohe, keine Personalentscheidung zu treffen, ohne mit ihm, Holstein, Fühlung genommen zu haben. Beiläufig bemerkte Hohenlohe aus ähnlichem Anlass, er sei hier der Reichskanzler, nicht der Kanzleirat. War der erste Nachfolger Bismarcks, Leo Caprivi, so unerfahren, dass er dem Legationsrat vertraute, so war Hohenlohe-Schillingsfürst, ein kluger alter Mann, bemüht, das Ehrgefühl des Geheimrates zu schonen. Im Übrigen ließ er die Dinge laufen, wie es Gott und Majestät gefielen.
Betont werden in den schriftlichen Äußerungen über Holsteins Charakter seine Vorzüge im persönlichen Umgang, einmal von seiner Freundin, Helene von Lebbin, und von seiner alten Haushälterin, einem treuen Faktotum. Die Frauen blieben ihm ergeben, und er ihnen freundlich zugetan. Zu Lebzeiten des Friedrich Karl von Lebbin, er war wie Holstein Vortragender Rat, allerdings im Ministerium des Inneren, standen die Lebbins der Politik Bismarcks zurückhaltend gegenüber, was ihrer Freundschaft zu Holsteins keinen Abbruch tat. Und Freundschaft mit Holstein, das war eine heikle Sache, ein eigen Ding. Er konnte von einem auf den anderen Augenblick alle Beziehungen zu alten Freunden schroff beenden, ohne Gründe zu nennen. Der Titel »graue Eminenz« blieb ihm auch nach seiner Entlassung erhalten; er mag ihm letzten Endes sogar angenehm und grimmig genug in den Ohren geklungen haben. Seine Entfernung aus dem Amt bedeutete nicht, dass die erweiterte Öffentlichkeit, die Diplomaten und die Presse und schließlich die Historiker nachfragten, welche Rolle dieser Mann denn nun eigentlich, über einen so langen Zeitraum von vierzig Jahren gespielt hat, vor der Reichsgründung 1871, und mehr noch danach, bis in das neue Jahrhundert hinein. Holstein hat nie aus dem fragwürdigen Dunst des Beraterstatus in den Glanz eines Botschafterpostens herausgewollt, wohl wissend, dass ihm der Hintergrund fehlte, um als unabhängiger Resident im Ausland auftreten zu können. Dass dem zweiten Mann alle Fehler in der Politik vorgehalten wurden, versteht sich, indessen die Verdienste dem Kanzler zugutekamen. Der kaiserliche Botschafter jener Zeit kam für seine finanziellen Aufwände größtenteils selbst auf. Um zu repräsentieren musste er die Mittel besitzen oder sie sich verschaffen. Meist entstammte er dem Hochadel, oder war zumindest aus alter Familie, einer Beamtendynastie, wurde früh protegiert und ergraute auf verschiedenen Posten im Ausland bis zur ehrenvollen Pension. Abgesehen von den mit diesem Amt verbundenen Leistungen aus Steuermitteln, verfügte der Gesandte über einen oder mehrere Sonderfonds.
Die Reichkanzler, Bismarck, Hohenlohe-Schillingsfürst, Bülow waren zuvor alle Geschäftsträger des Reiches im Ausland gewesen; sie besaßen Erfahrung in der Außenpolitik und vor allem Landeskenntnis. Caprivi bildete die Ausnahme. Jedes Bundesland hatte überdies seinen Botschafter mit kleinem Beraterstab in Berlin; umgekehrt wurde der Botschafter des Bundes am Hauptort des jeweiligen Bundesstaates akkreditiert. Holstein hatte ebenfalls an vielen Städten und Residenzen als Referendar in den Botschaften gewirkt und hätte doch nie den Platz des Botschafters einnehmen können. Aber es ist auch kaum möglich, sich diesen Legationsrat als Botschafter des Kaiserreiches vorzustellen. Er war kein Redner und bei freier Rede gehemmt. Unter Bismarck und seinem Sohn Herbert wurden die Dinge heftig und laut ausgetragen; diese Form, sich an ein zu lösendes Problem heranzureden, heranzuschreien, dürfte dem Legationsrat gelegen haben. Mit konkreten Aufträgen und Direktiven versehen, ging er an die Schreibtischarbeit. Er hinterließ eine enorme Menge Briefe und Konzepte; einen oder mehrere Schreibgehilfen, denen er diktieren konnte, hatte er nicht.
Immer in Nähe der Macht, schließlich von ihr gelenkt und von ihr verdorben, besaß Holstein enorme Sachkenntnis, auf die Bismarck zurückgriff, und sogar die Fähigkeit, sich in die zukünftige Lage hineinzudenken. Er wusste auf der »inneren Iris« im Leben der Diplomatie Bescheid, sammelte Material über die heimlichen Gewohnheiten ihrer Vertreter, ihren Eskapaden, den Liebesaffären, Geschäften und Intrigen, genug, um den einen oder anderen gegebenenfalls auszuschalten. Er war Patriot, ob ein preußischer, ist eher zweifelhaft. Hilfreich bot er die Hand, getreu seinem Beamteneid, wenn es galt: »Schaden vom Reich abzuwenden«. Den Schaden zu erkennen oder ihn zu erkunden, darin lag für Holstein der Reiz seiner Beratertätigkeit. Holstein war ein Vorläufer, wenn auch die geheime Diplomatie keine neue Erscheinung gewesen ist. Schon Friedrich II., der Große, hielt jeden Botschafter für einen verkappten Spion und versicherte sich selbst ihrer Dienste. Es war dies der Brauch. Das Geschäft wird heute von großen durchorganisierten technisch gerüsteten Geheimdiensten besorgt. An der Praxis der Spionage hat sich nichts geändert, alles ist eher schlimmer geworden.
Holstein, der Zurückgesetzte, fand schließlich Gefallen an diesem Spiel, lancierte Botschafter oder trug zu ihrem Sturz bei, sah sich selbst reicher an Einfluss, als er ihn wirklich besessen hatte, verteidigte am Ende mit heftigen Ausbrüchen seine Position, spürend, dass seine Macht dahinschwand. Es waren die anderen, die aus ihm den Gegenspieler der göttlichen Vorsehung machten; sie glaubten an die Macht der Intrige, an die Majestät des Kaisers, als zum System gehörend und tummelten sich im seichten Wasser der Oberflächlichkeiten oder der Faulheit. Eines wird der heutige Leser feststellen, dieser Holstein war eine besessener, ein großartiger Arbeiter; selbst der Staatssekretär Tschirschky räumte ein, dass Holstein einen Berg Akten in kurzer Zeit durcharbeiten und darüber präzise Vortrag halten konnte. Von Freunden, seiner Erfahrungen und Kenntnisse wegen, hoch geachtet, übrigens auch von allen Kanzlern, solange sie ihn brauchten, fingen sie an, ihn zu verleumden und herabzusetzen. Von Feinden war er aus denselben Gründen tief gehasst. Bis hinauf zum Kaiser war sein Ruf gedrungen, unbestechlich zu sein. Wilhelm wusste vom Hörensagen von der Unersetzlichkeit des Legationsrates und hielt die Hand über ihn, aber Kaiser und Kanzleirat haben sich erst nach siebzehn Jahren getroffen und in die Augen gesehen. Sie hatten sich, wie zu erwarten, nichts zu sagen. Es hat etwas Groteskes, wie einfach seine Entfernung aus dem Amt vor sich ging; durch einen Staatssekretär und durch einen Verwaltungsakt. Als Holstein selbst in letzter Stunde das Schriftstück mit seiner Demission suchte, um seine Kündigung zurückzuziehen, weil ihm klar wurde, es könne einmal ernst damit werden, fand sich das Blatt nicht an. Das Dokument war nicht aufzufinden. Der späte, erst der vollendete Friedrich von Holstein kam in Widerspruch zu seinem Leben, zu seinem Lebenswerk, wenn man so will. Redlich hatte er der Monarchie gedient, bis er endlich ihre Entartung erkannte, er starb im Ruhestand am 8. Mai 1909 in seiner Wohnung im Alter von zweiundsiebzig Jahren, von zwei Frauen umgeben, seiner langjährigen Wirtschafterin und der engen Freundin, Helene von Lebbin, der Witwe seines Freundes. Wer war er und wie kam er in diese Machtstellung?
Geboren wurde Holstein am 04. April 1837 in Schwedt an der Oder, verbrachte aber die längste Zeit seines Lebens in Berlin. Häufig war er zuvor auf Reisen, als Referendar in den Botschaften Preußens und des Kaiserreiches in aller Welt. Seltsamerweise aber war der Fachmann für die Außenpolitik nach 1874, mit einer Ausnahme 1881, als er nach Nizza reisen musste, Jahre lang nicht mehr im Ausland gewesen, er entschied alles nach den Berichten der Botschafter oder seiner Vertrauten. Sein Quartier, eine Dreizimmerwohnung in der Großbeerenstraße 40 im Berliner Stadtbezirk Kreuzberg, damals dem sogenannten Geheimratsviertel, hat er nie gewechselt. Es hätte auch nicht zu ihm gepasst, sich eine andere Umgebung zu suchen und das Altgewohnte aufzugeben. Auch sein Dienstzimmer in der Wilhelmstraße, dem Auswärtigen Amt in Nähe der Diensträume des Kanzlers, behielt er bis zu seiner Entlassung. Es gab da eine Verbindungstür zwischen dem Arbeitszimmer Holsteins und dem des Staatssekretärs. Diesen bequemen Weg hat der Legationsrat lange genutzt; er musste nicht über den Flur durch das Vorzimmer gehen, um den Vorgesetzten aufzusuchen. Bis ihn der Staatssekretär von Tschirschky und Bögendorff höflich aber bestimmt ersuchte, gefälligst die Tür über den Flur durch das Vorzimmer zu benutzen, wie jeder andere Besucher. Er meinte, es nicht zu ertragen, dass Holstein zu jeder Zeit in seinem Rücken auftauchen könnte. Die Verbindungstür wurde geschlossen; es war eine Neuerung, die Holstein signalisierte, dass seine Zeit abgelaufen war. Er wehrte sich nur schwach und mit falschen Mitteln gegen seine Zurücksetzung, schrieb seine letzte Demission, weil seine Direktive für die Verhandlungen in Spanien unbeachtet geblieben war. Ein Vorwand? Nicht nur, es war eine Gelegenheit zu gehen, auch wenn Holstein gezögert hat, diesen Schritt zu machen.
Das zweistöckige Gebäude in der alten Berliner Wilhelmstraße, im Neoklassizismus mit ausgebauter Mansarde, war von bescheidener Größe, bedenkt man, welche politischen Entscheidungen hier getroffen wurden. Spätere Regierungen brauchen für ihre Dienststellen größere Häuser und ganze Stadtkomplexe; bei Klausuren besetzen sie mit Presseleuten und Fachberatern modernisierte Schlösser in angenehmer ruhiger Lage und sichern ihre physische Existenz durch Drahtzäune und militärisches Wachpersonal. Ein Kanzlertee ist eine teure Angelegenheit geworden, die Flugreise eines Regierenden verbraucht das Vielfache an Jahreseinkommen eines Durchschnittsmenschen. Jeder neu ins Amt eingeführte Minister bekommt einen Beraterstab und ein Büro. Minister beauftragen fachliche Gutachter, um sich über die Weltlage zu unterrichten und beraten zu lassen. Andere verfassen ihre Reden, Gesetzentwürfe stammen aus der Feder eines Referenten. Um einem anderen Regierungschef die Hand zu drücken, kriegt der Kanzler eine Ehrenkompanie unter Gewehr gestellt; ein Musikkorps bläst die jeweilige Nationalhymne; er oder sie neigt den Kopf. Manche Länder stecken ihre Ehrenkompanien in historische Uniformen mit vergoldeten Helmen und blanker Waffe. Neu an diesen Zeremonien sind die Bruder- und Schwesterküsse der Chefs; gemach, sie sind auch nicht ernst gemeint. Den Staatssekretären ihres Gefolges ist dieses Kussritual erlassen. Daran gemessen ist der Aufwand, den die Kanzler der Kaiserzeit beanspruchten, bescheiden. Holsteins Berater und Informanten waren mit der Einladung zu einem Essen zufrieden, auf spätere Belohnung hoffend. Auf den Fotografien der Kaiserzeit sieht man einen einsamen Mann unter Gewehr, vor dem Eingang des Auswärtigen Amtes stehen oder gelangweilt auf und ab gehen; einer wurde offenbar in normalen Zeiten für ausreichend gehalten, um »Schaden vom Reich abzuwenden«. Gleichwohl sind zwei Anschläge verübt geworden; einer auf den Reichskanzler Bismarck, der nur einen blauen Fleck hinterließ, ein anderer auf den alten Kaiser Wilhelm I., etwas für Preußen, wie für das Reich Neues; auch dies vielleicht nur Nachahmung wie so vieles, Made in Europe oder mehr noch St. Petersburg.
Holsteins Arbeitszimmer im zweiten Obergeschoss war einfach und zweckmäßig möbliert, wenigstens nicht auffallend mit persönlichen Gegenständen ausgestattet. Bismarck meinte, dass man bei Leuten, die zu viel Geld für Möbel ausgeben, immer schlecht essen würde. Guter Wirtschafter, der er war, gab er Geld für Einrichtungen aus und kaufte den Dänen gelegentlich ein ganzes Herzogtum ab, zahlte die Schulden des bayrischen Monarchen, um ihn für die Kaiserwahl Wilhelms zu gewinnen. Ludwig nahm an, und Bismarck aß weiter sprichwörtlich gut, obwohl das Geschäft nicht billig war. Ludwig bat seinen Onkel Wilhelm dringend darum, die Krone aus den Händen seiner fürstlichen Genossen anzunehmen. Was der auch tat, um seinen Verwandten gefällig zu sein.
Regelmäßig um halb acht Uhr früh verließ der Legationsrat, oder der Vortragende Rat im Amt fürs Auswärtige, Friedrich von Holstein seine Wohnung in der Großbeerenstraße 40, ging rüstig um den Anhalter Bahnhof herum, bog in die Wilhelmstraße ab und nahm seinen Arbeitsplatz ein, wo sich auf dem Schreibtisch die Akten gehäuft hatten. Bedenkt man, dass zu jener Zeit alles handschriftlich auszuführen war, dass Kopien als wirkliche Abschriften hergestellt werden mussten, dann haben diese Leute wirklich schwer gearbeitet. Nicht umsonst lernte sogar der Volksschüler einmal wöchentlich die Kunst des »Schönschreibens«! Zwölf Stunden war das Tagespensum Holsteins, angefüllt mit Lesen, mit Nachdenken, mit Entwürfen und Spekulationen, mit Vortrag beim Kanzler oder bei einem Staatssekretär oder auch dem Kabinett. Holsteins Arbeitspensum war sprichwörtlich hoch; vor einundzwanzig Uhr verließ er selten das Amt. Der Dienst endete mit dem Besuch eines noblen Restaurants, vorzugsweise Borchardts oder Hillers, falls er nicht die Einladung zum Essen bei Freunden angenommen hatte, etwa dem des Ehepaares von Lebbin. Der Geheimrat war im Rang mit Holstein gleich, allerdings weniger auf Bismarck eingeschworen als sein Gast. Die Berliner Salons begannen sich in Fraktionen zu teilen, in pro und contra Bismarck. Frau von Lebbin wurde nach dem Tod ihres Mannes, der an Zungenkrebs verstorben war, eine Freundin und ausgleichende Beraterin Holsteins, eine sympathische Person, selbst vom Kanzler Hohenlohe-Schillingsfürst geschätzt, wenn man all den Märchen aus jener Zeit glauben darf. Immerhin soll sich der Fürst von ihr verabschiedet haben, ehe er Berlin für immer verließ. Kritikern schilderte Frau von Lebbin ihren Freund »Fritz« als einen gütigen und vollkommenen Menschen, nobel und zuverlässig und ganz anders, als ihn seine Feinde und die missgünstige Presse beschrieben. Holstein setzte sie als Erbin ein, einem höchst bescheidenen Nachlass; von einer anderen Frau war nie die Rede, und auch diese Beziehung dürfte ausschließlich freundschaftlicher Art gewesen sein. Einen bestimmten Teil seiner Hinterlassenschaft erhielt seine Cousine zu treuen Händen, der die Mappe mit den Dokumenten als Staatseigentum buchstäblich entrissen werden musste.
Mit zunehmendem Alter hatte sich die Sehkraft seiner Augen stark verschlechtert. Holstein litt an Grauem Star, der anscheinend kaum behandelt wurde. Er konnte endlich nur noch unter Benutzung einer Lupe lesen. Die Ärzte jener Zeit entfernten bei Grauem Star die getrübten Linsen ihrer Patienten chirurgisch; das nannte man Starschneiden, es war Routine. Vermittels der Starbrille wurde die Sehkraft verbessert, auf zwei Entfernungen konnte der Staroperierte Umrisse erkennen und sogar lesen. Von seinen Reisen in den Harz, verstärkt nach seiner Pensionierung, hat er jedenfalls regelmäßig Briefe geschrieben, meist an seine Vertraute Frau von Lebbin. Ein guter Beobachter offenbart sich in diesen Briefen. Offizielle Einladungen dieses schon bei Lebzeiten zur Sage gewordenen Mannes gab es viele; nur selten nahm er sie an. Mit der Ausrede, er verfüge nicht über die standesgemäße Kleidung, nicht mal über einen Frack, sondern nur über zwei Straßenanzüge, einen schlechten für den Alltag und einen guten für Feiertage, hielt er sich aus dem gesellschaftlichen Treiben heraus. Bei Einladungen war üblicherweise die Garderobe vorgeschrieben und kleinlich geregelt. Je nach Art der Veranstaltung glichen die Geladenen, Gästen eines Kostümfestes. Nicht nur das Kaiserreich war dem Kleiderkult erlegen; man lese bei Ludwig Renn »Adel im Untergang« nach, unter welchem Zwang die Dresdener Hofetikette stand.