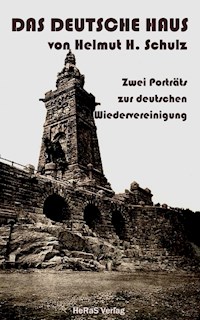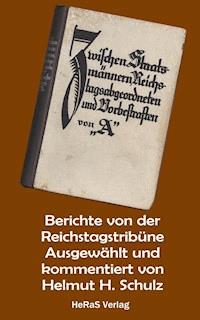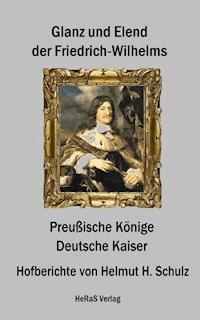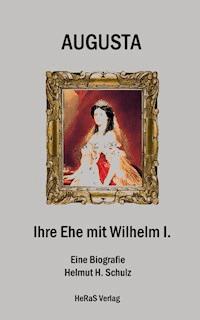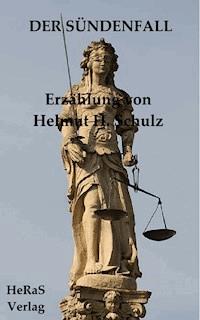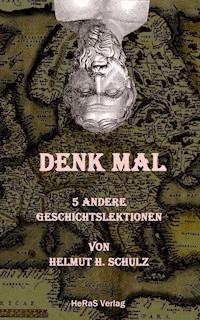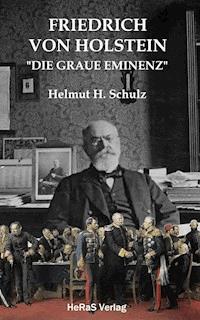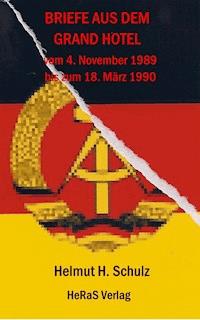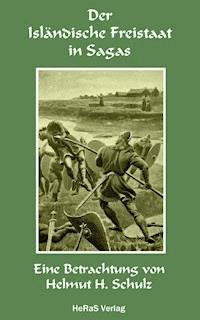Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer daran glaubt, dass Geschichte von Menschen gemacht wird, dem wird mit diesen nicht-chronologischen Streifzügen womöglich das zwiespältige Gefühl geboten, das uns beschleicht, wenn wir meinen, es hätte besser gemacht werden können. Diese vorletzte Kaiserin war eine bemerkenswert starke Frau, im Guten wie im bösen, eine große Hasserin, und eine der auffallendsten Persönlichkeiten unter den aussterbenden Monarchinnen. Bis in die letzten Stunden ihres sterbenden Gatten hinein blieb sie in jedem Zoll: Kaiserin Friedrich Wilhelm, Royal Princess Victoria. Und sie fühlte sich um den Glanz betrogen, denn hundert Tage Kaiserin sind etwas mager, angesichts einer so langen Wartezeit. Als das Ziel erreicht war, dauerte es nur etwas mehr als drei Monate, genau solange wie Friedrich als deutscher Kaiser auf dem Thron mehr dahinsiechte als regierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut H. Schulz
Victoria
100 Tage Kaiserin
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
LEBENSDATEN
VORREDE
DIE KENSINGTON BANDE
DIE ÄRA MELBOURNE
DIE DEUTSCHE REISE
HEIMLICHE VERLOBUNG
ZWISCHEN DEN SALONLÖWEN
DAS SIEBENJÄHRIGE INTERIM
DIE ENGLISCH-PREUßISCHE HEIRAT
BERLINER REMINISZENZEN
HOFFNUNG UND WIRKLICHKEIT
ZWISCHEN GEWINN UND VERLUST
AUF DEM WEGE ZUR 100 TAGE KAISERIN
DAS JAHR 1887
DER KAISER STIRBT, ES LEBE DER KAISER
DAS ENDE ODER SCHLOSS FRIEDRICHSHOF
DER ANDERE TAG
KRONBERG
EULENBURG
FAMILIENBANDE
DIE LETZTEN TAGE
Impressum neobooks
LEBENSDATEN
Victoria Adelaide Mary Louisa, Prinzessin von
Großbritannien und Irland
*21.11.1840 in London, † 5.8.1901 Schloss Friedrichshof
in Kronberg im Taunus
EHESCHLIEßUNG
25.1.1858 mit Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen
* 18.10.1831 in Potsdam, †15.6.1888 im Neuen Palais bei Potsdam
NACHKOMMEN
Wilhelm, der spätere Kaiser *27.1.1859, † 4.6.1941
Charlotte *24.7.1860, † 1.10.1919
Heinrich *14.8.1862, † 20.4.1929
Sigismund *15.9.1864, † 18.6.1866
Viktoria *12.4.1866, † 13.11.1929
Woldemar *10.2.1868, † 27.3.1879
Sophie *14.6.1870, † 13.1.1932
Margarethe *22.4.1872, † 22.1.1954
VORREDE
Diejenigen, die sich mit ihrer Person biografisch beschäftigt haben, und sie also genau kennen, sind voll des Lobes für die Royal Princess Victoria. Sie war klüger (intellektueller!) als ihre Mutter, die Queen Victoria, und sie war schöner. Eigensinn und entschieden politische Ambitionen werden ihr nachgerühmt oder angekreidet. Politische Ambitionen besaßen Männer, kraft ihres Amtes und Geschlechtes mehr oder minder. Daher versteht es sich nicht ganz von selbst, dass die Royal Princess, die preußische Kronprinzessin, dank ihres Gatten Friedrich, und Deutsche Kaiserin ein wenig zu viel in die Politik hineinpfuschte. Denn wie ihr Vater Albert, ein deutscher Fürst, als Gatte Queen Victorias keinen Anspruch auf einen eigenen politischen Entscheidungsraum erheben durfte, so war Vicky, wie ihr Kosename lautete, am preußisch-deutschen Königs- und späterem Kaiserhof nichts anderes, als die Frau eines Prinzen, immerhin Königin von Preußen und in Personalunion, sehr spät und nur kurze Zeit, Kaiserin von Deutschland, für neunundneunzig kurze Tage, ohne Einfluss und ohne Macht. Ohne Einfluss? Wir werden sehen, ob sie welchen hatte.
Vergleicht man die Fotografien aus jener Zeit, als die Lichtbildnerei schon so weit entwickelt war, dass die gestochen scharfen Bilder bis heute recht gut erhalten geblieben sind, dann ist die Familienähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter so erfreulich wie bestürzend groß. Die Queen Mother (ein Begriff, der hier nicht ganz zutreffend und bloß locker angewendet wird, denn Vicky war nicht die Thronfolgerin und nie Königin von England) soll körperlich sogar etwas größer als die Tochter gewesen sein. Es könnte sich nur um Zentimeter bei der einen oder der anderen gehandelt haben; klein waren Mutter und Tochter, dick nur die Mutter, jedenfalls soweit wir der Überlieferung trauen dürfen. Nichts kann so täuschen, wie ein Foto, zu schweigen von in Öl gefertigten Malereien. Auf Bildern mit ihrem Gatten, dem Prinzen von Preußen und 99-Tage-Kaiser, wirkt Victoria in der Tat klein neben einem großgewachsenen Mann, was irreführen kann, aber die Aufnahmen stammen aus den Tagen, als das Paar noch gut beisammen, bei guter Laune, einträchtig miteinander lebte.
Nun ist immer Vorsicht geboten, wenn euphorische oder abwertende Urteile über irgendeine Persönlichkeit öffentlichen Interesses von Zeitzeugen aus dem Lager der Proselyten wie der Gegner überliefert werden. Die Tochter der englischen Königin hat auf allen Fotos ein angenehmes Gesicht, mit ruhigen Zügen; still waren die Gesichter auf den Bildern der Fotografen jener Tage immer, und auch wir hätten still und bedeutend geblickt, weil die Belichtungszeiten lange dauerten und niemand dazu gebracht werden kann, zehn Minuten auf ein und dieselbe Weise zu grimassieren. So harmonisch und bescheiden wie auf ihren Konterfeis ist diese Dame von der Insel indessen nicht gewesen. Das hatte sie auch nicht nötig, sie konnte sich auf eine alte und glanzvolle Monarchie berufen, die sich beträchtlich von dem spät-feudalen Preußen, wie dem Bonapartismus Napoleon III. unterschied, wenngleich ihre Mutter aus einer Nebenlinie ins Königtum aufstieg. Aber sie war so fruchtbar wie ihre Mutter, die Kinder nicht sehr liebte, und vor allem die Schwangerschaften verabscheute, sich gleichwohl aber mit einer ungeheuer großen Schar Kinder, Enkel und Urenkel herumplagen musste. Auf einem Altersbild hält die Queen Victoria den kleinen deutschen Kaiser Wilhelm II., ihr Enkelchen, mehr von sich ab als auf den Knien. Sie sieht verstört aus, so als ahne sie, was der junge Mensch auf ihrem Schoß alles anrichten wird. Mister Willy, wie ihn die englische Sippschaft neckend rief, bis man spinnefeind wurde, hat seiner Großmutter auch wenig Freude gemacht und seinerseits alles gehasst, was englisch war, an anderen und an sich selbst.
Royal Princess Victoria beschenkte die Deutschen reichlich mit Mischlingen zweierlei Geschlechtes aus deutschem Fürstenstamm und englischer Königsfamilie, und sie brachte eine erbliches Leiden in diese Linien hinein, die Bluterkrankheit. Mit ihrer Mutter blieb sie lebenslang innig verbunden, obschon diese Vertrautheit nicht immer gleich groß gewesen ist, und erst mit der Entfernung von Osborne, Windsor, Balmoral und dem weitläufigen Buckingham Palast wuchs. Mit einer anderen, ihre Schwiegermutter Augusta, verstand sie sich dagegen immer gut, als Schwester im Geiste; letztere nahm die zweite Stelle in der weiblichen Rangfolge ihrer weiblichen Vorlieben ein, möchte man nach einem Blick auf die verwandtschaftlichen Liebeslieder und Hassgesänge denken. Mit Queen Mother wechselte Victoria weit über viertausend Briefe, meist banalen, gelegentlich politischen Inhalts; oft beides. Gemeinschaftlich mit ihrer Schwiegermutter verabscheute sie Bismarck, hätte ihn gern gestürzt, womöglich teeren und federn lassen, und wie Augusta hungerte sie nach realer Macht, im Hause und im Staate. Bis in die letzten Stunden ihres sterbenden Gatten hinein blieb sie in jedem Zoll: Kaiserin Friedrich Wilhelm, Royal Princess Victoria. Und sie fühlte sich um den Glanz betrogen; ihr Zustand: 99-Tage-Kaiserin, ist etwas mager, angesichts einer so langen Wartezeit. Als das Ziel erreicht war, dauerte es nur etwas mehr als drei Monate, genauso lange wie Friedrich als deutscher Kaiser auf dem Thron mehr dahinsiechte als regierte.
Victoria Royal Princess ist jedenfalls eine bemerkenswerte Person, wie bald erfährt, wer sich mit ihrem Dasein beschäftigt, und wer die besondere Lage einer englischen Prinzessin im werdenden Deutschland Bismarcks bedenkt. 1871, nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich, hat sie sich selbst begeistert als Preußin bezeichnet, ohne es ganz zu sein. Tiefer gehende Begeisterung mag ihrem Temperament nicht ganz fremd gewesen sein, andererseits aber wollte ihre kühlere Veranlagung etwas mehr haben, als den bloßen Aufruhr der Gefühle. Auch ihr Vater konnte kein ganzer Engländer, sondern nur der Gemahl seiner Frau, der Königin von England, werden und es bleiben. Whigs wie Tories wachten mit Argusaugen darüber, dass dem Prinzgemahl Albert nicht unter der Hand Macht zugeschoben wurde, die ihm verfassungsmäßig nicht zustand. Er starb früh, hinterließ eine noch junge Witwe und eine helle Schar von Kindern, aber im Falle seiner Tochter passte anscheinend die Hälfte des englischen Temperamentes mit dem träumerischen deutschen Phlegma ganz nett zusammen; jedenfalls haben sich beide englischen Frauen nie über ihre deutschen Männer beklagt. Albert und Friedrich III., hierin verglichen und nebeneinander gestellt, mögen ihre charakterstarken Frauen bewundert haben. Dazu hatten sie auch allen Grund. Die Queen Victoria sucht an Unerschrockenheit ihresgleichen; die zahlreichen auf sie abgefeuerten Pistolenkugeln pflegte sie mit Gleichmut hinzunehmen, und sich durch kein Attentat aus der Ruhe bringen oder von ihrem Tagewerk abbringen zu lassen. Ihre Tochter wird ihr ähnlich gewesen sein, obschon von einem Attentat auf sie keine Nachricht auf uns gekommen ist. Die Gatten der englischen Damen waren beide körperlich stattlich und wohlgebaut. Nicht als ob man dergleichen nicht auch in England hätte finden können, von den dynastischen Fragen einmal abgesehen. Da wir im Folgenden die Familie unserer englischen Prinzessin aus königlichem Blut näher beleuchten wollen, bekommen wir es immer wieder mit zwei Gattungen Politiker zu tun, den Whigs und den Tories, und wollen zu Anfang klären, dass sich diejenigen, die man heute gelegentlich, als der einen oder der anderen Partei zugerechnet in der Presse serviert bekommt, von den Ursprüngen dieser Parteien weit entfernt sind. Unter einem Tory verstand man in der englischen Parlamentsaristokratie ursprünglich einen Anhänger des royalistischen Legitimismus, also einen Katholiken oder einen dem Katholizismus nicht allzu fern stehenden Mann. Heute sind Tories demzufolge Konservative, Royalisten im Rahmen der Verfassungsrealität, und dürfen auch noch Katholiken sein, was sie damals eher abgestempelt hätte. Das Wort Tory selber soll irischer Abkunft sein; schließlich wurden die Tories infolge der Thronbesteigung eines Hannoveraners aus dem öffentlichen Leben in England, das heißt, aus der Politik, verdrängt und machten den Whigs Platz; seit 1774 waren dann wieder die Tories Platzhalter, die breite Schicht des Landadels, die country gentlemen. Irgendwie entwickelte sich aus dem losen Verein dieser country gentlemen über etliche Stationen Geschichte komplizierterer Art die moderne Konservative Partei des Inselreiches. Deshalb darf sich ein Premier solcher Abstammung, wenn er ins Amt kommt, auch als ein Tory bezeichnen, wenn er es will oder als Whig, wenn ihm das besser passt.
Als ein ordentlicher Whig galt in der Revolutionszeit Englands nur ein strenger Presbyterianer, der das Widerstandsrecht gegen königliche Willkür vertrat. Solche Herrschaften machten 1688 und 1689 die Glorreiche Revolution. Zugleich war ein Whig unter Umständen noch bigotter als ein Katholik, Papist genannt, und wirtschaftete mit Feuer und Folter nicht weniger als die päpstliche Inquisition. Whigs waren immerhin die führende Partei unter den Hannoveranern, verloren jedoch an Einfluss gegen die Tories. Diese hatten noch Gelegenheit zu einer Parlamentsreform, indessen sich die Whigs zur Liberalen Partei mauserten. Die englische Parlaments- und Revolutionsgeschichte steht auf diesen beiden ehernen Säulen, Tory und Whig.
Wer in solchen Kategorien im alten England zu denken beginnt, wem der Kampf des Parlamentes mit der Krone und umgekehrt sozusagen als ein historisches Vermächtnis in die Wiege gelegt wird, der muss einige Schwierigkeiten bekommen, wenn er in einem politisch gemäßigteren Klima in einem wirtschaftlich rückständigen Landstrich auf einen ständischen Provinzial-Landtag oder auf ein preußisches Herrenhaus trifft. Dies geschah sowohl der Königin Augusta wie ihrer Schwiegertochter Vicky. Aber beginnen wir mit dem Lebensanfang nicht der Tories und Whigs, sondern der Victoria, der Kaiserin Friedrich.
osborne house
Die Ärzte hatten sich geirrt, als sie den Termin der Geburt Victorias auf den Tag festlegten. Das Kind erschien ein wenig zu früh und das kam so: Eines Nachts vor der fristgemäßen Geburt fühlte sich die Queen Victoria unwohl, und der Gatte Albert zog in Anbetracht aller Umstände den Schluss, die Geburt könne auch unvorschriftsmäßig früher beginnen, wie dergleichen schon vorgekommen. Er rief allerlei Personal, Hebammen, Ärzte und Gynäkologen zusammen, mit deren Hilfe denn auch ein Kind weiblichen Geschlechts unter die Menschen, das heißt, unter die Monarchen, geholt wurde. Die Royal Princess Victoria kam 1840 zur Welt, am 21. November, 02:00 p.m. (14 Uhr) und auf die bedauernde Einlassung einer Hofschranze: O, Madam, es ist eine Prinzessin, antwortete die Königin und junge Mutter: Macht nichts, das nächste Mal wird es ein Prinz.
Queen Victoria ist 1819 geboren, sie war also bei der Geburt ihres ersten Kindes 21 Jahre alt, und es ist ein sonderbarer Zufall, dass Mutter und Tochter im gleichen Jahr sterben sollten, 1901, nur dass die Mutter erheblich mehr an Jahren erreicht hat, als ihre Tochter. Ganz verständlich ist der Aufschrei der Hofschranzen indessen nicht, und die Antwort der jungen Mutter ohne politischen Hintergrund, denn die englische Verfassung schloss weibliche Personen von der Thronfolge nicht prinzipiell aus, und dass es sich bei der jungen Frühgeburt um eine echte Prinzessin handelte, die unter Umständen zur Kronprätendentin avancieren konnte, falls sich kein anderer Erbe dazwischenschieben würde, daran war nach Lage der Dinge keinerlei Zweifel. Ferner wird man der Bemerkung Victorias, bei der nächsten Schwangerschaft erfolgreicher zu sein, nicht vollständig trauen dürfen. Als nämlich der belgische König, ihr leiblicher Onkel Leopold, von dem noch die Rede sein wird, getreu altüberkommener Vorstellungen von Mutterschaft etliches Gefühlvolles bei Gelegenheit der Geburt Vickys an seine Nichte schrieb, fertigte ihn die Queen Victoria überlegen ab: Männer denken nie oder selten daran, was für ein hartes Los es für eine Frau bedeutet, dergleichen sehr oft durchzumachen. Aber Gottes Wille geschehe, und wenn Er befindet, dass wir eine große Zahl von Kindern haben sollen, dann müssen wir eben versuchen, sie als nützliche und vorbildliche Mitglieder der Gesellschaft aufzuziehen. Das war brav gedacht und ein bisschen räsonable und fatalistisch.
Vor der Hand aber nutzte die jugendliche Mutter die neue Lage politisch aus. Stockmar, einer ihrer ältesten Vertrauten, der auch den Prinzgemahl, so sein offizieller Titel in England, beriet, musste Lord Melbourne, auch ein Vertrauter und sogar Premier, darum bitten, zu veranlassen, dass Albert künftig in die Bittgebete der englischen Staatskirche eingeschlossen werde. Bei den Gottesdiensten wurde regelmäßig für das persönliche Glück der Monarchin gebetet, nicht nur in England, sondern überall, wo es Kaiser und Könige gab, ausgenommen Frankreich. Dort lag es nach der Trennung von Staat und Kirche im Ermessen des Priesters, etwa einen Bürgerkönig unter den Sonderschutz Gottes zu stellen. Das ist insofern logisch, als jener nicht durch Gottes Gnade als König amtierte, sondern im Auftrage von Börsenspekulanten und Bankiers. Es war Victoria bisher nicht gelungen, das englische Vorurteil gegen den Deutschen abzubauen. Umgekehrt sollte sich dasselbe in Deutschland wiederholen, als ihre eben geborene Tochter im achtzehnten Lebensjahr nach Berlin und Potsdam umzog. Dass Albert nunmehr und fortan bei den Bittgottesdiensten der Kirche, einer mächtigen offiziellen Institution, als ein zu schützender englischer Besitz mitgenannt werden würde, hieß seine und ihre Stellung ganz erheblich aufzuwerten. Noch etwas scheint durch die Geburt der Tochter beschleunigt worden zu sein, die ganz private Lage des Paares.
Die erste Zeit ihrer Ehe mussten Albert und Victoria aus Staats- und Standesgründen in und um London verbringen. Bei der Planung ihrer Verbindung hatte die junge englische Königin ihrem künftigen Ehemann die Grenze deutlich gezogen. Dass er sich den Staatsinteressen zu unterwerfen hatte, an die sie gebunden war, brachte Albert manch bittere Erkenntnis. Ihm war durch die Verfassung eine zweite Reihe angewiesen, aber auch seine Frau wollte sich zwar dem Gatten, nicht aber einem gleichberechtigten Mann unterwerfen. Die Gründe für ihre Haltung lagen nicht ausschließlich in der Politik und nicht einmal in ihrem Charakter; sie hatte in ihrer Jugend eine harte Lehrzeit durchgemacht und wollte sich künftig von jeder Vormundschaft frei halten. Mit ihrem Deutschen hatte sie einfach Glück. Albert strebte auf eine ganz andere Art nach Einfluss, als die in England übliche, so kam das Paar schließlich einigermaßen miteinander aus. Der junge Ehemann hatte sich eigentlich eine mehrmonatige Hochzeitsreise vorgestellt, allein Victoria hielt ihre Anwesenheit in England, das heißt, in der Nähe Londons durchaus für erforderlich, und so musste er verzichten. Die Stellung des jungen Habenichts aus Deutschland war innerhalb der englischen Machtstrukturen keineswegs gefestigt. Er war nichts anderes, als der Gatte ihrer Königin, mit sehr geringen Ansprüchen politischer wie finanzieller Art. Er wünschte sich einen besonderen Landsitz, ein Haus, nur ihm und ihr gehörend, aber nach reichlich zwei Jahren Ehe wohnten sie sozusagen noch immer zur Miete. Schlösser gab es genug; die Krone verfügte über ausreichend ungenutzte Häuser, aber die gehörten nicht allein der Queen und dem Prinzgemahl, sondern allen Angehörigen der Familie, und der amtierende Herrscher verfügte zusammen mit Regierung und Parlament über das Wohnrecht darin wie über die meist sehr hohen Mittel zur Unterhaltung und zur Instandsetzung. Schlössern scheint überhaupt eine gleichsam angeborene Neigung zur Ruinenbildung innezuwohnen. Dergleichen Wohnungsnot war im 19. Jahrhundert Normalfall; auch Prinz und Prinzessin von Preußen, die späteren Schwiegereltern Vickys, erbettelten sich eigene Häuser, obgleich genügend Quartiere vorhanden gewesen wären. Letztere wohnten im Potsdamer Kavaliershaus kurz nach der Eheschließung und sogar nach der Geburt des Thronfolgers beengt und wenig komfortabel, auch nach damaligen Begriffen. Erst mit dem Hinweis, nun eine richtige Familie zu sein, hatte Wilhelm seinen Vater zur Herausgabe der Mittel bewegen können, sich ein, nein gleich zwei Häuser zu bauen, eins Unter den Linden, das andere in Babelsberg. 1840 war letzteres Gebäude zwar nicht ganz fertig, aber im Wesentlichen nach englischem Muster im Tudorstil errichtet worden.
Nach der Geburt Victorias setzten die Eltern also das Projekt eines eigenen Sitzes auf die Liste ihrer Probleme. Politisch war die Gelegenheit günstig, denn inzwischen war Sir Robert Peel Premierminister geworden, was nicht nur einen Regierungswechsel bedeutete, und an diesen Menschen wendete sich Albert mit der Bitte, für sie ein geeignetes Anwesen zu suchen. Peel war in der Tat der rechte Mann für solch einen Auftrag; mehr Makler als Politiker, mit allen Wassern der Börse und der Bankmanipulationen gewaschen, ein reicher und rücksichtsloser Gentleman. Der Weg zu einem Grundstücksmakler verbot sich, Albert war mit englischen Krämergeschäften doch schon soweit vertraut, dass er befürchtete, der Preis für ein annehmbares Quartier würde in die Höhe schnellen, wenn der Name und Stand des Kaufinteressenten ruchbar werde. Peel war nicht nur der richtige Mann für diskrete Geschäfte, er musste sich überdies auch als nützlich erweisen, wenn er als Premier ein längeres und auch ein leichteres Leben haben wollte. Das hing zwar nicht nur von der Queen ab, aber ihr Wohlwollen konnte dies und das aus dem Weg räumen. Der kluge Mann baute vor. Victoria hatte ursprünglich nicht einmal mit Peel reden wollen, weil sie ihn für einen Whig hielt, und nach dem sie bei einem Tory, also dem Gegenpart, das Einmaleins der Macht, gerade soweit sie es ausüben durfte, gelernt zu haben meinte. Sie hat immer mehr nach ihrem Gefühl geurteilt, als ihrem Verstand zu vertrauen, und ihr Gefühl riet ihr häufig richtig, was nicht ausschließt, andere Entscheidungen hätten bessere Früchte getragen. Übrigens schwammen weder die Königin, noch Prinz Albert im Geld. Letzterer war wie gesagt bloß ein armer Schlucker, dem das Parlament Ihrer Majestät die Apanage auch noch erheblich kürzte, zum Ärger der Queen, die ein höheres Jahresgehalt für ihren Gatten vorgeschlagen hatte, als dann wirklich bewilligt wurde. Allein solche Gelegenheiten, die Muskeln spielen zu lassen, ließ sich keine Regierung entgehen, keine englische wenigstens. Das Parlament strich also das Gehalt des Prinzgemahls unter dem Vorwand der Sparsamkeit erheblich zusammen. Bis heute ist freilich noch kein bankrotter Staat jemals durch Sparsamkeit saniert worden, sondern eher ruiniert. Immerhin konnte Albert jährlich etwa 30 Tsd. Pfund Sterling einkassieren. Queen Victoria, die eine haushälterische Königin, und keine ganz schlechte Geschäftsfrau gewesen ist, und erheblich besser bezahlt wurde als er, steckte mit all ihren Konten dennoch in den roten Zahlen. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, die riesigen Schulden ihres verschwenderischen Vaters abzuzahlen, kam aber damit nicht so bald zu Rande, wie sie wohl gedacht haben mag. Andererseits aber wollte die Queen ein anzukaufendes Schloss, Landhaus oder was sich sonst passendes bot, selbst aus ihrer Schatulle bezahlen. Vielmehr blieb ihr kaum etwas anderes übrig. Seit ihrer Inthronisierung, die mit einem ungeheuren Aufwand inszeniert worden war, lag sie dem Staat mit Geldforderungen auf der Tasche. Aus guten Gründen vermied sie den neuerlichen Kraftakt mit ihrem Parlament. Stockmar, ein Deutscher, der englische Politik und Gewohnheiten seit langem sehr genau kannte, hatte schon dem Prinzgemahl Albert bei seinem Eintreffen in England dringend geraten, keine zu hohen Geldforderungen zu stellen. Das hat Albert auch nicht getan, es wäre nur eine nutzlose Plänkelei mit der Regierung Ihrer Majestät dabei herausgekommen, mit einer sicheren Niederlage für das königliche Paar. Auf dergleichen Entscheidungen hatte Victoria keinen Einfluss, sie konnte vorschlagen, aber nicht befehlen.
Beinahe fünfzig Jahre später sehen wir die alte Queen nunmehr auf der Höhe ihrer Macht und ihres Reichtums die beschwerliche Reise nach Berlin antreten, um nichts geringeres, als ihrer Tochter zu raten, sich beim Tode ihres Gatten ein anständiges Witwengeld zusichern zu lassen. Sie war immer noch die genaue alte Buchhalterin, die streng nach dem verlorenen Pfennig ahndete, und ihre Tochter unterschied sich darin wenig von ihrer Mutter. Wir kommen darauf zurück, wenn wir das Jahr 1888 erreicht haben.
Inzwischen war ein dem Paar zusagendes Objekt gefunden worden. Peel, der sich mit der Vermittlung des Ankaufes zweier Grundstücke auf der Insel Wight um die Königin und den Prinzgemahl verdient machen wollte, brachte das Wunder der Diskretion zustande, den Ankauf heimlich, ohne Spekulanten abwickeln zu lassen. Niemand, der Interesse an einem hohen Preis hätte haben können, erfuhr von den Besprechungen mit verschiedenen Eigentümern. Verhandelt wurde um Osborne House, auf der Kanalinsel Wight, die durch ein mildes, fast subtropisches Klima ausgezeichnet ist. Der Golfstrom aus der Karibik umspült die Insel im Süden, ehe er seinen Weg nach Norden, entlang der norwegischen Küste fortsetzt. Isle of Wight ist eigentlich nur ein Inselchen von 36 km Länge und kaum 20 km Breite; es besteht im nördlichen Teil aus Kreidefelsen, am Southampton Water, einer weit geschwungenen Meeresbucht. Hier ist das Klima etwas rauer, im Ganzen aber hat die Insel Seeklima mit milden feuchten Wintern und milden feuchten Sommern. Die Südküste erinnert an eine mediterrane Meereslandschaft, Palmen und Zitronenbäume gediehen überraschend ohne Schwierigkeiten. Hier liegen einige berühmte alte Seebäder; vor allem die Stadt Cowes erlangte eine gewisse Berühmtheit, wie wir sehen werden. An Solent und Spithead, zwei Meeresarme im Norden der Insel, wurde schon damals in den anliegenden Ortschaften viel und gern gekurt. Wight hat sogar eine Hauptstadt, besser gesagt einen Hauptort: Newport. Da man sich auch während des Winterhalbjahres hier wie im Süden fühlen durfte, zog die kleine Kanalinsel natürlich reiche Nichtstuer an, die Gentlemen der neuen Klasse. Angekauft wurden mit dem Haus etwa 400 Hektar Land für rund 26 Tsd. Pfund. Das soll nur sechseinhalb Prozent des königlichen Jahreseinkommens beansprucht haben, meinen die Rechner unter den Historikern. Die Einkünfte, die der Königin durch ihre Regierung und das Parlament zugestanden wurden, werden über den Daumen gepeilt beiläufig um 400 Tsd. Pfund betragen haben. Wer Lust hat, mag selber Spekulationen anstellen; wir reichen nur mehr oder weniger gut Recherchiertes und sich manchmal auch Widersprechendes aus alter Zeit mit aller Vorsicht weiter.
Ein gutes Geschäft war der Kauf nicht, denn der notwendige Umbau von Osborne House sollte ein Mehrfaches der Ankaufsumme verschlingen. Das Paar verliebte sich aber in die Landschaft und in die See. Überdies war London per Fähre und ab der Eisenbahnstation Southampton leicht und schnell zu erreichen. Diese Mitteilungen wären ohne allen Wert, würde sich mit dem späteren Schloss nicht vielerlei verbinden, Politisches wie Privates. Hier schlug die Queen einen ihrer Alterssitze auf, und wer sie besuchen wollte, musste entweder nach Balmoral oder auf die Insel Wight, immer zu den passenden Jahreszeiten. Auf Balmoral in Schottland kommen wir gleich. Mister Willy zumal hielt sich als Kind, wie als Heranwachsender aus besonderen Gründen in Osborne House auf, er verstand es sogar seine Großmutter durch Unpünktlichkeit und Ungezogenheit zu verärgern, und er frönte dem Segelsport seines Onkels Eduard, dessen Name sich mit Cowes auf Wight eng verbinden sollte. Der Prinzgemahl, der alle Entwürfe für den Umbau des Hauses selbst gemacht haben soll, pflanzte seinen deutschen Geschmack mit ein. Man befand sich überhaupt in einer Gesellschaft von Ästheten; auch Augusta ließ sich bei den Neubauten ihrer Häuser wie bei der Innendekoration durch englische Vorbilder mit inspirieren und studierte die Zeichnungen, nach denen in England gebaut, vielmehr umgebaut wurde, wie sich Albert der kontinentalen Architektur annahm.
Wir befinden uns im Zeitalter der Schwärmerei für das Mittelalter; in Deutschland wurden in Renaissance-Schlösser romanische Kirchen eingebaut und zur Unterhaltung genutzt, wie etwa in Babelsberg. Gotisches Schmuckwerk kam reichlich, überreichlich auf. In England hatte sich die Gotik im Tudor-Stil eine eigene Gestalt gegeben. Es handelt sich also um eine deutsch-englische Schwärmerei, an der vielleicht Albert den höheren Anteil gehabt hat. Augusta hinterließ wie gesagt den Preußen in Babelsberg das Schloss solchen Stiles und den achteckigen Turm nach englischem Geschmack, beziehungsweise ohne jeden Geschmack. Osborne aber war für Victoria reine und friedvolle Natur, war endlich die Freiheit und Ungezwungenheit, die sie einst erträumt hatte; hier konnte sie zum ersten Mal in ihrem Leben in der offenen See baden, was damals für eine Kühnheit und einen Luxus ohnegleichen erachtet wurde. Den Kindern - als der Umbau endlich abgeschlossen war, hatten sich einige weitere eingestellt - wurde an Ungebundenheit mehr geboten, als sie sonst in Buckingham und Windsor bekommen hätten. Vater Albert ließ sogar ein Fertighaus vom Festland importieren, das Schweizerhaus hieß. Fertighäuser sind also auch nichts ganz Neues.
Vom Grundstück aus führte eine Treppe bis hinunter ins Meer; und vermittels einer der aufgekommenen Badekabinen konnten sich alle aus- und umziehen, ungestört und unbeobachtet baden und schwimmen. Schwimmen weniger; die Queen wenigstens hat es nicht mehr gelernt, badete aber sehr gern, was schon merkwürdig genug ist. Für die Kinder muss Osborne ein Paradies gewesen sein. Was die kleine Vicky nicht wissen konnte, wissen wir, und weil es nicht ohne Bedeutung für ihr späteres königliches Dasein ist, beschäftigen wir uns ein klein wenig mit den anstehenden Fragen englischer Innenpolitik.
Dass Regierung und Parlament mit höchster Aufmerksamkeit über die Wahrung ihrer Rechte gegenüber der Krone wachten, ist bei einem Ausländer an der Seite der amtierenden Monarchin verständlich. Jahrhundertelang ging es bei den inneren Kämpfen des Inselstaates darum, wie viele Rechte der Krone, wie viele dem Parlament, wie viel der Regierung zugeteilt werden sollten. Dass der angeheiratete Prinz Albert sich an die Verhältnisse anzupassen versuchte, ohne eine Änderung seiner Rolle anzustreben, wurde von den misstrauischen Politikern bald erkannt und auch anerkannt. Politische Rechte hatte Albert vorerst nicht, einen Titel aber besaß er, er war offiziell Herzog. Dieser Prinzgemahl wusste in den Jahren nach der Geburt seiner ersten Tochter aus dem Mangel an Titel und Macht einen großen Vorteil zu ziehen, war er doch von keiner Gewalt, von keiner Partei abhängig. Bei einer drohenden Staatskrise 1841, dem Wechsel in der Macht von Melbourne auf Peel, erwarteten Tories und Whigs einen Zusammenstoß zwischen der Queen und der Administration. Melbourne war der enge Vertraute Victorias gewesen. Mit Peel wollte sie nicht zusammenarbeiten. Albert hatte dem Land einen Regierungskonflikt offenbar zu ersparen gewusst, indem er mäßigend auf die reizbare Queen einwirkte, die sich oft genug starrköpfig benahm. So wenigstens sahen es die englischen Politiker; und der Prinzgemahl wäre auch durchaus in der Lage gewesen, ihre Geschäftsgänge durcheinander zu bringen. Was für diesen Deutschen sprach, er war vernünftigem Rat zugänglich, den Stockmar jederzeit freigiebig aus dem Ärmel zog. Victoria war eine Whig, die neue Regierung bestand aus Tories. Ganz rein lassen sich die Parteilinien aber nicht darstellen; auch Lord Melbourne, Peels Vorgänger, war ein Whig, dessen Sozialpolitik allerdings einige Züge der Tories besessen oder angenommen hatte. Dennoch betrieb Melbourne andererseits eine harte Arbeiterpolitik; einige der berüchtigtsten Urteile, die an rebellierenden Proletariern vollstreckt wurden, hat er zu verantworten. Mit Peel vollzog sich also, an den damaligen Umständen gemessen, eine Wende zu den fortschrittlicheren Tories. Man wird sich den Zug zu pragmatischen Entscheidungen, wie ihn die beiden klassischen Parteien praktiziert haben, gut merken müssen, will man nicht zu Fehleinschätzungen kommen: Weder Tories noch Whigs ließen sich durch Grundsätze behindern.
Die Queen stand ursprünglich und zu dem fraglichen Zeitpunkt 1841 noch ganz im Banne der Whigs, und so wäre ein Konflikt zwischen Krone und Regierung zumindest nicht völlig auszuschließen gewesen. Peel hat in dieser Lage gern seine Dienste angeboten, wie auch später, als Balmoral, das nächste Schloss, angemietet wurde. Balmoral liegt in Schottland, und es durfte als eine wahre Sensation gelten, dass sich Queen Victoria dieses Nest als zweiten Landsitz erwählte; denn die Beziehungen zwischen den schottischen Engländern und den englischen Schotten sind bis heute nicht die besten. Auch ist die Idee des Los-von-England unter schottischen Clan-Chefs nie ganz erloschen. I’m english, not british, musste sich der Kolporteur dieser Geschichte einer deutschen Kaiserin englischer Abstammung von einem jungen Londoner Gentleman noch 1992 sagen lassen, als er es diesem besonders recht machen wollte und ihn als Briten bezeichnete. 1848 mieteten Albert und Victoria das geräumige Haus Balmoral im schottischen Hochland auf vier Jahre; daraus sind mittlerweile beinahe 150 geworden. Jahr für Jahr schleppte sich der kleine Hofstaat und die Regierung stöhnend hinauf in das windige und dem verweichlichten Gentleman feindliche Gebirge, bevölkert von katholischen Schotten, die von ihren urwüchsigen Clanshäuptlingen geführt wurden, um dieses oder jenes mit der Königin oder dem König zu besprechen. Bedeutete für die reinen und wahren Engländer diese Ortswahl der Queen einen sanften Schock, so fanden es die Schotten selbst recht sonderbar, die Queen, den Prinzgemahl und schließlich die heranwachsenden Kinder des Paares im ländlichen Stil durch Schottland wandeln zu sehen, aber als gute Untertanen fanden sie sich damit ab, und fanden Gefallen an der kleinen dicken Dame mit dem Strohhut auf dem Kopf.
Aus dem Jahre 1849, nämlich im September, als es die Witterung noch erlaubte, sich im freien aufzuhalten, stammt ein Bericht von Greville, einem Kabinettsekretär, über das, was er in Balmoral vorfand. Im ganzen Königreich wütete nämlich die Cholera, und die Regierung hatte es sich in den Kopf gesetzt, dem Mangel an Hygiene durch ein erhöhtes Maß an Gebet zu ersetzen, durch Edikt. Landauf, landab, musste also mehr gebetet werden. Dazu sollte die Queen ihren Segen erteilen. Greville beschreibt die Szene, die er vorfand so: Der Ort ist sehr hübsch, das Haus sehr klein. Sie leben ohne Aufwand, nicht nur als Privatleute, sondern als sehr einfache Privatleute, kleines Haus, kleine Räume, kleine Gesellschaft. Nirgendwo Soldaten, und die gesamte Garde des Souveräns und der königlichen Familie besteht aus einem einzigen Polizisten, der auf dem Gelände umherwandert. Und also nichts zu tun hatte. Aber auch Victoria hatte nichts zu tun, denn es war eines ihrer wenigen schwangerschaftsfreien Jahre. Dass Queen Victoria sich in Schottland frei, ohne besonderen Personenschutz bewegte, nimmt nicht Wunder; wahrscheinlich eignen sich Könige und Königinnen überhaupt mehr für bäuerlich-ständische Gesellschaften, aus denen sie ja auch hervorgegangen sind, als für moderne urbane Zentren. Victoria jedenfalls wandelte in Balmoral von Hof zu Hof, schwatzte mit Bäuerinnen, wenigstens der Überlieferung nach, weil wir keine Bäuerin mehr fragen können, mit der sie sich über Kinder und Hühner unterhalten haben soll. Ansonsten aber waren die Jahre 1848 und 1849 durchaus nicht sorgenfrei. Victoria war 1849 seit rund elf Jahren Königin. Der Royal Princess Victoria, 1840, waren 1841 Sohn Bertie, 1843 die zweite Tochter Alice und 1844 der Sohn Alfred gefolgt. 1846 erblickte Tochter Helena das Licht der Welt und 1848 kam noch ein Mädchen an, Tochter Louise, als das vorerst letzte Kind. Was sonst passierte, ist noch weniger erfreulich; von 1840 bis 1849 waren auf Victoria vier Attentate verübt worden, alle ohne Resultat, was zum Gottvertrauen der Queen nicht wenig beigetragen haben mag. Abgesehen von der Seuchenkatastrophe 1849 hatte das United Kingdom die irischen Missernten mit furchtbaren Hungersnöten, übrigens in ganz Europa, zu überstehen und eine Revolution, nicht die kontinentale von 1848, sondern die der Chartisten. Hier müssen wir ein wenig das bäuerlich- freundliche Balmoral verlassen, und uns in die realen Niederungen der modernen Gesellschaft hinabbewegen.
Die Bewegung der Chartisten zeigte, wie weit fortgeschritten die englische Industrialisierung und die mit ihr verbundene Klasse, das englische Proletariat, war. Bereits 1838 hatte einer der führenden Chartisten, Lovett, eine sogenannte People’s Charta aufgestellt, in der eine erweiterte Parlamentsreform gefordert wurde, und das freie und geheime Wahlrecht. Die Chartistenbewegung wuchs ungeheuer rasch an; rund 3.3 Millionen Engländer unterschrieben die Petition zur Gewährung der erwähnten Charta. Allein der Antrag wurde im Unterhaus mit Mehrheit abgelehnt, woran nichts Wunderbares gewesen ist, sondern was bei der Zusammensetzung des Parlamentes erwartet werden konnte. Immerhin war es Lovett, Hetherington und Harney gelungen, zum ersten Mal in der Geschichte eine rein proletarische Organisation zu schaffen, die London working men’s organisation, die auch sogleich Frauen und Kinder unter besonderen Schutz gegen Ausbeutung stellen wollte. Der Verein gab auch eine Zeitung heraus, der Northern Star brachte es auf immerhin 50 Tsd. Exemplare, täglich. Als die Bewegung zum Aufstand, zur Revolution überging, wurde der Chartismus selbstverständlich blutig unterdrückt. Nebenbei bemerkt haben die Kommunisten Marx und Engels aus dem Chartismus nicht nur Anregungen gezogen, sondern auch Lehren. Schließlich führte der niedergeschlagene Chartismus doch zu einigen Reförmchen, wie etwa 1847 die Einführung des 10-Stunden-Tages in die englische Fabrikgesetzgebung. Wer einst in Das Kapital geblickt hat, gezwungen, gelangweilt oder neugierig fasziniert, dem ist sicher aufgefallen, wie oft sich Marx der so genannten Fabrikberichte bedient hat, um seine Thesen zu stützen. Vor den Chartisten, die sie nicht verstand, war Queen Victoria zuerst auf die Insel Wight geflüchtet, nach Osborne House. Für sie handelte es sich um einen Aufstand, wie jeder andere, und das Inselreich hatte daran keinerlei Mangel.
Greville hat bei dem erwähnten Besuch in Balmoral auch mit dem Prinzgemahl Albert verhandelt; er stellt ihm das Zeugnis aus, klug und politisch geschickt aufgetreten zu sein. Wenn wir uns damit abfinden müssen, dass die Queen ihrem Außenminister Lord Palmerston in Sachen kontinentaler Aufstände nicht folgte, so hatte das Paar doch wenigstens das Dekorum zu wahren. Infolge der Revolution 1848 in Wien, Brüssel, Berlin schickten Albert und Victoria zwar nach vorerst allen erledigten Thronen hin mitfühlende Beileidsbekundungen, aber nicht mehr. Palmerston zeigte nur ein geringes Interesse an diesen, für ihn, intern-europäischen Vorgänge. England begann von Flüchtlingen aller Art zu wimmeln; die Insel nahm sie auf, die Öffentlichkeit scherte sich wenig um diese Leute, auch um den deutschen Flüchtling, dem Kartätschenprinzen und späteren Schwiegervater Vickys.
Von Balmoral aus brach Victoria zu einem Besuch nach Irland auf. Dort herrschte infolge andauernder Hungersnöte ein Massensterben und die dazu gehörigen Revolten, die von allen Regierungen bislang mit Gegenterror behandelt worden waren. Todesurteile wurden serienweise verhängt und vollstreckt. Innerhalb von acht Jahren verließen 2.5 Millionen Iren ihre Heimat, sie gingen überwiegend nach Amerika und bildeten eine besitzlose Unterschicht. Über die Irlandpolitik waren die Parteien zerstrittener denn je; bei Tories und Whigs bildeten sich verschiedene Gruppen, die vorwiegend Interessenpolitik betrieben. Bei dieser Gelegenheit wollen wir den Blick auf eine Besonderheit des englischen Parlamentarimus lenken, der unglaublich zählebig zu sein scheint: Die Zwei-Parteien-Struktur verhinderte, was sich bei den kontinentalen Nachahmern so rasch negativ auswirkt, dass eine dritte Partei jeweils als Hilfskraft zu Koalitionen herangezogen werden muss, sodass selbst die magerste plebiszitäre Legitimation durch den Wähler über halsbrecherische Verbindungen ins Gegenteil verkehrt werden darf. Die Franzosen haben das Kunststück ihren durch den Kanal getrennten Nachbarn nicht nachmachen können; Maupassant spricht so verächtlich wie nur möglich, vom allgemeinen Wahlrecht, das er einen Misthaufen nennt. Wer das versteht, dem eröffnet die aktuelle Nutzanwendung ganz neue Einsichten in das Wesen der parlamentarischen Demokratie, die nichts so sehr fürchtet, wie das Volk. Die Queen besaß einen politischen Zentralbegriff für den Hausgebrauch, der dieser Wirklichkeit entsprach, er lautete: Sicherheit. Mit dem englischen Gleichwort save ging Victoria auf die allerschlichteste Art und Weise um; sicher waren für sie Menschen, oder sie konnten es sein, aber auch Dinge betrachtete sie als sicher oder unsicher.
DIE KENSINGTON BANDE
Als sich die Queen zur Irlandreise rüstete, war ihre Stellung gefestigt, und nicht nur im Äußerlichen, im Stil und in der Tradition; die konstitutionelle Monarchie englischen Typs war tatsächlich etwas Besonderes. Im Europa des 19. Jahrhunderts hatten sich keine neuen Herrscherdynastien mehr bilden können. Vakante Throne und Kronen wurden sozusagen ausgeschrieben wie Stellen von Handlungsgehilfen. Das führte zu Rückgriffen auf fragwürdige Nebenfiguren aus den Restbeständen des Hochadels. Gegen die trübe Herkunft der englischen Königin war die ihres Gatten geradezu musterhaft, wenn auch deutsch und kleinstaatlich. Mittlerweile gibt es verschiedene Theorien über die Familienabstammung der Queen Victoria; ihre Ahnenreihe soll bis hinunter zu den Teilnehmern der Schlacht bei Hastings 1066 reichen, wo einiges, das heißt alles für das Inselreich entschieden wurde, nach anderen Quellen reichte die Abkunft Victorias sogar bis zum biblischen König David.
Geboren wurde die Mutter unserer Victoria, Royal Princess, am 24. Mai 1819, und zwar als erste Tochter eines vierten Sohnes König Georg III., was bedeutet, dass die nun amtierende Queen eine stattliche Liste Bewerber um den Thron vor sich hatte, sämtliche royalistischen Onkel und natürlich auch noch den skandalösen Papa. Victoria hat ihn nicht gekannt. Er starb in ihrem ersten Lebensjahr. Dieser Herzog von Kent, wie sein offizieller Titel lautete, befand sich mit seiner schwangeren Frau auf einer Deutschlandtournee; und zwar in der Gegend um Heidelberg. Was das Paar dort tat, bleibe dahingestellt. Nun entfaltete der Herzog allerdings Eile, um rechtzeitig nach Hause zu kommen; denn nach englischen Recht, dem Territorialrecht, mussten kleine Engländer, Knabe oder Mädchen, auf der Insel geboren werden, wenn er oder sie sofort in die vollen Bürgerrechte eintreten wollten. Hierin unterlag selbst die Aristokratie dem Gesetz. Eventuell aber hat der Herzog auch noch Verwicklungen bei der Durchsetzung seiner privaten Ansprüche befürchtet, wenn das Kind noch in Deutschland und überdies von einer deutschstämmigen Mutter geboren worden wäre. Das Paar reiste also so schnell wie möglich mit immerhin elf Wagen rheinaufwärts, der werdende Vater betätigte sich als Kutscher seiner Frau. Die saß in einem so genannten Phaeton, in bildlicher Nähe zum Sonnengott, einem bequemen und gut gefederten Gefährt, soweit Kutschen bequem sein können. Die Herzogin befand sich bereits im achten Monat ihrer Schwangerschaft. Allein zimperlich durfte in jenen Tagen nicht mal eine Herzogin sein. Alles ging gut; von Ende März bis Mitte April 1819 hatte der Reisezug ein tüchtiges Wegstück hinter sich gebracht, die Hafenstadt Calais erreicht, und wartete nun auf eine Gelegenheit zum Übersetzen nach Dover.
Der Herzog zählte 51 Jahre und ist eine so originelle und vorurteilslose wie bemerkenswert abstoßende Persönlichkeit gewesen. So pflegte er Kontakte zum utopischen Sozialisten Robert Owen, was vielleicht wenig bedeutet, denn Utopisten sind für gewöhnlich bloße Denker. Owen allerdings experimentierte auch real mit quasi-kommunistischen Kolonien, mit allerdings negativem Resultat. Dies mag das Interesse des Herzogs ebenso geweckt haben, wie die Inspirationen Owens. Der Herzog hatte übrigens ein beträchtliches Stück der damaligen Welt gesehen und wechselte seine Urteile und Vorurteile nach Bedarf. Er gab sich in der Frage der Sklaverei, die in den englischen Überseekolonien als Wirtschaftsgrundlage galt, heftig liberal. Andererseits zählte er Katholiken zu seinen Freunden und befürwortet deren Emanzipation, ihre staatliche Gleichstellung im Königreich. Er betrieb einen unerhört aufwendigen persönlichen Lebensstil, den eines Aristokraten des 18. Jahrhunderts, dem alles erlaubt ist. Von Berufs wegen war er Soldat, sogar Feldmarschall, letzteres freilich eher formal und ehrenhalber, um ihn über den Verlust eines realen Kommandos zu trösten. Überdies hielten die Europäer gerade einmal Frieden und beschäftigten sich mit der Teilung des Gewinnes nach der Niederwerfung Napoleons. Sein Liberalismus stand ebenfalls auf schwachen Füßen; viele seiner Handlungen erregten wegen ihrer, selbst für damalige Zeiten grausamen, Dimensionen Abscheu. Der Aristokrat aus dem 18. Jahrhundert des alten Regimes war eben alles zugleich, gebildet und aufgeklärt, bigotter Despot ohne persönliche Hemmungen.
England bildete in der Periode der kontinentalen Restauration längst das europäische Schlusslicht in human rights