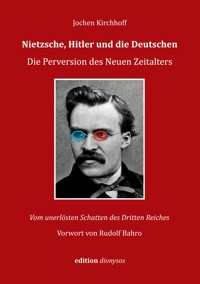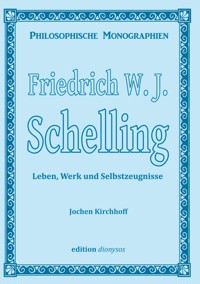
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Philosophische Monographien
- Sprache: Deutsch
Friedrich W. J. Schelling Monografie Autor: Jochen Kirchhoff Der ausgewiesene Schelling-Kenner, Naturwissenschaftskritiker und Philosoph Jochen Kirchhoff unternimmt in dieser Monografie den Versuch, dem Leser den großen deutschen Philosophen der romantischen Naturphilosophie Friedrich Wilhelm Schelling vielfältig näherzubringen. Dabei werden die wichtigsten philosophischen Leistungen Schellings herausgehoben und im Lichte der Bewusstseinskrise der Neuzeit diskutiert. Schelling ist und bleibt aktuell und hat mit seinem Bestehen auf einem organischen Weltzusammenhang, seiner Diskussion der Freiheitsfrage und seinem naturgeschichtsphilosophischen Denken einer möglichen Erlösung der Natur durch den Menschen und im Menschen neben vielen anderen Impulsen Anregungen zu einer Lösung des Rätsels des Menschseins eingebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zur Bestimmung der Aufgabe:
Schelling und die Krise der Philosophie
Lebensweg und Werküberblick
Die Philosophie der Natur
Abgrenzung und Protest
Der Erkenntnis-theoretische Ansatz
Grundgedanken der Naturphilosophie
Das Beispiel der Schwere:
Physik und Metaphysik der Gravitation
Zur Wirkungsgeschichte der Naturphilosophie
Das Problem der Freiheit
Grundsätzliches
Das Absolute und die Sinnenwelt
Vom Ursprung des Bösen
Zur Wirkungsgeschichte der Freiheitslehre
Anmerkungen
Zeittafel
Zeugnisse
Bibliographie
Zur Bestimmung der Aufgabe:
Schelling und die Krise der Philosophie
Mit der Philosophie, so scheint es, steht es nicht zum besten. In dem letzten großen Werk Schellings, der Philosophie der Offenbarung, heißt es in der Einleitung: ...Stoff genug zu melancholischen Betrachtungen über die Philosophie gibt nun schon ein Blick in ihre bisherige Geschichte, und liegt schon in dem Umstande, daß bis jetzt noch keine Art zu philosophieren, oder wie man sonst sagt, keines der verschiedenen philosophischen Systeme sich in die Länge behaupten konnte. Ich sage, es ist die Pflicht des Lehrers, auch diese Seite der Philosophie hervorzukehren, die vielmehr abschreckt als anzieht.1 Einige Jahrzehnte vorher hatte Kant geschrieben, im Lande der Metaphysik sei «in der Tat noch kein sicheres Maß und Gewicht vorhanden ... um Gründlichkeit von seichtem Geschwätze zu unterscheiden»2. Die Bemerkung bezieht sich auf die dogmatische Metaphysik der Vorgänger Kants.
Klagen dieser Art sind in der Geschichte der Philosophie häufig zu vernehmen, insbesondere seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, also seit dem sich abzeichnenden Siegeszug der «exakten Naturwissenschaften». Viele fühlten sich bemüßigt, die Philosophie gleichsam zu Grabe zu tragen, das Ende des philosophischen Denkens überhaupt zu konstatieren, ähnlich wie dies Nietzsche mit seiner Formel «Gott ist tot» im Hinblick auf die christlich-moralische Gottesvorstellung tat. – Die Schellingsche Spätphilosophie, die als Konsequenz und Überwindung des Rationalismus ausgegeben wurde, hat diesen Zerfallsprozess nicht aufzuhalten vermocht. Eher trifft das Gegenteil zu: Ihr hoher Schwierigkeitsgrad im Gedanklichen und Sprachlichen sowie die hier zum Ausdruck kommende Ausrichtung auf die Religion haben ihre lebendige Wirksamkeit verhindert, ja ungewollt das seit Kant vorherrschende Misstrauen gegen jedwede Form von Metaphysik verstärkt. Metaphysik, als Wissenschaft von «Dingen» jenseits der Erfahrung (worunter im Sinne Kants stets sinnliche Erfahrung gemeint war), geriet zunehmend in die Region des Dubiosen, ja Anrüchigen. So gehört heute weder Originalität noch Mut dazu, sich materialistisch oder positivistisch zu geben, weil der «Zeitgeist» dies allenthalben begünstigt. Dagegen steht jeder philosophische Versuch, Welt-und Seinsfragen metaphysisch zu lösen, unter dem Zwang der Rechtfertigung, als sei man im Begriff, etwas intellektuell Fragwürdiges zu tun. Die herrschende Bewertung der Metaphysik als Anachronismus bedeutet keinen Verzicht auf Philosophie schlechthin, vielmehr erfährt diese eine bemerkenswerte Einengung und Verarmung. Das trifft für Philosophie als Sozialwissenschaft genauso zu wie für die im Zusammenhang mit der modernen Physik entwickelten dogmatischen Verallgemeinerungen wissenschaftlicher Teilergebnisse. Dies wird durch vielfältige Popularisierungen noch verstärkt; man denke an die Fiktionen und Hypothesen von Relativitätstheorie und Quantenmechanik.
Vor allen anderen Wissenschaften hat die mathematische Physik seit Galilei der Philosophie Zug um Zug die einstige Domäne streitig gemacht: den Kosmos, das Weltall, das Erkenntnisbemühen um die Grundgesetze der Welt als Ganzes. Am Ende dieser Entwicklung steht die Vorstellung von der Erde als einer Oase inmitten einer lebensfeindlichen kosmischen Wüste.
Die Krise der Philosophie ist nur als Symptom einer globalen Kulturkrise zu begreifen, die durch das von Nietzsche in die höhere Philosophie eingebrachte Wort «Nihilismus» vielleicht am sinnvollsten gekennzeichnet wird. Im Nachlass von 1887 heißt es: «Nihilismus: Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das <Warum>? was bedeutet Nihilismus? – dass die obersten Werte sich entwerten.»3 «Sein Maximum von relativer Kraft erreicht er als gewalttätige Kraft der Zerstörung: als aktiver Nihilismus ... Der Nihilismus stellt einen pathologischen Zwischenzustand dar (pathologisch ist die ungeheure Verallgemeinerung auf gar keinen Sinn).»4 Was Nietzsche hier als «aktiven Nihilismus» mit zerstörerischen Tendenzen bezeichnet, kann unschwer auf beachtliche Teilbereiche der modernen Physik und Biochemie übertragen werden. Und der von dem Biochemiker Erwin Chargaff angeprangerte «Kolonialkrieg» der Naturwissenschaftler gegen die Natur und die Grundlagen alles Lebendigen ist als Merkmal eines nihilistischen Grundstrebens (wenn auch häufig unbewusster Art) zu werten. Einem mechanistisch oder mathematisch strukturierten Kosmos essentieller Sinnlosigkeit und weitgehender Leblosigkeit – dies die herrschende Auffassung der Physiker – steht die zunehmende Zerstörung oder Bedrohung des Lebens auf diesem Planeten gegenüber. Wirklichkeitsverlust, so könnte man es formelhaft sagen, führt langfristig zur Wirklichkeitszerstörung. Man mag diesen Zusammenhang bestreiten, doch lässt sich kaum ernsthaft leugnen, dass die Überlebenschancen der Menschheit von einem radikalen Umdenkungsprozess, einer echten «Kulturrevolution» abhängen, in deren Mittelpunkt ein neues Natur-und Kosmosbewusstsein steht. - Die Reduzierung philosophischer Bemühung auf die soziale Frage im Rahmen eines historisch-materialistischen Grundansatzes ist keineswegs eine Gegenkraft zum Nihilismus, in dieser Form eher ein Symptom desselben. Auch die «akademische Philosophie» kann nicht als eine produktive Gegenkraft angesehen werden; und man muss wahrlich nicht die bissige Kritik Schopenhauers an der Universitätsphilosophie als Ganzes billigen, um die Berechtigung der nachstehenden Aussagen Carl Friedrich von Weizsäckers aus dem Jahre 1969 einzusehen: «Die Philosophie als Hochschuldisziplin ist heute keine Macht; im kontinentalen Europa bewahrt sie vorwiegend nach der Art solider Philologien einen geschichtlichen Wissensschatz. Dieses Wissen verwandelt sich selten in aktives Bewusstsein, vor allem wohl, weil die Aufgabe der Philosophie so schwer ist ... Die gegenwärtige Szene ist verworren. Der Existentialismus ist verklungen. Das Bild eigenen Weiterfragens wird beherrscht von einer Philosophie der Wissenschaft, die selbst Wissenschaft sein möchte, und einer Philosophie der Gesellschaft, die sich als gesellschaftliche Praxis darzulegen wünscht. Beides ist wichtig. Wichtiger scheint mir noch das stets erneute Erwachen eines Bewusstseins für das Niveau, auf dem eigentliche Philosophie erst beginnt.»5
Weizsäcker selbst fasst Philosophie im sokratischen Sinne als «Weiterfragen» auf, womit eine Fähigkeit umschrieben ist, die er an Heidegger bewundert. Zu den methodischen Grundsätzen der Wissenschaft gehört es nach Weizsäcker, «gewisse fundamentale Fragen» nicht zu stellen; die Physik fragt nicht wirklich, was Materie ist; Ähnliches gilt für die Biologie hinsichtlich des Lebens.6 Über Weizsäcker hinausgehend wäre zu sagen, dass der theoretische Physiker die kosmische Gültigkeit der von ihm als mathematische Hypothesen formulierten Naturgesetze nicht in Frage stellen darf, weil auf dieser Annahme seit Galilei und Kepler die Möglichkeit einer Wissenschaft der Natur überhaupt beruht. Und der Philosoph Weizsäcker versagt sich hier in gewisser Weise das Weiterfragen, weil er als theoretischer Physiker davon überzeugt ist, dass die neuzeitliche Physik prinzipiell vollendbar sei und in einer einfachen Theorie ihren Abschluss finden müsse. Dieser Gedanke geht auf Kant zurück.
An anderer Stelle betont Weizsäcker, dass das methodische Verfahren der Wissenschaft, «wenn es sich über seine eigene Fragwürdigkeit nicht mehr klar ist, etwas Mörderisches an sich hat»7. Dieses «Mörderische» spiegelt sich nirgends deutlicher wider als in der modernen Physik und Biochemie. Mit Recht spricht der Technikhistoriker Lewis Mumford im Zusammenhang mit der Entstehung des modernen Wissenschaftsbegriffs (der mathematisch-experimentellen Abstraktion) vom «Verbrechen Galileis». – Was die «Aufgabe» der Philosophie sei, darüber wird man in unseren Tagen kaum einen allgemeinen Konsensus erreichen können. Allein das ist ein Zeichen für faktischen Nihilismus und Orientierungslosigkeit, für jenes geistige Vakuum, das die Kirchen sowie Sektierer aller Spielart auszunutzen suchen. – Philosophie im ursprünglichen Wortsinn als «Liebe zur Weisheit», und das hängt mit der Entstehung dieses Begriffs zusammen, ist an eine Voraussetzung geknüpft, die Schelling einmal wie folgt umschreibt: Verlangt der Mensch eine Erkenntnis, die Weisheit ist, so muss er voraussetzen, dass auch im Gegenstand dieser Erkenntnis Weisheit sei. Es ist ein Axiom, das sich schon aus den ältesten Zeiten der griechischen Philosophie herschreibt: <wie das Erkannte, so das Erkennende>, und umgekehrt. Das schlechthin Erkenntnislose könnte auch durchaus nicht erkannt werden, d. h. Gegenstand der Erkenntnis sein. Alles was Gegenstand der Erkenntnis ist, ist dies nur soweit, als es selbst die Form und das Gepräge des Erkennenden schon an sich trägt, wie jedem einleuchten muss, der auch nur die Kantsche Theorie der Erkenntnis etwas geistreicher als gewöhnlich aufzufassen versteht. So auch die Weisheit. Es gibt keine Weisheit für den Menschen, wenn im objektiven Gang der Dinge keine ist. Die erste Voraussetzung der Philosophie als Streben nach Weisheit ist also, dass in dem Gegenstand, d. h. dass in dem Sein, in der Welt selbst Weisheit sei. Ich verlange Weisheit, heißt: ich verlange ein mit Weisheit, Voraussicht, Freiheit gesetztes Sein.8 Philosophie wird unmöglich, wenn im objektiven Gang der Dinge keine göttliche Weisheit anzutreffen ist. Diese Grundprämisse wird vom Skeptizismus in Zweifel gezogen; Anhaltspunkte genug bietet ja die Welt, an einem ihr zugrundeliegenden göttlichen Weisheitsprinzip zu zweifeln. Und die Philosophen hatten es nicht leicht, die allzu augenfällige Präsenz des Bösen, des Leides, des Chaos in der Welt im Sinne einer «Theodizee» (Rechtfertigung Gottes) verständlich zu machen.
Der erste Philosoph in neuerer Zeit, welcher die von Schelling herausgestellte Voraussetzung radikal bestreitet, ist Schopenhauer. Er setzt alle bislang dargebotenen Spielarten der neuplatonischen Gleichsetzung von Wahrheit, Güte und Schönheit außer Kraft und interpretiert das Wesen oder Innerste der Welt als bloßen Willen, als blinden Drang zum Leben. Diesen gelte es zu verneinen; das Nichtsein der Welt sei ihrem Sein entschieden vorzuziehen. Man kann dies mit Nietzsche als einen nihilistischen Ansatz interpretieren. Doch bestreitet Schopenhauer keineswegs den Sinn des Daseins, vielmehr wird die Verneinung des Lebenswillens, im Sinne einer buddhistisch verstandenen Erlösung, als Ziel und Zweck der Existenz herausgestellt. Die Realität und furchtbare Kraft des Chaos sowie den tragischen Grundcharakter des Seins bezieht Schelling erst in seiner Freiheitsschrift von 1809 in die philosophische Betrachtung ein, ohne allerdings die Überzeugung von einer gottgefügten kosmischen Ordnung prinzipiell aufzugeben. Dies unterscheidet ihn von Schopenhauer, dessen Lehre er gleichwohl beeinflusst hat. Die Geistesgeschichte der Menschheit belegt ein «metaphysisches Bedürfnis» (Schopenhauer), ein tiefwurzelndes Ahnen von der Unzulänglichkeit und Relativität der Sinnenwelt. Die bekannten Formen der Pervertierung und Ausbeutung dieses Grundbedürfnisses durch die Priester aller Religionen und die Herrschenden religiös gebundener Gesellschaften sind häufig beschrieben worden; sie beweisen nichts gegen die Sache selbst, also gegen das Verlangen des Menschen nach metaphysischer Grundlegung seiner Existenz. Doch dürfte dieser Hinweis gerade für den «modernen Menschen» von Bedeutung sein, dessen Bewusstsein von dem Erkenntnisanspruch der mathematischen Naturwissenschaft geprägt ist, von der Idee der mathematischen Prinzipien der wissenschaftlichen Vernunft. Zwar hat das Christentum seine bewusstseinsprägende Kraft auch heute noch keineswegs völlig eingebüßt, doch wird religiöse Betätigung oder Einstellung als «Privatsache» gewertet, die keinen Einfluss haben dürfe auf den Fortgang der wissenschaftlichen Forschung. Der seit dem 17. Jahrhundert dominierende methodische Atheismus der Naturwissenschaften ist von dem prinzipiellen Atheismus nur durch eine dünne Wand getrennt. – Die Voraussetzung, dass auch im objektiven Gang der Dinge so etwas wie Weisheit anzutreffen sein müsse, wird von vielen heute zurückgewiesen, als «überholt» abgetan. Und die meinungsbildenden Kräfte in Wissenschaft und Philosophie scheinen eher bemüht, den absurden Charakter des Universums hervorzuheben bzw. diesen als wissenschaftliche Erkenntnis auszugeben. «Der Kosmos ist wie ein Spiegel», lautet eine altpersische Weisheit, die – einmal ernst genommen – zu naheliegenden und bemerkenswerten Schlussfolgerungen führt. Der dogmatische Anspruch des Christentums und seine jahrhundertelange Gleich-Setzung mit Religion schlechthin hat es der werdenden mathematischen Naturwissenschaft im 17. Jahrhundert leicht gemacht, einen ähnlichen Absolutheitsanspruch aufzubauen. Und allzu viele glaubten, in dem Religions- und Metaphysik-Ersatz «Wissenschaft» eine neue Möglichkeit gefunden zu haben, sich den Grundgesetzen des Seins anzunähern und diese gleichsam dingfest zu machen. Dies hat sich erst im 20. Jahrhundert, wenn auch nur graduell, geändert; das Grauen von Hiroshima und die nuklearen Vernichtungswaffen haben das Ansehen der Naturwissenschaft nur geringfügig geschmälert. Es lässt sich feststellen, dass ausnahmslos alle bekannten Wertsysteme und Denkrichtungen sich als unfähig erwiesen haben, die existentielle Krise des modernen Menschen zu bewältigen (Aurelio Peccei, Präsident des «Club of Rome»).
Wer heute als Philosoph auftritt oder auch nur Philosophiegeschichte betreibt, muss dies in sein Bewusstsein ziehen. Andernfalls verbleiben seine Aussagen im engen Zirkel akademischer Gelehrsamkeit. Seit die rationalistische Philosophie und ihr ständiger Wegbegleiter, die mathematische Naturwissenschaft, den gesamten Bereich des Spirituellen aus ihrer Betrachtung auszuschließen begannen, also seit dem frühen 17. Jahrhundert, wurde alles Nicht-Rationale mehr oder weniger gezwungen, in den «kulturellen Untergrund» zu gehen, sofern es nicht der Kirchendoktrin gemäß war. Nur die Kunst, als sinnlich fassbare Form schöpferischer Geistigkeit, war davon weitgehend ausgenommen. Das Spirituelle war keineswegs «tot», es suchte sich andere Erscheinungsformen, andere Kanäle: so in den von Kirche, Wissenschaft und Philosophie gemeinsam bekämpften Geheimgesellschaften (Freimaurer, Rosenkreuzer) und zahlreichen Sekten. Die Sphäre des Spirituellen, noch in der Philosophie der Renaissance ein lebendiger des Denkens, fiel zunehmend der Geringschätzung und Verächtlichmachung von «offizieller Seite» anheim. Dies wurde verstärkt durch die sich im «Untergrund» vollziehende Verzerrung und Entartung spiritueller Strebungen. Man kann dies am klarsten in der Entwicklung des Denkens über die Zahl erkennen: Die in der Renaissance-Philosophie wiederbelebte pythagoreische Lehre von den Zahlen als Symbolen und Garanten kosmischer Weisheit wurde von Galilei und Leibniz schroff zurückgewiesen. Und die «Mathesis universalis», von der Leibniz in Anknüpfung an Descartes sprach, übernahm zwar den alten Universalitätsanspruch der pythagoreischen Zahlenlehre, bewirkte jedoch faktisch deren totale Umwertung in Richtung auf letztmögliche Abstraktion. Die qualitative Zahlenlehre, aus dem Lichtkegel des philosophischen Denkens verbannt, entartete zum «Zahlenaberglauben». Es fiel nicht schwer, diesen zu diskreditieren angesichts der fulminanten Erfolge der mathematischen Präzision. Man nahm die Entartungsform für die Sache selbst (ein häufig zu beobachtender Vorgang), und eine merkwürdige Fixierung auf die chronologische Zahl blieb als Relikt der qualitativen Zahlenlehre im öffentlichen Bewusstsein. – Diese im 17. Jahrhundert einsetzende Auseinanderentwicklung ist bis heute nicht überwunden worden, ungeachtet zahlreicher Versuche, den Abgrund zu überbrücken, unter denen die Anthroposophie die größte Breitenwirkung verzeichnen konnte.
Der Verlust eines philosophischen Regulativs war überall spürbar, zumal die Vernunftkritik Kants die prinzipielle Unmöglichkeit metaphysischen Wissens bewiesen zu haben glaubte. Und das so offenkundige Scheitern der großen spekulativen Entwürfe im nachkantischen Idealismus galt vielen als Beweis für das Ende der Metaphysik. Deutlicher als jeder andere diagnostizierte Nietzsche die allenthalten spürbaren Symptome nihilistischer Geistigkeit.
Wie lässt sich der Standort der Schellingschen Philosophie in der Geschichte des Denkens und des Nihilismus bestimmen? Zum einen sind die wandlungsreichen und vielfach fragmentarischen Denkbemühungen Schellings ein Symptom der Krise der nachkantischen Epoche. Ein Symptom der Schwierigkeiten und Widersprüche der Metaphysik in einer Zeit, die von politischen Umwälzungen und dem Wahrheitsanspruch der empirischen Wissenschaften bestimmt ist. Zum andern jedoch, und dies bleibt häufig außerhalb der Betrachtung, ist das Schellingsche Denken durchaus nicht nur Krisensymptom und damit im Sinne historischer Relativität «abzuhaken» und einzuordnen: Wie jedem schöpferischen Denkansatz, so kommt auch demjenigen Schellings eine Bedeutung zu, welche die historische Bedingtheit erheblich übersteigt und derart seine fortdauernde Aktualität sichert. Von dieser ist in der akademischen Schelling-Forschung viel die Rede, obwohl die Vielzahl der Veröffentlichungen über Einzelaspekte des Schellingschen Denkens noch keine wirksame «Renaissance» verbürgt. Im Übrigen teilt die Schelling-Forschung das Schicksal aller modernen Wissenschaft: Die Zersplitterung der Fragestellungen und Teilresultate lässt ein Gesamtbild kaum erkennen. Ob die vorliegende Studie diese Lücke zu füllen vermag, sei dahingestellt. Auch macht die vorgegebene Begrenztheit ihres Umfangs die Beschränkung auf einige zentrale Aspekte erforderlich. Dies wiederum wird erschwert durch die eigentümliche Sperrigkeit oder Sprödigkeit weiter Bereiche der Schellingschen Schriften. Anders formuliert: Schelling macht es seinen Lesern nicht immer einfach. Dies hat viele überhaupt abgeschreckt und die durchaus vorhandenen Möglichkeiten lebendiger Wirksamkeit blockiert. Auch haben sich die einzelnen Schichten und Entwicklungsphasen dieses Denkens merkwürdig verselbständigt, weisen ihre jeweils eigene Wirkungsgeschichte auf. Dies erklärt den Umstand, dass sich so verschiedenartige Geistesströmungen wie Theologie und Psychoanalyse, Existentialismus und Anthroposophie, «Lebensphilosophie» und «Materialismus» (im Sinne Ernst Blochs) mit einigem Recht auf Aussagen Schellings berufen können. Meist geht allerdings dabei der innere Zusammenhang des Schellingschen Denkens verloren.
Schelling ist «aktuell», weil er mit immer neuen Ansätzen bemüht war, in lebendigen Ganzheiten zu denken, auch wenn ihn dies zuweilen auf Pfade führte, die dem heutigen Menschen sonderbar oder gar abstrus anmuten mögen. So ist die Philosophie der Natur selten wirklich ernst genommen worden, was die hier zutage tretenden Prinzipien denkerischer Naturerfassung anlangt. Mit dem sattsam bekannten Hinweis auf die «gesicherten Ergebnisse» der mathematischen Naturwissenschaft glaubten sich viele berechtigt, das Mühen Schellings um eine lebendige Synthese von Natur und Geist, Sein und Bewusstsein abzutun und auf ein «totes Gleis» zu verweisen. Dass dies schon rein historisch nicht aufrechtzuerhalten ist, wird noch an späterer Stelle deutlich werden. «Das Schicksal des sogenannten Deutschen Idealismus entscheidet sich ohne Frage daran, ob es möglich ist, ihn in ein fruchtbares – was auch heißen kann: kritisches – Verhältnis zur empirischen Forschung zu bringen. Falls dies nicht gelingt, wird die nachkantische, idealistische Philosophie in eine Rolle gedrängt werden, die der des Aristotelismus zu Beginn der Neuzeit ähnlich ist» (Christoph Wild).9
Zwei Leitgedanken des Schellingschen Philosophierens seien in den Mittelpunkt dieser Studie gestellt, die sich den Polen «Natur» und «Freiheit» zuordnen lassen. Die Führungsrolle der abstrakten Naturwissenschaften in unserer Zeit, die lebensfeindlichen Ergebnisse von Teilen der Physik und Biochemie lassen es sinnvoll und gerechtfertigt erscheinen, die Naturphilosophie Schellings auf die in ihr enthaltenen Alternativansätze zu befragen, die «Anwaltschaft» Schellings für Natur und Leben bewusst zu machen. Die Grundzüge des von Christoph Wild beschriebenen «fruchtbar-kritischen» Verhältnisses zu den Naturwissenschaften sollen im folgenden aufgezeigt werden. Ob dies auch für die Hegelsche Naturphilosophie möglich ist, sei hier ausgeklammert. Dabei geht es in keiner Weise um eine gleichsam gewaltsame Aktualisierung der Naturphilosophie Schellings; vielmehr ist der in ihr enthaltene Grundgedanke in der Tat geeignet, die wissenschaftliche «Jagd nach Splittern» (Chargaff) mit den ihr innewohnenden Zerstörungsmöglichkeiten zu korrigieren, obwohl mit Beifall seitens der betroffenen Wissenschaftler kaum zu rechnen ist. Ähnliches gilt auch für die Freiheitslehre Schellings, die wenig gemein hat mit den herrschenden Auffassungen in Religion und Wissenschaft. Mit der Etikettierung «idealistisch» ist hier nichts gewonnen, zumal keine der bekannten Wissenschaften einen wirklich fundierten anthropologischen Ansatz besitzt. Was der Mensch ist oder sein könnte, dies weiß man heute weniger denn je zuvor. «Freiheit» gehört zu den Schlüsselbegriffen unserer Zeit, aber nur als ethisches oder religiöses Postulat. Eine philosophische Grundlegung der Freiheit fehlt; diese hat Schelling zu leisten versucht.
Naturphilosophie und Freiheitslehre sind die wohl bedeutendsten denkerischen Leistungen Schellings, die es als Herausforderung zu begreifen gilt. Nicht «Zurück zu Schelling» kann als sinnvolle Devise gelten, und die idealistische Philosophie der nachkantischen Epoche ist als Ganzes kaum ernsthaft wiederzubeleben. Wohl aber vermag eine denkerische Besinnung auf die Grundprinzipien des Schellingschen Philosophierens wichtige Einsichten zu vermitteln, die sich als geeignet erweisen könnten, eine schöpferische Alternative zur nihilistischen Geistigkeit zu bieten, deren Heraufkunft Nietzsche bereits vor einem Jahrhundert registrierte. Philosophie kann wohl nur dann eine produktive Kraft sein, wenn sie jene Dogmen und Tabus zu überwinden sucht, die das heutige Bewusstsein bestimmen. Schöpferische Philosophie ist daher notwendig unbequem.
Lebensweg und Werküberblick
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling wird am 27. Januar 1775 in Leonberg (Württemberg) geboren. Sein Vater, der hier seit 1771 als Diakon wirkte und sich auch als theologischer Schriftsteller einen gewissen Namen erworben hatte, wird 1777 Prediger und Professor am Kloster Bebenhausen bei Tübingen, welches als eine Art Vorschule für das Tübinger Stift fungierte. Hier wird Schelling zunächst in der deutschen Schule unterrichtet, wo er bereits als Achtjähriger alte Sprachen lernt. Ostern 1785 kommt er auf die Lateinschule in Nürtingen, und noch vor Vollendung seines zwölften Lebensjahres kehrt er nach Bebenhausen zurück, weil die Bildungsmöglichkeiten der Lateinschule ausgeschöpft sind, und nimmt am Unterricht der erheblich älteren Seminaristen teil, dem er sich gleichwohl gewachsen zeigt. Seine geistige Frühreife erregt Aufsehen, und er findet die Bewunderung der Lehrer, zu denen auch der eigene Vater gehört, der ihn in orientalischen Sprachen unterrichtet.
Dem Gesetz nach war es erst im Alter von achtzehn Jahren möglich, die Universität zu besuchen. Schelling erhält eine Sondererlaubnis und kann im Oktober 1790, drei Monate vor Vollendung seines sechzehnten Lebensjahres, in das Tübinger Stift eintreten. Der akademische Bildungsgang umfasste fünf Jahre, wovon zwei Jahre philosophischen und weitere drei Jahre theologischen Studien zugedacht waren. Die Tübinger Universität war relativ klein und unbedeutend; sie hatte 200 bis 300 Studenten, vornehmlich zukünftige Theologen und Gymnasiallehrer. 1794, nach Auflösung der Karlsschule in Stuttgart, kamen Mediziner und Juristen hinzu. «Im Grunde war die Universität eine jener zahlreichen Landesuniversitäten in Deutschland , deren Aufgabe primär die Ausbildung der notwendigen Kräfte für den Staats-, Kirchen- und Schuldienst des Landes war. Tübingen bedeutete so im geistigen Geschehen der Zeit wenig, und die Universtität sah auch nicht ihren Ehrgeiz darin» (Horst Fuhrmans)10. Es gehörte zu den Pflichten der Studenten, im Stift selbst zu wohnen; und seit dem Wintersemester 1790/91 bewohnt Schelling mit zwei anderen Studenten dasselbe Zimmer: Friedrich Hölderlin und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, beide jeweils fünf Jahre älter als er. Die hier begründete Freundschaft von Hölderlin, Hegel und Schelling ist häufig in ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung und «Schicksalhaftigkeit» gewürdigt worden. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als sei hier eine in ihrer Art einmalige Dreierkonstellation gegeben; zwar war Schelling seines Alters wegen zunächst der Anregungen und Impulse Aufnehmende, doch dürfte er in relativ kurzer Zeit auch seinerseits auf die beiden Älteren eingewirkt haben. Die gemeinsam verbrachte Zeit im Tübinger Stift währte drei Jahre; im September 1793 schlossen Hölderlin und Hegel ihr Studium ab und verließen Tübingen, blieben Schelling aber brieflich verbunden. Insbesondere der Briefwechsel zwischen Hegel und Schelling bis zum Herbst 1795, als Schelling das Tübinger Stift verlässt, gibt wesentliche Aufschlüsse über die Frühphase des Schellingschen Denkens, über die ihn prägenden Geistesströmungen und Persönlichkeiten.
Die Tübinger Universität war ein Bollwerk der Reaktion gegen die anbrandenden Wogen der Revolution im geistigen und politischen Bereich. Kants radikale Entthronung der traditionellen Metaphysik war nur mit Mühe totzuschweigen oder «einzufrieden». Es bildeten sich private Arbeitszirkel unter der Tübinger Studentenschaft, in denen Kant gelesen und diskutiert wurde. Auch Fichtes auf Kant aufbauender «Versuch einer Kritik aller Offenbarung» von 1792 bestärkte den Widerstand der Studenten gegen das als reaktionär empfundene System der herkömmlichen Theologie und Schulmetaphysik. Hinzu kamen die Schriften Rousseaus, der revolutionäre Elan der Schillerschen «Räuber» und die Philosophie Spinozas. 1789 hatte Friedrich Heinrich Jacobi in der zweiten Auflage seiner Schrift «Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an Herrn Moses Mendelssohn» den «Spinozismus» als Pantheismus und damit als getarnten Atheismus zu diskreditieren versucht und in diesem Zusammenhang den Renaissance-Philosophen Giordano Bruno als Vorläufer Spinozas herausgestellt. Zur Untermauerung dieser These wurden Auszüge aus Brunos Schrift «Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen» (1584) in paraphrasierender Form beigegeben. Die Schrift Jacobis wurde auch im Tübinger Stift viel diskutiert. Bei Hölderlin, Hegel und Schelling verstärkte sie die sich anbahnende Ablehnung des traditionellen Christentums. Spinoza und Giordano Bruno wurden richtungweisend für die Schellingsche Philosophie, obwohl der Einfluss Fichtes deren Wirksamkeit vorübergehend in den Hintergrund treten ließ. – Die durch Winckelmann wiederentdeckte Antike verhieß die harmonische Vereinigung der vom Christentum zertrennten Daseinsmächte, eine Sphäre der Schönheit und des Einklangs mit der Natur. Dies wurde insbesondere für Hölderlin von zentraler Bedeutung.
Die stärksten Impulse gingen wohl von der Französischen Revolution aus, von der dort – so schien es – zur Geschichtsmächtigkeit gelangten Vernunft. Viele Studenten im Tübinger Stift begrüßten das epochemachende Ereignis mit Begeisterung, waren sie doch selbst einem Musterbeispiel absolutistischen Herrschertums untertan: dem Herzog Karl Eugen, der von 1737 bis 1793 regierte und es sich nicht nehmen ließ, gelegentlich auch in das Universitätsleben einzugreifen. Das intensivierte den Hass und die Ablehnung. Überdies wurde das Tübinger Stift selbst «in strenger, fast klösterlicher Zucht geführt, darin von Freiheit kaum die Rede sein konnte». «Zucht, Gehorsam und Einordnung waren oberstes Gesetz. So war die Kleidung (eine Art geistliche Kleidung) vorgeschrieben, die Teilnahme am Gottesdienst (gemeinsames Morgengebet, sonntags gemeinsamer Kirchgang), Ausgang und Studienzeiten waren genau festgelegt (man hatte sich jeweils an der Pforte zu melden) ... » (Fuhrmans)11 – Das Stift war von revolutionären Gedanken erfüllt; Hölderlin, Hegel und Schelling wurden zu Wortführern der geistigen Revolte gegen die Universität, die etablierte Ordnung in Staat und Gesellschaft, deren Fundamente als morsch und erneuerungsbedürftig angesehen wurden. Hier verband sich die «Aufmüpfigkeit» einer neuen Generation mit den revolutionären Ideen des Zeitalters. Dass Hegel und Schelling in späteren Jahren selbst zu Stützen der restaurativen Ordnung wurden, den Herrschenden zu Diensten waren und alles Revolutionäre verurteilten, ist häufig kritisiert oder bedauert worden. Für Schelling wäre hier anzumerken, dass gerade er den revolutionären Tendenzen seiner Frühzeit in erheblich höherem Grade verbunden blieb, als dies auf den ersten Blick erkennbar ist. Sein philosophisches Wirken verlagerte den frühen Impuls auf eine andere Ebene, löschte ihn aber nicht prinzipiell aus. Dies haben Persönlichkeiten wie Michail Bakunin und Pierre Leroux sehr deutlich zu erkennen vermocht.
Auf die akademischen Lehrer an der Tübinger Universität braucht hier nicht eingegangen zu werden; Hochachtung oder auch nur Anerkennung hat Schelling ihnen nicht gezollt. – Den philosophischen Teil des akademischen Werdegangs kann er nach zwei Jahren mit der «Magisterprüfung» beenden. Entgegen den Gepflogenheiten schreibt er die Dissertation selbst, der zwei kleinere Arbeiten («Specima») beigeordnet werden. Die in lateinischer Sprache abgefasste Dissertation wird wenig später gedruckt; in deutscher Übersetzung lautet ihr Titel: Kritischer und philosophischer Versuch zur Erklärung des ältesten Philosophems über den Ursprung der menschlichen Übel. Die beiden «Specima» sind verschollen. Die Arbeit des Siebzehnjährigen zeigt zunächst einmal eine bemerkenswerte Vertrautheit mit den Schriften Kants, Lessings und Herders. An sich ist sie wenig interessant oder originell. – Bereits im Winter 1792/93 schließt Schelling eine weitere Arbeit ab: Über Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt. Die Schrift erscheint in der von H. E. G. Paulus herausgegebenen Zeitschrift «Memorabilien». Sie schlägt ein Thema an, das noch den späten Schelling beschäftigt: die philosophische Bedeutung des Mythos. Der erwähnte Paulus, selbst ehemaliger Stiftler, war Theologe und Professor für Orientalistik in Jena.
Im Wintersemester 1792/93 beginnt das eigentliche theologische Studium, also zu einer Zeit, als sich Schelling bereits von allen christlichen Vorstellungen herkömmlicher Prägung gelöst haben dürfte. Das Studium wird, wie aus Briefen hervorgeht, zunehmend lustloser absolviert. Johann Gottlieb Fichte kommt im Juni 1793 und ein zweites Mal im Mai 1794 durch Tübingen. Schelling verehrt in ihm den Verfasser der anonym erschienenen Schriften «Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdrückten» und «Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution» (1793). Im Sommer 1794 hält er Fichtes «Begriff der Wissenschaftslehre» in den Händen; die Verehrung für den Revolutionär im politischen und im religiösen Bereich wird nunmehr ergänzt durch diejenige für den «Vollender» der Kantschen Philosophie. Die Schrift Fichtes inspiriert den neunzehnjährigen Schelling zu seiner ersten philosophischen Abhandlung: Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt, die schon im Herbst 1794 erscheint, also in wenigen Wochen geschrieben worden sein muss. Die Abhandlung, in der es um das Problem der Philosophie als Einheitslehre im Sinne des Fichteschen Ansatzes geht, hat unterschiedliche Bewertungen erfahren: Kuno Fischer glaubt dem philosophischen Erstlingswerk attestieren zu müssen, dass in ihm «die Sache gleich in der Wurzel erfasst» worden sei.12 Die «Sache» ist die zentrale Problematik im «Begriff der Wissenschaftslehre»: das Ich als Ausgangspunkt und Fundament jeglichen Wissens. Horst Fuhrmans hebt hervor, die Schrift sei «gering ... im Eigenen, aber nicht ungeschickt in einigen Formulierungen»13. Schelling schickt die Abhandlung an Fichte; in dem Begleitbrief bringt er seine Bewunderung für dessen Schriften zum Ausdruck. Fichte seinerseits übersendet nun Schelling die ersten Druckbogen seiner «Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre». Die enorme Schnelligkeit des Aufnahme- und Verarbeitungsvermögens, die den jungen Schelling auszeichnet, wirkt sich in einer zweiten philosophischen Schrift aus: Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen, die Ostern 1795 erscheint. «Man wird nicht sagen können, dass diese Schrift tief in Fichtes Fragestellungen eingedrungen ist: Für die Öffentlichkeit begründete diese Schrift aber schnell Schellings Ruhm (wenn es auch ablehnende Rezensionen gab). Hier schien - so sah man es damals und so sah es auch Fichte (ja Schelling selbst?) – die in Fichte über Kant hinausdrängende Philosophie einen jungen, genialen Mitkämpfer gefunden zu haben, der mit kühnen Thesen das Ganze erläuterte und vorwärtstrieb» (Fuhrmans).14 Fichte hatte 1794 die Nachfolge des Kantianers Karl Leonhard Reinhold in Jena angetreten und war zum gefeiertsten Denker Deutschlands geworden, nicht zuletzt wohl wegen der Dynamik seiner Persönlichkeit, die auch Schelling tief beeindruckte, und der Schlüsselrolle der Freiheit in seinem System. Ob der «Fichteanismus» dem innersten philosophischen Anliegen des jungen Schelling entsprochen oder dessen Herausbildung eher verhindert hat, muss wohl im Letzten offen bleiben.