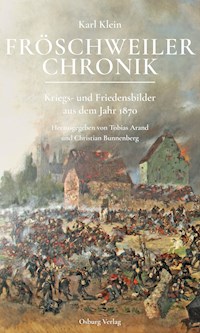
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 6. August 1870 findet rund um das kleine elsässische Städtchen Wörth an der Sauer eine der großen Schlachten des Deutsch-Französischen Krieges statt. 140 000 Mann stehen sich in einem stundenlangen, äußerst blutigen Kampf gegenüber. Auch das Dorf Fröschweiler ist Schauplatz des Gemetzels. Während der Kampf tobt, sitzen die Einwohner verängstigt in den Kellern ihrer Häuser. Noch Wochen nach der Schlacht, als die siegreichen Kämpfer längst weitergezogen sind, ringen die Einwohner mit den Folgen: Die Häuser sind zum Teil zerstört, die Kirche abgebrannt, tausende, nur notdürftig untergebrachte Verwundete sind zu versorgen, von den Äckern und Feldern sind verwesende Menschenleichen und Pferdekadaver zu entfernen. Karl Klein, als protestantischer Pfarrer von Fröschweiler Zeitzeuge, berichtet in seiner zuerst 1876 erschienenen Fröschweiler Chronik in anschaulicher und bilderreicher Sprache von den Gräueln des Krieges und dem Leid der Zivilbevölkerung. Diese Schilderung eines Zivilisten wurde zu einem der meistgelesen Kriegsbücher der Zeit. Auch wenn es im heutigen Verständnis sicher kein rein pazifistisches Buch ist und der Verfasser zum Teil Einstellungen zeigt, die seiner Zeit geschuldet sind, ist die Chronik doch eine bewegende Anklage gegen den Krieg. Diese ausführlich kommentierte und durch historische und biografische Essays ergänzte Neuedition soll ein zu Unrecht vergessenes Kapitel der deutsch-französischen Geschichte wieder bekannt machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Klein
Fröschweiler Chronik
Kriegs- und Friedensbilderaus dem Jahr 1870
Herausgegeben, erläutert und kommentiert vonTobias Arand und Christian Bunnenberg
Erste Auflage 2021
© Osburg Verlag Hamburg 2021
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten,insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortragssowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziertoder unter Verwendung elektronischer Systemeverarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Satz: Hans-Jürgen Paasch, Oeste
Korrektorat: Mandy Kirchner, Weida
Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg
ISBN 978-3-95510-245-6eISBN 978-3-95510-252-4
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Tobias Arand
Wo die »nord- und süddeutsche Waffenbrüderschaft den festen Blutkitt erhielt« –
Zum historischen Hintergrund der ›Fröschweiler Chronik‹
Christian Bunnenberg
»Ein Volksbuch ersten Ranges und als solches unübertroffen« –
Karl Klein und die ›Fröschweiler Chronik‹
Tobias Arand
Ein »Herold deutschen Waffenruhms« –
Ernst Zimmer und die Illustrationen der ›Jubelausgabe‹ der ›Fröschweiler Chronik‹
Karl Klein
Fröschweiler Chronik. Kriegs- und Friedensbilder aus dem Jahr 1870
Literatur und Quellen
Abbildungsnachweis
Danksagung
Personenverzeichnis
Vorwort der Herausgeber
In einer Ausgabe der ›Fröschweiler Chronik‹ aus dem Jahr 1911, erworben in einem Antiquariat, fand sich eine zwischen den Buchseiten getrocknete Kornblume eingelegt, sowie ein Zettel »Vom Schlachtfeld bei Wörth«. Dieser beglückende Fund verweist auf mehrere wichtige Aspekte dieses Buches und der Erinnerungskultur zu den sogenannten ›Einigungskriegen‹ im Allgemeinen und zur ›Schlacht von Wörth-Fröschweiler‹ im Speziellen. Die Kornblume, die Lieblingsblume der Königin Luise von Preußen (1776–1810), galt als die ›preußische Blume‹ schlechthin, aber auch als Symbol des militärischen Widerstands gegen den Luise verhassten Napoleon I. Am 19. Juli 1870, dem Tag der offiziellen französischen Kriegserklärung an Preußen, besuchten König Wilhelm I. und Kronprinz Friedrich Wilhelm das Kenotaph der Mutter und Großmutter Luise im Charlottenburger Mausoleum. Bei dieser Gelegenheit sollen sie ihr zu Ehren einen Kornblumenstrauß niedergelegt und so den kommenden Krieg symbolhaft in eine Kontinuität zu den ›Befreiungskriegen‹ der Jahre 1813 bis 1815 gestellt haben. Dem späteren Schlachtfeldbesucher, der sich eine Kornblume vom Originalschauplatz pflückte und sie in seine Ausgabe der Chronik legte, müssen diese Zusammenhänge nicht nur bewusst gewesen sein, er muss sich auch explizit mit den durch die Kornblume ausgedrückten Kontinuitätslinien und antifranzösischen Sinndeutungsangeboten identifiziert haben.
Der Umstand, dass der unbekannte Schlachtfeldtourist die Kampfstätte und ihre Denkmäler mit einer Ausgabe der ›Fröschweiler Chronik‹ unter dem Arm besuchte, verweist auf die große Popularität dieses Kriegsbuches. Diese Popularität verdankte die Chronik vielleicht nicht nur der Tatsache, dass sie sich in ihrer Drastik der Grausamkeiten des Krieges und der ungeschönten Darstellung der Auswirkungen einer Schlacht auf die betroffenen Zivilisten erkennbar von der sonst üblichen, in Tausenden Titeln erscheinenden patriotischen ›Hurraliteratur‹ des Kaiserreichs abhob, sondern auch ihrer volkstümlichen Sprache und Unmittelbarkeit. Die ›Chronik‹ bot so ein gut verständliches Gegennarrativ zur üblichen unkritisch-naiven Kriegsverherrlichung, war aber trotzdem auch für ›kleindeutsche Patrioten‹ anschlussfähig, wurden doch bei aller deutlichen Kritik Kleins an den Begleiterscheinungen des Krieges Kaiser und Reich von ihm in keiner Weise infrage gestellt.
Schließlich ist der Zettel mit dem Hinweis auf den Fundort der Kornblume ein Beleg für das Phänomen des Schlachtfeldtourismus, der sich nach dem Krieg auf den alten französischen, seit 1871 deutschen Kampfstätten von Weißenburg, Spichern, Metz und auch Wörth-Fröschweiler entwickelte. Bahnlinien wurden eingerichtet, damit Touristen die Schlachtfelder mit ihren bald zu Hunderten errichteten Denkmälern besichtigen konnten. Ein Besuch an den Orten, an denen die deutsche Einheit mit Blut errungen wurde, galt bald als patriotische Pflicht. Auch Hinterbliebene, die die Gräber ihrer Toten besuchen wollten, fuhren in den Jahrzehnten vor 1914 auf die Schlachtfelder. Veteranen blickten noch einmal auf ihre Jugend zurück und erinnerten sich vielleicht nicht nur der Siege, sondern auch der Schrecken des Kampfes. Gedruckte Reiseführer konnten vor Ort gekauft, die darin angebotenen Besichtigungswege in kilometerlangen Märschen abgelaufen werden. Wer müde, durstig oder hungrig war, fand in den ›Wallfahrtsorten‹ Restaurants, Kneipen und mehr Betten als Einwohner vor. Schließlich konnte man nach den ausgedehnten Wanderungen noch aus einem reichhaltigen Angebot an Bildkarten mit Schlachtszenen und Denkmälern wählen und mit der Post auch die ›Lieben daheim‹ an der nationalen Pilgertätigkeit teilhaben lassen.
Auch unser unbekannter Schlachtfeldtourist wird sich als Teil dieser proborussisch-kleindeutschen Feierkultur verstanden haben und sich deshalb in zustimmender Absicht die Kornblume als Erinnerungsstütze an die erhebenden Tage auf dem Schlachtfeld von ›Wörth-Fröschweiler‹ gepflückt haben. Die dortige ›Walstatt‹ galt ganz besonders als ›deutsches‹ Schlachtfeld, erhielt doch hier, wie es das Vorwort der ›Jubelausgabe‹ der Chronik formuliert, die »nord- und süddeutsche Waffenbrüderschaft« ihren »Blutkitt« durch den gemeinsamen Kampf von Preußen, Bayern und Württembergern.
Die Schilderungen des Krieges und des Leides der Zivilisten haben bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren. Noch heute kann man mit der Chronik im Gepäck das kaum veränderte Schlachtfeld von Wörth-Fröschweiler abwandern und sich von den Schilderungen Karl Kleins ergreifen lassen. Wenn die Herausgeber, die regelmäßig und seit bald 20 Jahren mit ihren Studierenden die Orte des Geschehens rund um Wörth besuchen, an den authentischen Stellen des Geschehens Passagen aus der ›Fröschweiler Chronik‹ vorlesen, herrscht meist Stille und Betroffenheit macht sich breit. Das Thema ›Krieg‹, für einige friedliche Jahrzehnte in Europa scheinbar verschwunden, ist leider spätestens wieder aktuell, seitdem Großmächte in Europa kleinere Nachbarn überfallen, ihnen Land rauben und jahrelang unter Spannung halten dürfen. Die heutige Jugend sieht, dass ihre persönliche Sicherheit in Zeiten der Bedrohung durch den ›Brexit‹, Aushöhlung des Rechtsstaates in einigen Mitgliedsländern der EU, Bürgerkriege in Syrien und Libyen, Aggressionen aus dem Osten und Angriffe eines vier lange Jahre lang zerstörerisch wirkenden Demokratiefeinds im ›Oval Office‹ nicht wirklich größer ist als die ihrer Altersgenossen der Jahre 1870, 1914 oder 1939.
Auch wenn die ›Fröschweiler Chronik‹ an vielen Stellen also eine bewegende Anklage gegen den Krieg ist, erfolgt ihre kritisch kommentierte Neuveröffentlichung trotzdem nicht in rein affirmativer Absicht. Vielmehr soll hier eine wichtige, für Jahrzehnte vergessene Quelle wieder in den wissenschaftlichen Diskurs eingespeist, aber auch für jeden Interessierten/jede Interessierte durch die Kommentierung lesbar gemacht werden. Wenn die Chronik nicht unkritisch gelesen und publiziert werden kann, liegt dies auch in der Person ihres Autors begründet. Denn Karl Klein war in jeder Hinsicht ein Mensch des 19. Jahrhunderts und einige seiner Meinungen und Haltungen sind nur im Kontext der Zeit zu verstehen und zu beurteilen, ohne dass man sie heute noch teilen muss. Als weißer, heterosexueller Mann, protestantischer Pfarrer und Bürger einer Großmacht zu Beginn ihrer imperialistisch-kolonialen Phase vertritt er an manchen Textstellen Positionen, die heute als sexistisch, nationalistisch, rassistisch, antijudaistisch und islamfeindlich bezeichnet werden müssten, letztlich aber vor allem seiner Sozialisation und seiner Zeit geschuldet sind. Klein ist kein Rassenantisemit – diese vergiftende Ideologie ist zur Zeit der Chronik noch nicht ausformuliert – und sein Alltagsrassismus hat letztlich keine erkennbaren Auswirkungen auf sein Handeln. Für den verwundeten Turko empfindet er nicht weniger Mitleid als für dessen sterbenden ›weißen‹ Kameraden.
Die Chronik ist aber trotz der Einwände gegen die eine oder andere Textstelle eine bedeutsame Quelle für die Auswirkungen des Krieges auf den Mikrokosmos ›Dorf‹ und für die Verarbeitung der Schrecken durch die Zeitgenossen. Sie ist damit auch eine Quelle für einen meist übersehenen Teil der Rezeptionsgeschichte eines Krieges, dessen im öffentlichen Raum vor allem durch noch heute sichtbare Jubeldenkmäler und Straßennamen gedacht wurde. Diese militaristischen und monarchistischen Denkmäler und Straßennamen prägen so noch immer – wenngleich von den heutigen Zeitgenossen in der Regel unbemerkt und unverstanden – das Bild des 70/71-Krieges. Wenn die Lektüre der ›Fröschweiler Chronik‹ dieser Prägung einen kritischeren Geist entgegenzusetzen vermag, wäre ein wichtiges Ziel dieser Edition erreicht.
Ludwigsburg/Bochum im Februar 2021
Tobias Arand/Christian Bunnenberg
Wo die »nord- und süddeutsche Waffenbrüderschaft den festen Blutkitt erhielt« – Zum historischen Hintergrund der ›Fröschweiler Chronik‹
Tobias Arand
Karl Kleins ›Fröschweiler Chronik‹ steigt mit großer Unmittelbarkeit in ihr kriegerisches Thema ein. Schon auf der zweiten Seite heißt es mit eindeutig antifranzösischem Unterton: »Und siehe, das Gewitter stieg am Himmel immer höher, immer dunkler, bis am 19. Juli ein Blitz mit krachendem Donner die Brandfackel in Preußens Hauptstadt warf.«1
Das Wissen um die Vorgeschichte des Deutsch-Französischen Krieges kann Karl Klein bei seinen Lesern offensichtlich voraussetzen. Im 21. Jahrhundert hingegen ist der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 weitgehend vergessen, obwohl im Umfeld seines 150. ›Jubiläums‹ im Jahr 2020 einige Publikationen2 und Ausstellungen3 versucht haben, neues Interesse auf ihn zu lenken. Dass der Krieg durch Denkmäler, Sedanstraßen und Bismarckplätze noch immer im öffentlichen Raum wohl jeder deutschen Stadt präsent ist, ändert an seiner Vergessenheit nichts. Welcher Passant denkt, wenn er durch eine Weißenburgstraße flaniert, noch an eine Schlacht vom 4. August 1870? Wie kam es also zu einem Krieg, der Monate dauern und an dessen Ende ca. 200 000 Menschen tot sein sollten? Wie verlief er und welche Bedeutung kam der Schlacht von Wörth-Fröschweiler zu?
Die beiden ersten ›Einigungskriege‹ von 1864 und 1866
Nach dem Sieg gegen Frankreich und der ›in Feindesland‹ erfolgten Reichsgründung wurde der Krieg von 1870/71 in Deutschland als letzter der ›Einigungskriege‹ gefeiert. Die ›Einigungskriege‹ galten dort als der gewaltige Plan Otto von Bismarcks zur Vollendung der angeblichen ›deutschen Aufgabe‹ Preußens, die in der Gründung eines ›kleindeutschen‹ Staats ihre Erfüllung gefunden hatte. Tatsächlich nutzte Bismarck, seit 1862 preußischer Ministerpräsident, nur situativ Gelegenheiten, die sich ihm boten, einen schon im Voraus geschmiedeten Plan hatte er nicht. Allerdings war Bismarck davon überzeugt, dass eine Nationalstaatsgründung nicht zu vermeiden sei, sie aber anders als beim Versuch von 1848/49, der ersten bürgerlichen deutschen Revolution, nicht von ›unten‹, vom Volk, sondern von ›oben‹, den Fürsten, gesteuert würde und vor allem unter preußischer Regie zu erfolgen habe. Gerade zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt, bekräftigte er diese Ansicht im September 1862 bei einer berühmten Rede vor dem Haushaltsausschuss des preußischen Landtags, als er erklärte, dass die deutsche Einheit durch »Eisen und Blut« und nicht durch »Majoritätsbeschlüsse«4 vollzogen werden müsse. Unverhüllt deutete Bismarck hier eine auf dem Weg des Krieges zu vollziehende, antidemokratische Reichseinigung an. Hintergrund der Rede war der Versuch König Wilhelms I., gegen den Willen des liberal dominierten preußischen Landtags eine kostspielige Heeresreform durchzuführen, die u. a. eine Verlängerung des Wehrdienstes vorsah. Dass diese Heeresreform vor allem im Hinblick auf zu führende Kriege geplant wurde, war den Zeitgenossen ein naheliegender Gedanke; dass diese Kriege aber unweigerlich in einer Reichsgründung münden würden, kann niemand, auch Bismarck nicht, bereits 1862 gewusst haben.
Die erste Gelegenheit, die Sinnhaftigkeit der gegen den Willen des Landtags und damit auf dem Wege des Verfassungsbruchs durchgeführten und finanzierten Heeresreform zu beweisen, ergab sich für König Wilhelm I., Bismarck und den preußischen Kriegsminister Albrecht von Roon in den Jahren 1863 und 1864. In einem Konflikt, der sich um die Behandlung der deutschsprachigen Minderheit im Herzogtum Schleswig, Lehen des dänischen Königs, und um eine verwickelte dynastische Frage entzündete, wurde 1863 zunächst die Bundesexekution des Deutschen Bundes gegen Dänemark vollzogen, bevor es im Februar zu einem Krieg kam. Im Februar 1864 überschritten preußische und österreichische Truppen die dänische Grenze und besiegten das nordische Königreich innerhalb weniger Monate.5
Im Deutsch-Dänischen Krieg, später als der erste ›Einigungskrieg‹ gefeiert, konnten die preußischen Truppen zum ersten Mal seit den ›Befreiungskriegen‹ gegen Napoleon I. und der Niederschlagung der Revolution in Baden 1849 wieder ihre Kampfkraft beweisen. Besonders der am 18. April vollzogene preußische Sturm auf die ›Düppeler Schanzen‹, die den Übergang zur Ostseeinsel Alsen deckten, erhielt später einen bleibenden Platz im kollektiven deutschen Gedächtnis. Der Aufstieg Preußens zur gefürchteten Militärmacht hatte sichtbar für alle Welt begonnen. Im Vertrag von Wien trat Dänemark am 30. Oktober 1864 Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich ab. Schleswig kam unter preußische, Holstein unter österreichische Verwaltung. Das Herzogtum Lauenburg wurde von Österreich an Preußen verkauft.
Mit diesem schnellen Sieg war aus Bismarcks Sicht der erste Beweis erbracht, dass sich die Heeresreform bewährt hatte. Zugleich waren nun Schleswig und Holstein nicht mehr Teile Dänemarks, sodass auch die deutschnationalen Kräfte fürs Erste befriedigt waren.
Doch schon zwei Jahre später nutzte Bismarck die nächste Gelegenheit, den seit dem 18. Jahrhundert, seit den Angriffen König Friedrichs II. auf Schlesien, schwelenden deutschen Dualismus zugunsten Preußens zu entscheiden. Die Frage, ob ein künftiges geeintes ›Deutschland‹ mit oder ohne Österreich zu gründen sei und welcher der beiden einzigen deutschsprachigen Großmächte dann die Führungsrolle zustünde, war in den Jahren zuvor hochumstritten. Der Süden, vor allem die Königreiche Württemberg und Bayern, dachte ›großdeutsch‹, also mit Einbezug Österreichs, während nördlich des Mains überwiegend ›kleindeutsch‹, bzw. richtiger formuliert ›großpreußisch‹, gedacht wurde. 1866 inszenierte Bismarck in der Frage der Verwaltung von Schleswig und Holstein einen künstlichen Streit mit Österreich, das den Vorsitz des ›Deutschen Bundes‹ innehatte. Ergebnis dieses Streits war der Austritt Preußens aus dem ›Deutschen Bund‹ und ein nachfolgender Krieg. Preußen und seine norddeutschen Verbündeten, u. a. das Großherzogtum Oldenburg und die Hansestädte, besiegten in diesem ›Deutschen Krieg‹ die Bundestruppen, deren größte Kontingente von Österreich, Württemberg, Bayern, Baden, Sachsen, Hessen und Hannover gestellt wurden.6 Gleichzeitig kämpfte Österreich noch gegen Italien um die österreichischen Gebiete der Lombardei und des Veneto. Bei der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866 zeigten sich die Überlegenheit der neuen preußischen Hinterladergewehre über die österreichischen Vorderlader und das taktische Genie Helmuth von Moltkes, des Leiters des preußischen ›Großen Generalstabs‹. Insbesondere die virtuose Nutzung des Eisenbahnnetzes durch Moltke ermöglichte die punktgenaue Konzentration der preußischen Kräfte am entscheidenden Tag von Königgrätz.7
Als Folge dieses zweiten ›Einigungskrieges‹ schied Österreich aus dem ›Deutschen Bund‹ aus, der daraufhin aufgelöst und 1867 als ›Norddeutscher Bund‹ neugegründet wurde. Zugleich verlor Österreich auch seine letzten Besitzungen in Norditalien. Hannover, Teile Hessens und die Freie Stadt Frankfurt a. M. wurden von Preußen ohne lange Diskussionen einfach einverleibt, die unterlegenen süddeutschen Staaten Baden, Württemberg sowie Bayern unter Zwang in sogenannten ›Schutz- und Trutzbündnissen‹ militärisch an Preußen gekettet. Im Kriegsfall mussten sie nun Preußen nicht nur zur Seite stehen, sondern gleichzeitig den Oberbefehl des preußischen Königs akzeptieren. Dass das Oberhaupt des ›Norddeutschen Bundes‹, dem nun alle deutschen Staaten nördlich des Mains angehörten, König Wilhelm I. von Preußen war, wurde nicht nur selbstverständlich hingenommen, sondern als Fingerzeig für die Struktur eines künftigen Deutschen Reichs verstanden. Ein Artikel der Verfassung des ›Norddeutschen Bundes‹ regelte bereits einen zukünftigen Beitritt der süddeutschen Staaten, was beweist, dass er von vornherein nur als temporäre Stufe zur ›kleindeutschen‹ Reichseinigung gedacht war.
Mit dem zweiten Sieg preußischer Waffen innerhalb von zwei Jahren hatte Bismarck vielen seiner Kritiker endgültig bewiesen, dass die Heeresreform unter der Prämisse von ›Blut und Eisen‹ als Mittel zur Einheit vielleicht doch sinnvoll war. Viele Nationalliberale, 1848/49 noch durchdrungen von freiheitlichen Prinzipien, opferten diese nun opportunistisch auf dem Altar der siegreichen Macht. Sie arrangierten sich mit Bismarck und seinen Methoden, sahen sie ihn doch auf dem Weg, das ersehnte Ziel zu erreichen. Der preußische Landtag genehmigte nach dem Sieg von 1866 Bismarck rückwirkend seinen Verfassungsbruch, die Heeresreform ohne genehmigten Staatshaushalt durchgeführt zu haben, indem er der sogenannten ›Indemnitätsvorlage‹ des Ministerpräsidenten zustimmte und diesem so ›Pardon‹ gab.
Versuche, ab 1867 eine deutsche Einheit mit Hilfe eines sogenannten ›Zollparlaments‹ vorzubereiten, in dem die Vertreter des ›Norddeutschen Bundes‹ und der Südstaaten gemeinsam über wirtschaftliche Fragen abstimmen sollten, scheiterten am Partikularismus im Süden. Bei den Wahlen zum ›Zollparlament‹ erhielten im Süden Parteien die Mehrheit, die sich einer kleindeutschen Lösung verweigerten. Württemberger, aber noch stärker die katholischen Bayern, fühlten sich Österreich noch immer deutlich näher als dem protestantischen Preußen.
Wenn eingangs gesagt wurde, dass Bismarck 1862 noch kein Konzept für einen kriegerischen Dreischritt zur Einigung hatte, Krieg als Mittel aber grundsätzlich befürwortete, darf für den Zeitpunkt 1866 beim Abschluss der ›Schutz- und Trutzbündnisse‹ tatsächlich von einem Plan ausgegangen werden. Zu diesem Zeitpunkt wird Bismarck seine kriegerischen Absichten aber wohl nicht als alternativlos, sondern lediglich als eine Option betrachtet haben. Der Charakter der Bündnisse war allerdings eindeutig auf eine Situation hin ausgelegt, in der die norddeutschen und süddeutschen Staaten in einem gemeinsamen nationalen Erlebnis, einem großen Krieg, die innere und äußere Einheit – natürlich unter Oberbefehl des preußischen Königs – vollziehen sollten. Was noch fehlte, war ein überzeugender Kriegsanlass. Der aus Bismarcks Sicht nur als gescheitert zu bezeichnende Ausgang der ›Zollparlamentswahlen‹ des Jahres 1867 dürfte ihn bestärkt haben, den militärischen Plan voranzutreiben.
Dass der Gegner im Kriegsfall nun nur noch Frankreich, der vorgebliche ›Erbfeind‹8, sein konnte, lag mehr als nah. Die Frage um die spanische Thronfolge – Königin Isabella II. hatte man zuvor verjagt – wurde von französischer wie von deutscher Seite zum Kriegsgrund stilisiert.9 Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen, Spross einer katholisch-südwestdeutschen Seitenlinie des preußischen Königshauses, wurde mit dezenter Unterstützung Bismarcks der spanische Thron angeboten. Frankreich, in dem wichtige Kreise rund um den alten, schwer kranken Kaiser Napoleon III. ebenso einen Krieg wünschten wie Bismarck, machte aus der Thronfolgefrage mit kräftiger Unterstützung der nationalistischen Presse eine Angelegenheit der Ehre. Man fühlte sich nun vorgeblich von Preußen umzingelt. In Wahrheit hofften Kaiserin Eugénie, ihr Außenminister, Antoine Agénor, Duc de Gramont, und ihr Kriegsminister Edmond Le Boeuf, nach einer Reihe außenpolitischer Fehlschläge und angesichts innenpolitischer Schwierigkeiten mit einem siegreichen Krieg zur Stabilisierung des ›Second Empire‹ beitragen zu können. Bismarck, der den ganzen Vorgang seinerseits mit manipulierten Pressemitteilungen forcierte, sah nun die Gelegenheit für den nationalen Einigungskrieg gekommen. Selbst als Leopold seine Kandidatur zurückzog, wurde bei einem berühmt gewordenen Treffen am 13. Juli 1870 durch den französischen Botschafter auf der Promenade des Kurortes Bad Ems noch Druck auf den dort weilenden König Wilhelm I. ausgeübt, künftig zu erklären, dass sich nie wieder ein derartiger Vorgang wiederholen möge. Der König, bereits ein alter und kriegsmüder Mann, auf dessen eindringlichen Rat hin Leopold gegen den Wunsch Bismarcks die Kandidatur zurückgezogen hatte, empfand das Verhalten des französischen Botschafters Vincent Benedetti mit Recht als Affront (Abb. 1), und schickte ein Telegramm nach Berlin, in welchem er seinen Ministerpräsidenten aufforderte, das Ereignis publik zu machen.
Abb. 1: Postkarte ›König Wilhelm und Benedetti in Bad Ems‹, Privatbesitz
Aus dieser berühmten ›Emser Depesche‹ machte Bismarck eine Pressemitteilung, in der nichts erfunden war, deren subtile Kürzungen in Frankreich aber als nationale Kränkungen empfunden wurden. Am 19. Juli 1870 erklärte Frankreich Preußen daraufhin wie gewünscht den Krieg, nachdem der französische Premier Émile Ollivier sie informell schon am 15. Juli ausgesprochen hatte. Die süddeutschen Staaten, in denen nun viele – aber keineswegs alle – Bürger ebenfalls von nationalem Taumel befallen wurden, mussten aufgrund der Bündnisverpflichtungen ebenfalls in den Krieg ziehen. Bismarck hat später am Mythos mitgestrickt, nur seine Pressemitteilung habe den Krieg ausgelöst; die Zeitgenossen glaubten bereitwillig diesem vorgeblichen Beweis seines überlegenen Geistes. In den Jahren vor seinem Tod nahm die Verehrung Bismarcks, des ›Schmiedes der Nation‹, beinah religiöse Züge an. Heute hingegen ist bekannt, dass auch ohne die Provokation der Bismarck’schen Pressemitteilung Frankreich zum Krieg entschlossen war. Schon am 14. Juli 1870 telegraphierte der württembergische Botschafter in Paris nach Stuttgart, dass die Mobilisierung überall begonnen habe.10 In den folgenden Wochen begann man auf beiden Seiten, die Truppen an den Grenzen zusammenzuziehen.
Die Schlacht von Wörth-Fröschweiler am 6. August 1870
Aufmarsch der Truppen
Die Mobilisierung der Truppen verlief allerdings höchst unterschiedlich. Während die deutschen Kontingente nach einem vorher minutiös festgelegten Eisenbahnplan rasch in ihre Ausgangsstellungen in der Pfalz, damals Teil des Königreichs Bayern, verbracht werden konnten, versank der französische Aufmarsch im Chaos. Regimenter kamen teilweise überhaupt nicht, verspätet oder nur unvollständig in ihren Stellungen an, weil schon zu Beginn viele Soldaten desertierten. Die Magazine waren nicht gefüllt, es fehlte an Munition, Waffen, Pferden und Nahrungsmitteln. Das Günstlingssystem des napoleonischen ›Second Empire‹, das Posten häufig nach Loyalität des Kandidaten zum Kaiser oder Zahlungskraft statt nach Kompetenz vergab, wirkte sich fatal auf die Vorbereitungen eines Krieges aus, von dessen Ausgang die Zukunft des Regimes abhängen sollte. Anders als Kriegsminister Le Boeuf verkündet hatte, war die französische Armee eben doch nicht »bis zum letzten Gamaschenknopf«11 vorbereitet. Stattdessen fanden die Soldaten leere Depots und desorientierte Vorgesetzte vor.
Anders als die deutschen Truppen, in denen Wehrpflichtige dienten, die von Berufs- und Reserveoffizieren befehligt wurden, waren die französischen Kämpfer durchgängig Berufssoldaten, die sich für längere Zeiträume dienstverpflichtet hatten. Mit dem Prestige der siegreichen Kriege auf der Krim 1853–1856 und in Norditalien 1859 verfügten die Franzosen über Kampferfahrung und Selbstbewusstsein, das durch das Fiasko des mexikanischen Abenteuers 1864–1867 allerdings ein wenig gelitten hatte. Der so vergebliche wie irrwitzige Versuch, einen österreichischen Prinzen zum ›Kaiser von Mexico‹ zu machen, hatte die französische Armee Männer und Ansehen gekostet.
Die Franzosen mobilisierten bei Kriegsbeginn ungefähr 320 000 Mann, die Deutschen etwa 500 000. Das III., IV. und V. Korps standen in Thionville (Diedenhofen), St. Avold und Bitsch und bildeten so eine Linie in Nord-Südost-Richtung entlang der Grenze zur Pfalz. Das I. und II. Korps standen in einer zweiten Linie zwischen Metz und Straßburg ebenfalls in nord-südöstlicher Richtung bis an den Rhein. Als Reserve befanden sich die Garde in Metz und das VI. Korps im berühmten ›Lager von Châlons‹. Das VII. Korps stand bei Belfort, im südlichen Elsass. Die dergestalt in zwei Linien aufgeteilte Armee unterstand im nördlichen Abschnitt Marschall François-Achille Bazaine, im südlichen Marschall Patrice de Mac-Mahon, seit den Siegen in Norditalien Herzog von Magenta. Bis zur Ankunft des Kaisers an der Front, der dann das Oberkommando übernahm, trug Bazaine für kurze Zeit die Verantwortung für die ganze Armee.
Die deutschen Truppen teilten sich in drei Armeen auf. Die 1. Armee stand im Raum Trier, die 2. bei Mainz, die 3. bei Speyer. Das Oberkommando über die 3. Armee führte der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm, später im Jahr 1888 für nur wenige Monate Friedrich III. als deutscher Kaiser. Viele Soldaten hatten weite Wege mit der Eisenbahn zurückgelegt, jene aus den preußischen Ostprovinzen dabei zum Teil 1000 km, bevor sie die letzten Kilometer in ihre Lager unter der sengenden Julisonne marschieren mussten. Manche Wehrpflichtige, die solche Strapazen nicht gewohnt waren, starben bereits bei diesen Anstrengungen. Während in der 1. und 2. deutschen Armee nur preußische und norddeutsche Truppen dienten, galt die 3. Armee als die ›deutsche Armee‹, standen in ihr doch zusätzlich noch badische, württembergische und bayerische Regimenter. Im Gefolge der deutschen Truppen befanden sich bemerkenswerterweise noch Literaten, Maler und Journalisten. Von Beginn an plante und manipulierte die deutsche Führung die Berichterstattung über den Krieg mit Hilfe dieser ›embedded journalists and artists‹. Die mitreisenden Schriftsteller und Maler sollten den Krieg und die deutschen Siege in die erhofften glorreichen Worte und Bilder kleiden.
Die jeweils unterschiedlich erfolgreichen Aufmärsche waren Ende Juli 1870 abgeschlossen.
Die Kämpfe Anfang August12
Anders als im weiteren Verlauf des Krieges waren die Schlachten im August 1870 noch Teil eines klassischen Bewegungskrieges. Truppen trafen aufeinander, Besiegte zogen sich zurück, Sieger folgten, bis man sich an anderer Stelle wieder traf und aufs Neue bekämpfte. Die monatelangen Belagerungen von Paris, Metz und vieler kleinerer Festungen, der Kampf gegen irreguläre Freischärler, das Verwüsten und Ausrauben ganzer Landstriche entlang der Loire und die Repressalien gegen französische Zivilisten sind Ereignisse, die erst ab September 1870 allmählich einsetzten. Der August 1870 war der Monat der großen mythenumrankten Schlachten, die in rascher Folge den französischen Boden mit Blut tränkten, weil beide Seiten – vergeblich – die rasche Entscheidung suchten.
Der französische, völlig realitätsferne Feldzugsplan sah vor, entlang der Mainlinie auf deutsches Territorium vorzudringen und die südlichen von den nördlichen Ländern zu trennen. Dann sollte der süddeutsche Partikularismus genutzt werden, um die Südländer für ein Umschwenken und einen Krieg gegen Preußen zu gewinnen. Symptomatisch für die verhängnisvolle Mischung aus Überheblichkeit und Schlamperei bei der Vorbereitung des Krieges ist der Umstand, dass die französischen Offiziere nur Karten deutscher Gebiete, nicht aber Lothringens und des Elsass im Marschgepäck gehabt haben sollen. Karten des Elsass und Lothringens hätten der französischen Armee allerdings mehr genutzt, weil der Krieg bis auf eine kurze Ausnahme ausschließlich in Frankreich stattfand. Diese Ausnahme war die kurze Besetzung Saarbrückens am 2. August, die den Auftakt des Krieges bildete. Das II. Korps unter General Charles Auguste Frossard, Teil des nördlichen Abschnittes der französischen Armee, ging über die Saar und rückte nach kurzem Gefecht mit etwa 1000 Mann in Saarbrücken ein. Da dieses Vorrücken von keinerlei strategischem Konzept begleitet, sondern nur einem wenig hilfreichen Einfall Napoleons III. entsprungen war, zog sich Frossard am 5. August wieder zurück. Seine Truppen besetzten die Höhen von Spichern, südlich von Saarbrücken, bereits wieder auf französischer Seite gelegen.
Abgesehen von diesem Angriff ging die weitere Initiative im August 1870 von der deutschen Seite aus. Einen Tag vor Frossards Rückzug war es bereits am 4. August zur ersten richtigen Schlacht gekommen. Teile der 3. Armee unter Führung des Kronprinzen hatten bei Weißenburg (Wissembourg) die Grenze des nördlichen Elsass zur Pfalz überschritten. Das III. preußische Korps und die 4. bayerische Division trafen hier auf eine französische Division unter dem Kommando des Generals Abel Douay. Die Division Douays, Teil des I. Korps unter Mac-Mahon, stand getrennt vom südlichen Teil des französischen Hauptheers und so von vornherein auf verlorenem Posten. Bei schwülwarmer Hitze und auf einem vom Sommerregen durchnässten Boden kam es zu einem schweren Kampf, bei dem die deutschen Truppen zum ersten Mal auch auf die in ihren Augen exotisch-wilden ›Turkos‹ trafen. Die ›Turkos‹ waren nordafrikanische Kolonialtruppen. Ihre Kämpfer waren meist dunkelhäutig und trugen orientalische Uniformen. Sowohl von ihren weißen französischen Offizieren als auch von den deutschen Gegnern wurden sie mit rassistischer Herablassung behandelt und angesehen. Ebenfalls lernten die Deutschen bei Weißenburg die gefürchtete Wunderwaffe der Franzosen, die ›Mitrailleuse‹, eine Frühform des Maschinengewehrs kennen. Anders als die Maschinengewehre des Ersten Weltkriegs saß das Geschützrohr der Mitrailleuse aber auf einer festen Lafette, war nicht drehbar und hatte somit nur eine geringe Streuung. Die Wirkung der Mitrailleuse war daher mehr psychologischer, als tatsächlich militärischer Natur. Die Überlegenheit des französischen Chassepot-Gewehrs, eines Hinterladers mit deutlich größerer Reichweite als der preußische Dreyse-Hinterlader, lernten die Deutschen jedoch ebenfalls bei Weißenburg kennen. Diese überlegene Reichweite erlaubte es den Franzosen, aus einer defensiven Position zu operieren, weil die Deutschen näher an den Feind kommen mussten, um ihn zu treffen. Die Folge waren deutsche Angriffe auf gut gewählte französische Abwehrstellungen, die bei einer Personalüberlegenheit von 2:1 unter Inkaufnahme erheblicher Verluste trotzdem von den Deutschen gewonnen werden konnten. Wenn genügend Deutsche den Angriff bis zum unmittelbaren Feindkontakt überlebten, wurden die französischen Stellungen im Nahkampf genommen. Dieses selbstmörderische Prinzip prägte die meisten Aktionen auf den Schlachtfeldern des August 1870. Die entscheidende Folge der Schlacht, bei der auf deutscher Seite 700 Mann und 76 Offiziere getötet oder verwundet wurden, war die Trennung des südlichen vom nördlichen Teil der französischen Armee. General Abel Douay fiel im Kampf. Die geschlagenen französischen Truppen zogen sich gemeinsam mit dem weiteren Rest des I. Korps unter Mac-Mahon nach Südwesten Richtung Wörth (Woerth-en-Alsace) zurück.
Kurz nach dieser ersten Schlacht kam es später im Deutschen Reich zum legendenumrankten Tag der Doppelschlachten vom 6. August 1870. Regimenter der 1. deutschen Armee stürmten die Spicherer Höhen, die von drei Divisionen des II. Korps unter Frossard verteidigt wurden. Wie in Weißenburg, nur unter deutlich schwierigeren topographischen Bedingungen, waren die selbstmörderischen deutschen Angriffe erfolgreich. Unter hohen Verlusten konnten die Höhen genommen und der nördliche Teil der französischen Armee unter Bazaine zum Rückzug Richtung Metz gezwungen werden.
Der Verlauf der Ereignisse von Wörth-Fröschweiler am 6. August 1870
Zeitgleich zu den dramatischen Ereignissen bei Spichern entwickelte sich das Drama der Schlacht von Wörth-Fröschweiler (Froeschwiller). Mac-Mahons Korps hatte sich eine sehr geeignete Position gewählt, um die 3. deutsche Armee zu erwarten. Noch heute sind Topographie und Straßenführung, wie sie am 6. August 1870 vorlagen, weitgehend unverändert nachzuvollziehen. Wörth liegt an einem Flüsschen, der Sauer, die in Nord-Süd-Richtung durch ein schmales Tal zwischen Erhebungen im Westen und Osten fließt. Westlich von Wörth steigt ein steiler Hohlweg – die ›Wörther Hohl‹ – die Hänge hinauf, der etwa 2 Kilometer weiter zum höher gelegenen Dorf Fröschweiler führt. Von den östlich Wörths liegenden Hängen führt eine Straße, von Sulz unterm Wald (Soultz-sous-Forêts) kommend, ins Tal zum Ort hinab. Südlich von Fröschweiler liegt Elsasshausen, im Jahr 1870 nur eine Ansammlung von wenigen Höfen. Von Wörth führt ein ebenfalls steil ansteigender Weg in westsüdwestlicher Richtung nach Elsasshausen. Parallel zur Sauer verläuft eine Straße in Nord-Süd-Richtung durch das Tal, im Norden nach Langensulzbach (Langensoultzbach), im Süden nach Gunstett und Morsbronn. Nördlich und südlich von Wörth decken Wälder die westlichen Anhöhen. Die westlichen Hänge waren 1870 noch – anders als heute – stellenweise mit Hopfen und Wein bepflanzt.
Mac-Mahons Truppen, das I. Korps und eine Division des VII. Korps, besetzten die Hänge westlich von Wörth und versperrten den Deutschen so den Weg zu den Höhenzügen der Vogesen, welche die 3. Armee überqueren musste, um ins Innere Frankreichs zu gelangen. Erste kleinere französische Einheiten standen schon seit Ende Juli in Fröschweiler und im wenige Kilometer entfernten Niederbronn (Niederbronn-les-Bains) in Reserve. Das chaotische Heerlager, das sich in Fröschweiler ab dem 5. August 1870 als Folge des Rückzugs von Weißenburg bildete, beschreibt Pfarrer Klein anschaulich in seiner Chronik. (Abb. 2)
Die 3. deutsche Armee näherte sich Wörth auf drei Straßen. Von Norden kamen das II. Bayerische Korps, von Osten das V. und XI. norddeutsche Korps – hauptsächlich Preußen, aber auch Sachsen –, etwas südlicher näherte sich die württembergische Felddivision. Da Kronprinz Friedrich Wilhelm ursprünglich davon ausgegangen war, dass sich Mac-Mahon nach Süden Richtung Straßburg zurückziehen wollte, hatte er den Marsch Richtung Hagenau befohlen. Als er jedoch Mac-Mahons Stellung westlich von Wörth gewahr wurde – die Aufklärung feindlicher Positionen war in einem Zeitalter ohne Drohnen oder Satelliten noch ein schwieriges und häufig unzuverlässiges Geschäft – wurde der Schwenk der 3. Armee nach Westen befohlen. Der linke Flügel, auf dem die Württemberger standen, hatte den weitesten Weg infolge des Schwenks zurückzulegen und stand so am 5. August noch am weitesten vom Ort des späteren Geschehens entfernt. Aus diesem Grunde war ein Angriff auf die Stellungen Mac-Mahons erst für den 7. August geplant, wenn die zahlenmäßige deutsche Überlegenheit groß genug gewesen wäre, um einen erneut verlustreichen Sturm zu wagen.
Abb. 2: Schlachtverlauf, in: Klein 1912, Anhang
Doch es kam schon am 6. August zur Schlacht.13 Bei verhangenem Himmel und nach stundenlangem Regen begann die Schlacht auf dem matschig-durchweichten Feld durch ein zufälliges Scharmützel bei Tagesanbruch. Deutsche Reiter, die ihre Pferde an der Sauer tränken wollten, stießen unerwartet auf Franzosen. Der folgende Schusswechsel gab das Signal zum Beginn der Kämpfe. Um 7 Uhr wurde das unbesetzte Wörth genommen. Ein bayerischer Angriff auf die Hügel am linken französischen Flügel, hier standen die ›Turkos‹, wurde um 10 Uhr 15 mit Befehl des Kronprinzen zum Rückzug unterbrochen, vermutlich um den Kampf für diesen Tag zu verschieben und auf das Nachrücken der noch fehlenden Teile des linken deutschen Flügels zu warten. Die Dynamik des beginnenden Kampfes ließ sich zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr stoppen. Gegen 10 Uhr hatte die preußische Artillerie des V. Korps 108 Geschütze auf den Hängen östlich von Wörth – dem sogenannten ›Preuschdorfer Hügel‹ – in Stellung gebracht und begann mit dem verstärkten Beschuss der französischen Positionen. Unter dem Schutz des Artilleriebeschusses versuchten preußische Regimenter den Übergang über die durch den Regen und das Öffnen eines Stauwehrs stark angeschwollene Sauer – die Brücken hatten die Franzosen zuvor zerstört. Anschließend sollte gegen die Hänge vorgegangen werden. Trotz großer Verluste dieser Regimenter konnte bei diesem Vorgehen bis 12 Uhr kein Erfolg verzeichnet werden. Südlich von Wörth, bei Gunstett, hielten preußische Stellungen nur mühsam einem französischen Gegenangriff stand. Die durch Zufall und entgegen den eigentlichen Planungen begonnene Schlacht drohte sich für die deutsche Seite zu einem Fehlschlag zu entwickeln. Als gegen 13 Uhr endlich der Kronprinz von Sulz kommend mit weiteren Regimentern auf dem Schlachtfeld erschien und wahrnahm, dass sein Befehl nicht befolgt worden war, wendete sich jedoch das Blatt. Vom ›Preuschdorfer Hügel‹ aus befahl der Kronprinz nun konzentrierte Angriffe an allen Abschnitten, um so die Situation zu retten. Am rechten deutschen Flügel gingen die Bayern wieder vor, in der Mitte wurde der Sturm auf die ›Wörther Hohl‹ fortgesetzt. Bis 15 Uhr konnten die Regimenter des XI. preußischen Korps gemeinsam mit den inzwischen zum Teil eingetroffenen Württembergern am linken deutschen Flügel vordringen und sich Richtung Elsasshausen bewegen. Ein französischer Kavallerieangriff, der gegen 13 Uhr erfolgte, wurde bei Morsbronn zusammengeschossen. Zwischen 15 und 16 Uhr brachen die Deutschen schließlich in ganzer Breite durch, was auch ein gegen 15.30 Uhr erfolgter zweiter französischer Kavallerieangriff zwischen Fröschweiler und Elsasshausen nicht mehr verhindern konnte. Über die ›Wörther Hohl‹, von Elsasshausen und von den nördlichen Hängen kommend, stießen nun Bayern, Württemberger und Preußen gegen Fröschweiler vor, das im erbitterten Nahkampf verteidigt wurde. (Abb. 3)
Abb. 3: Postkarte ›Der Todesritt der Kavalleriedivision Bonnemains‹, Privatbesitz
Fröschweiler, das stundenlang in Schussweite der deutschen Artillerie lag und zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise in Brand stand, wurde bei diesen Kämpfen noch weiter zerstört. Nach der Einnahme Fröschweilers flohen Mac-Mahon, seine Offiziere und Soldaten der französischen Armee auf der steil abfallenden Chaussee ins einige Kilometer westlich gelegene Reichshofen (Reichshoffen) und weiter nach Niederbronn. Dem Umstand, dass Mac-Mahon von Reichshofen aus seinem Kaiser die neuerliche Niederlage telegraphierte, verdankt die Schlacht im Französischen den irreführenden Namen ›Bataille de Reichshoffen‹, während sie im Deutschen in der Regel als ›Schlacht von Wörth‹ bezeichnet wird.
Bei der chaotischen und panischen Flucht verlor Mac-Mahon sein luxuriöses Zeltlager, das in deutsche Hände fiel. Die dabei gefundene seidene Unterwäsche des Marschalls rief bei den Deutschen Staunen und Belustigung hervor. Eine Verfolgung der fliehenden Franzosen unterblieb weitgehend, da auch die Sieger von dem stundenlangen Gemetzel erschöpft waren. Am späten Nachmittag war der Kampf beendet.
Die Verlustzahlen – 10 500 deutsche Tote und Verwundete bei etwa 8000 toten und verwundeten Franzosen – zeigen, dass auch hier das zynische Kalkül, das schon in Weißenburg erfolgreich war, aufging. Gleichzeitig belegt der Umstand auch die motivationale Überlegenheit der deutschen Truppen, da es den Deutschen trotz des erneut schwierigen Angriffs auf befestigte Anhöhen gelang, den Sieg zu erringen. Hier glaubten viele Krieger zu wissen, wofür sie kämpften: Die deutsche Einheit. Den französischen Kämpfern hingegen fehlte bei aller persönlichen und professionellen Tapferkeit ein überzeugendes Motiv für einen Krieg, in dem sie ihr Leben für eine dynastische Frage riskieren sollten. Entscheidend für den Sieg war allerdings letztlich die deutlich überlegene deutsche Artillerie. Die Gussstahlkanonen der Firma Krupp aus Essen waren den Bronzerohren der Franzosen so deutlich überlegen, dass der deutsche Granatbeschuss auf entscheidende Weise die Sturmangriffe flankieren konnte.
Als Folge des Sieges stand den Deutschen nun der Weg durch die Vogesen offen. Die Reste des südlichen Teils der französischen Armee zogen unter Mac-Mahon Richtung Westen, bis sie im ›Lager von Châlons‹ ankamen und dort zum Teil erneuert werden konnten. Die 3. deutsche Armee zog wochenlang parallel zur französischen Armee Richtung Westen. Erst nach dem legendären Rechtsschwenk der 3. deutschen Armee vom 26. August 1870 trafen beide Armeen am 30. August bei Beaumont und am 1. September bei Sedan wieder aufeinander. Die nördlichen Truppenteile unter Bazaine lieferten der 1. und 2. deutschen Armee in drei verlustreichen Kämpfen – 14. August ›Schlacht von Colombey-Nouilly‹, 16. August ›Schlacht von Vionville/ Mars-la-Tour‹, 18. August ›Schlacht von Gravelotte/St. Privat‹ – rund um Metz vergeblichen Widerstand, bevor sie sich in die Festung der Stadt zurückzogen. Erst im Oktober 1870 kapitulierten die völlig ausgezehrten Truppen Bazaines nach monatelanger Belagerung.
Die französische Niederlage bei Sedan besiegelte mit dem Gang Napoleons III. in die deutsche Gefangenschaft das Ende des Kaiserreichs. Der folgende Krieg gegen die 3. französische Republik sollte bis in den Januar 1871 hinein andauern und erbittertste Formen annehmen.
Die Tage nach der Schlacht von Wörth-Fröschweiler
Am eindringlichsten ist die ›Fröschweiler Chronik‹ in der Schilderung des Leides der Zivilbevölkerung, die erst von einer Kriegswalze überrollt wird und dann für lange Zeit, als der Krieg schon weitergezogen ist, die Folgen tragen muss. Doch auch die Berichte über die Leichenfelder und die Versorgung der oft grauenvoll verwundeten Soldaten sind von Empathie und großer Bildhaftigkeit geprägt.
Als am Abend des 6. August Kronprinz Friedrich Wilhelm siegreich über das Schlachtfeld ritt und sich in Fröschweiler von seinen Kriegern mit Hurrarufen und Gesang feiern ließ, bedeckten Tausende Leichen den Raum zwischen Morsbronn, Gunstett, Elsasshausen, Wörth und Fröschweiler. Doch nicht nur Gefallene lagen in oft unbeschreiblichen Zuständen der Verstümmelung auf dem Schlachtfeld, auch ungezählte tote und aufgerissene Pferde bedeckten die umgepflügten Äcker und Felder. Ebenso viele Sterbende lagen in den behelfsmäßigen Lazaretten oder noch unentdeckt hinter Mauern, in Hopfenfeldern oder im Wald. Die Hilferufe und das Stöhnen der Sterbenden raubten vielen siegreichen, aber eigentlich erschöpften Kämpfern in der Nacht auf den 7. August den Schlaf.
In den nächsten Tagen entwickelte sich bei schwülwarmer Witterung das Schlachtfeld zu einem Ort des Horrors. Die Leichen begannen rasch zu verwesen und verströmten einen unbeschreiblich süßlichen Geruch. Den aufgeblähten Pferdekadavern, Opfer der ›heldenhaften‹ französischen Kavallerieattacken, riss die Bauchdecke auf, wenn die Haut die Verwesungsgase nicht mehr zurückhalten konnte. Millionen Fliegen, für die die Witterung ein idealer Nährboden war, bedeckten die Leichen. Ihr Gesumm bildete für Tage den grausigen Hintergrundsound des Schlachtfelds. Ludwig Pietsch, einer jener Schriftsteller und Maler im Tross des Kronprinzen, schilderte in seinen späteren Erinnerungen das Schlachtfeld am Ortseingang von Fröschweiler einige Tage nach den Kämpfen, als »einen Sumpf von Blut und Hirn und Eingeweiden«14.
In den Dörfern hatten die Soldaten die Brunnen leer getrunken und Nahrungsmittel waren im weiteren Umkreis ebenfalls knapp. Trotzdem wurden die Einwohner der Dörfer zu harten und belastenden Arbeiten herangezogen, während der Großteil der 3. deutschen Armee inklusive des Kronprinzen Fröschweiler am Folgetag verließ, um die Truppen Mac-Mahons zu verfolgen. Im Dorf zurück blieben Pioniersoldaten, die den Einwohnern bei der Bestattung der Toten halfen, und deutsche wie französische Militärärzte, die in improvisierten Lazaretten – u. a. im Rathaus von Fröschweiler – versuchten, Leben zu retten. Im Akkord wurde meist ohne Betäubung amputiert, gepflegt, verbunden. Trotzdem erlagen auch rund um Wörth und Fröschweiler zahllose Männer ihren Verwundungen.
Die Einwohner von Fröschweiler mussten nicht nur erleben, dass ihr Ort in nur wenigen Stunden zerstört worden war, sondern sie wurden gezwungen, wie Karl Klein ausführlich beschreibt, in tagelanger Arbeit das Schlachtfeld nach Leichen abzusuchen und diese gemeinsam mit den verbliebenen deutschen Soldaten in Massengräbern zu verscharren. Erst als die meisten Leichen geborgen und wegen der großen Seuchengefahr eilig begraben worden waren, konnte der Kampfplatz vom Schlachtenmüll – Uniformreste, Waffen, Kürassierpanzer, Blindgänger – und von persönlichen Hinterlassenschaften wie Fotos oder Briefen befreit werden. Auch hierbei mussten die Dörfler der umliegenden Orte mit anpacken.
Erst nach einer Woche kamen die Einwohner wieder dazu, sich um ihre eigenen Belange zu kümmern und mit dem Wiederaufbau der zerstörten Dorfstrukturen zu beginnen. Der erste improvisierte Gottesdienst konnte am 13. August im Schulhaus gefeiert werden.
Das Schlachtfeld von Wörth-Fröschweiler seit 1871
Die Schlacht von Wörth-Fröschweiler hatte den betroffenen Orten nicht nur ungebeten zu einem Eintrag in die Geschichtsbücher verholfen, sie veränderte und beeinflusste auch ihre Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten in einer Weise, die sich bis heute auswirkt.15
Wichtigstes Ergebnis des Krieges war neben dem Ende des Kaiserreichs Napoleons III. und der folgenden Gründung der 3. französischen Republik die kleindeutsche Reichseinigung, die am 1. Januar 1871 in Kraft trat. Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich die süddeutschen Staaten in den ›Novemberverträgen‹ 1870 in Versailles bereitgefunden, dem ›Norddeutschen Bund‹ beizutreten und so das neue deutsche Kaiserreich zu gründen. Mit der Proklamation des preußischen Königs Wilhelm I. zum ›Deutschen Kaiser‹ am 18. Januar 1871 – dem 170. Jahrestag der ersten preußischen Königskrönung Friedrichs I. 1701 in Königsberg – im Spiegelsaal des Schlosses Versailles war der Prozess der Reichsgründung auch beinah formell abgeschlossen. Die noch notwendige Zustimmung des Bayerischen Landtags folgte kurz darauf, allerdings mit einem denkbar knappen Ergebnis.
Am 10. Mai 1871 wurde in Frankfurt am Main der Friedensvertrag mit Frankreich abgeschlossen. Frankreich musste nicht nur für eine sehr hohe Kriegskontribution aufkommen und dulden, dass bis zur Zahlung der letzten Rate im Jahr 1873 deutsche Truppen im Lande standen, sondern vor allem den schmerzlichen Verlust des Elsass und von Teilen Lothringens hinnehmen. Bereits 1870 waren diese Gebiete unter preußische Verwaltung gestellt worden, doch mit dem Frankfurter Frieden kamen sie endgültig als ›Reichslande Elsaß-Lothringen‹ an das Deutsche Reich.
Für die Orte rund um Wörth bedeutete dies, dass sie nun nicht nur wieder sprachlich und kulturell deutsch waren, sondern auch staatlich und institutionell. In den ersten Jahren nach dem Krieg war das Verhältnis zwischen den noch vielmals gegenüber Frankreich loyalen Einwohnern des Elsass sowie vor allem Lothringens und den neuen deutschen Behörden angespannt.16 Symbolische Gesten des guten Willens sollten die Schwierigkeiten übertünchen. Die niedergebrannte Kirche Pfarrer Kleins wurde auch aus diesem Grund ab 1873 mit Mitteln des Reichs, Spenden Kaiser Wilhelms und deutscher Bürger als deutlich größere neogotische ›Friedenskirche‹ wiederaufgebaut. Am 30. Juli 1876 erfolgte die Einweihung und am 27. September 1876 besuchte der Kaiser die neue Kirche. Der Bau der noch heute spielbereiten Orgel in der Friedenskirche von Fröschweiler ging auf eine persönliche Spende des Kaisers zurück.
In den folgenden Jahren wurden die Schlachtfelder zu einem der mythischen Orte deutschen Nationalbewusstseins. Im Vorwort der großen illustrierten Prachtausgabe der ›Fröschweiler Chronik‹, die im Jahr des 100. Geburtstages des 1888 verstorbenen Kaisers Wilhelm I. 1897 bei C. H. Beck in München erschien, wurde die Schlacht von Wörth-Fröschweiler in zeittypischer Weise überhöht. Man gedachte im Vorwort »(…) des großen Tages von Wörth, an dem unter dem Oberbefehl des preußischen Kronprinzen nicht nur der erste entscheidende Sieg in dem Krieg von 1870/71 erkämpft wurde, sondern auch die nord- und süddeutsche Waffenbrüderschaft den festen Blutkitt erhielt (…).«17
Abb. 4: Postkarte ›Denkmäler in Wörth‹, Privatbesitz
Entsprechend dieser Einordnung der vormals ruhigen und beschaulichen Orte als neue Gedenkzentren glorreicher deutscher Geschichte wurden diese Ziel einer rasch expandierenden Tourismusindustrie.18 Nicht nur pflasterten in den ersten Jahren nach dem Krieg deutsche, aber auch französische Regimenter die Kampforte mit Dutzenden von Denkmälern – mit aufsteigenden Adlern auf korinthischen Säulen, brüllenden Löwen auf zerschmetterten Mitrailleusen, Victorien mit sterbenden Kriegern in den Armen –, sondern es entstanden auch auf Grundlage der privaten Schlachtfeldfunde kleine Kriegsmuseen und zahlreiche Restaurants wie Hotels, die den Ausflüglern behagliche Übernachtungsmöglichkeiten bei Bier und reichhaltigem Essen boten. (Abb. 4)
Wörth erhielt als Wallfahrtsort deutscher und französischer Veteranen sowie national bewegter Sommerfrischler einen eigenen Eisenbahnanschluss und am Ende des Booms hatte der Ort mehr Übernachtungsbetten als Einwohner. So konnten die von den Geschehnissen der Schlacht schwer gebeutelten Einwohner auf diese Weise im Nachhinein noch einen gewissen Profit aus dem Drama ziehen.
Mit dem erneuten Wechsel des Elsass 1919 an Frankreich fand dieser deutschnationale Ausflugstrubel sein Ende. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges war die Toleranz der nun wieder französischen Behörden für die Feier deutscher Siege des 19. Jahrhunderts überschaubar. Zwar durften die meisten deutschen Denkmäler stehen bleiben, doch manche, allzu triumphierend auftretende Monumente wurden geschleift. Das große Kaiser-Friedrich-Denkmal, das von der ›Preuschdorfer Höhe‹ das ganze Tal dominiert hatte – heute sind noch der Sockel und die Umfriedung zu besichtigen –, wurde ebenso abgerissen wie das Siegesdenkmal der 3. deutschen Armee am ›Mac-Mahon-Baum‹ bei Elsasshausen. Aus der Bronze des Friedrich-Denkmals wurden Kirchenglocken gegossen.
Im Jahr 1940, nach dem Sieg der ›Wehrmacht‹ gegen Frankreich, nahmen nun die nationalsozialistischen Besatzer wieder Revanche und beseitigten in ebenso kleingeistiger Weise wie ihre Vorgänger wiederum einige französische Monumente, die ihnen nicht ins ideologisch-rassistische Konzept passten – so zum Beispiel ein Turkodenkmal.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Denkmalstreit zum Glück zur Ruhe gekommen und im Rahmen der Deutsch-Französischen Freundschaft eingehegt worden. Das vorletzte französische Denkmal wurde zum 100. Jubiläum 1970 an der Chaussee zwischen Fröschweiler und Reichshoffen zum Gedenken an den zweiten französischen Kürassierangriff errichtet. Ein noch später errichtetes kleines Kreuz an der ›Wörther Hohl‹ erinnert an das von den Deutschen 1940 gesprengte zentrale französische Armeedenkmal. Die meisten heute noch existierenden Denkmäler können bei circa elf Kilometer Marschweg bequem zu Fuß abgelaufen werden. Im Museum der Schlacht, das im ›Alten Schloss‹ von Wörth beherbergt ist, kann man die wichtigsten Informationen zum 6. August 1870 auf Bildern und vor Schlachtfeldfunden nachvollziehen.
In einer lieblichen Landschaft erinnern heute nur noch diese Denkmäler und ab und an einige herumstreifende Schlachtfeldtouristen an den Tag des 6. August 1870. Dieses Glück eines Friedens
Anmerkungen
1 Klein 1912, S. 2.
2 Vgl. Arand, Bendikowski, Bremm 2020, Epkenhans, Oppermann.
3 U. a. Landesarchiv Stuttgart ›Nation im Siegesrausch. Württemberg und die Gründung des Deutschen Reichs 1870/71‹ und Militärhistorisches Museum Dresden ›Krieg, Macht, Nation – Wie das deutsche Kaiserreich entstand‹.
4 Zit. n. Arand, S. 45.
5 Vgl. hierzu Buk-Swienty.
6 Vgl. hierzu Bremm 2016.
7 Vgl. hierzu Fesser.
8 Vgl. hierzu König/Julien.
9 Vgl. zum Folgenden Arand, S. 94 ff.
10 Vgl. Mährle, S. 218.
11 Vgl. Arand, S. 159.
12 Vgl. zum Folgenden Arand, S. 216 ff., vor allem aber die umfangreiche zeitgenössische Literatur, z.B. Großer Generalstab oder Sternegg.
13 Vgl. zum Folgenden Arand, S. 246 ff.
14 Pietsch, S. 31.
15 Vgl. zum Folgenden Arand/Bunnenberg, S. 183 ff.
16 Vgl. hierzu Kühner, S. 71 ff.
17 Klein 1897, S. VIII.
18 Vgl. hierzu Wolf, S. 131 ff.
»Ein Volksbuch ersten Ranges und als solches unübertroffen.« – Karl Klein und die ›Fröschweiler Chronik‹*
Christian Bunnenberg
Am 1. Mai 1898 versammelte sich eine Trauergemeinde am Friedhof der evangelischen Gemeinde in Nördlingen. Die meisten Anwesenden hatten den Verstorbenen, Karl Klein, schon lange nicht mehr gesehen, war dieser doch jahrelang wegen einer »Gemütskrankheit« in der Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren behandelt worden.1 Trotzdem wollte es kaum jemand versäumen, am Grab Abschied nehmen zu können. Und so suchten unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gleich mehrere Redner am Grab nach den richtigen Worten, um das Leben und Werk Karl Kleins angemessen würdigen zu können.2 Streng nach Kirchenhierarchie geordnet auftretend, gaben die Geistlichen ihr rhetorisch Bestes. Zunächst erinnerte der Dekan Endres wehmütig an seinen Amtsvorgänger, der sechzehn Jahre zuvor nach Nördlingen gekommen war, um die umfangreichen Geschäfte als Dekan, Distriktschulinspektor und Vorstand der Präparandenschule zu übernehmen. Endres lobte den Eifer, die Lebhaftigkeit und die Frische, mit der Karl Klein die neuen Aufgaben angegangen sei, aber schon drei Jahre später durch »schwere körperliche Krankheit und Gemütsleiden«3 gezeichnet in die Heil- und Pflegeanstalt in Kaufbeuren4 eingewiesen werden musste. Den Grund dafür sah Dekan Endres in den »Schrecken des großen Krieges [1870/71], die [Kleins] zartbesaitetes Gemüt tief erschüttert hatten«.5
In der sich anschließenden Grabrede nahm Stadtpfarrer Rabus diesen Faden wieder auf und charakterisierte Klein als »fühlenden Menschen, als liebenden Christen, […] mit einem Hirtenherzen, das da blutet unter den Wunden, die der Herde geschlagen werden«.6 »Vorsehung« nannte er die Anwesenheit Kleins als Pfarrer in Fröschweiler, in das am 6. August 1870 die »schreckliche Brandfackel des Krieges ihren blutroten Schein hineinwarf«.7 Vorsehung, weil Kleins Lebensgeschichte dadurch »für immer und ewig verwoben und verflochten [wurde] mit der Geschichte der Entstehung des neuen deutschen Reiches«, worüber er in dem »schlichten Büchlein, ›Die Fröschweiler Chronik‹ Zeugnis abgelegt« habe.8 Die folgenden Sätze der Grabrede des Stadtpfarrers hätten keinem Rezensenten wohlwollender aus der Feder fließen können: Das Buch sei »ein wahres Volksbuch«, gekennzeichnet durch eine »Mark und Bein durchschauernde Anschaulichkeit«, durch eine »greifbare Wirklichkeit des Selbsterlebten« und den »unvergänglichem sittlich-religiösen Gehalt«. Karl Klein habe sich durch dieses Buch »ein unsterbliches Denkmal gesetzt«. Niemand könne sich beim Lesen dieser Wirkmächtigkeit entziehen, niemand das Buch aus der Hand legen, ohne tief ergriffen zu sein. Der Nördlinger Pfarrer Rabus forderte daher alle Anwesenden auf, sich in die Eindrücke hineinzudenken, falls sie »aus Anlaß dieses Trauerfalls das Buch wieder zur Hand« nehmen würden, um »den Verfasser auf seiner nächtlichen Reise über das Schlachtfeld zu begleiten«, auf der Reise, die den Verstorbenen im Alter mit ihren ganzen furchtbaren Facetten wieder eingeholt hatte.9
Noch bevor sich der Sarg in das Grab senkte, verlas Vikar Bruglocher einen ausführlichen Lebenslauf des Verstorbenen, in dem neben den zahlreichen Stationen des Wirkens Karl Kleins als evangelischer Geistlicher wiederum auf die ›Fröschweiler Chronik‹ hingewiesen wurde, »deren Wert allgemein bekannt sei«.10 Fraglich, ob die vielen wohlmeinenden Worte die Trauer der Familie lindern konnten; der verstorbene Pfarrer Klein hinterließ an diesem Tag außer seinem vielgerühmten Buch nämlich noch seine Frau, zwei Schwestern, vier Töchter, drei Söhne und zwei Enkel.11
Die ›Fröschweiler Chronik‹ und die Erinnerung an den Krieg 1870/71
Mehr als 120 Jahre nach der Beerdigung ihres Autors Karl Klein ist die ›Fröschweiler Chronik‹ in der bundesdeutschen Öffentlichkeit kaum noch ein Begriff. Nur vereinzelt erregt der schmale Band aus dem 19. Jahrhundert jenseits der Geschichtswissenschaft noch Aufmerksamkeit. Als »unangefochtenen Bestseller« der Kriegserinnerungen an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 bezeichnet beispielsweise der Historiker Frank Becker die ›Fröschweiler Chronik‹ von Karl Klein in seiner Studie zur Geschichte der Einigungskriege in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands zwischen 1864 und 1913.12 Der Text des Elsässers erfährt auch Einstufungen als »kritische und tendenziell pazifistische Darstellung«;13 oder als das »bedeutendste deutsche ›Anti-Kriegsbuch‹ aus christlichem Geist in der Kaiserzeit«.14 Darüber hinaus findet das Buch von Karl Klein in Einzelfällen seinen Niederschlag, beispielsweise bei stark herbeikonstruierten regionalgeschichtlichen Bezügen15, als vermeintlich überzeitlicher Aufhänger für kritische Untersuchungen von Kriegsbegeisterung und Kriegserlebnis16, als mehr oder weniger reflektiert benutzte Quelle historischer Arbeiten17 oder als geeignetes Thema für die populärwissenschaftliche Aufarbeitung an ›runden Kriegsjubiläen‹.18 Was die meisten Darstellungen allerdings eint, ist die Bewertung der Chronik als »Hausbuch der Generation 1890/1914«.19
Ein Versuch, sich eingehender mit der Person Karl Kleins und seiner ›Fröschweiler Chronik‹ zu beschäftigen, stößt angesichts einer sehr schmalen und fragmentarischen Quellenbasis schnell an seine Grenzen. Die archivalische Überlieferung zu Karl Klein setzt sich aus wenigen Akten zu seinem beruflichen Werdegang20 und der Krankengeschichte21 seiner letzten Lebensjahre zusammen. Weitere Informationen zur Biographie Karl Kleins – wenngleich widersprüchliche Informationen geboten werden – lassen sich aus zeitgenössischen Lebensdarstellungen in Lexika22, Zeitschriften und Zeitungen23 gewinnen. Dazu sind auch die bereits zitierten Grabreden24 oder der biographische Abriss in den späten Ausgaben der ›Fröschweiler Chronik‹25 zu zählen.
Zur Entstehung der ›Fröschweiler Chronik‹ und ihrer Publikationsgeschichte liegen auch von Verlagsseite keine Unterlagen mehr vor, da das Verlagsarchiv von C. H. Beck durch einen Bombenvolltreffer im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört wurde.26 Damit können so gut wie keine Aussagen zur Autorenbeziehung Karl Kleins zum Verlag, zur Auflagenhöhe und zum wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg des Buches getroffen werden. Einige wenige Hinweise sind aber der Werbung für die ›Fröschweiler Chronik‹27 in weiteren Publikationen28 aus dem Verlagsprogramm von C. H. Beck zu entnehmen. Aber auch literarische Adaptionen wie das ›Volksschauspiel Fröschweiler‹29, zeitnahe Publikationen aus dem regionalen Umfeld Fröschweilers30, Schulbücher31, pädagogische Fachliteratur32 und Einträge in Lexika33 geben Informationen über Reichweite und Wirkung der ›Fröschweiler Chronik‹.34
Im Vorwort zur illustrierten ›Jubelausgabe‹ wurde der ›Fröschweiler Chronik‹ vom Verleger »eine einzigartige Stellung […] in der so reichen Literatur, zu welcher der Krieg von 1870/71 den Anlaß geboten hat« zugewiesen.35 Das mag nicht verwundern, ist es doch vorderstes Interesse eines Verlegers, dass sich seine Ware gut verkauft. Was hingegen verwundert, ist die Begründung des Alleinstellungsmerkmals. Der Text von Pfarrer Klein sei so einzigartig, weil »hier ein Angehöriger der vom Kriege heimgesuchten friedlichen Bevölkerung seine Beobachtungen und Erlebnisse machte. […] In ergreifenden Bildern wird der Krieg, wie er in Wahrheit ist, geschildert und [es] wird […] gezeigt, wie er in den Gegenden, die er betroffen hat, mit elementarer Gewalt das äußere und innere Leben des Volkes erschüttert und die Volksseele in ihrem tiefsten Wesen aufwühlt.«36
Die ›Fröschweiler Chronik‹ bietet demnach den Lesern einen ganz speziellen Blick auf den Deutsch-Französischen Krieg, nämlich den des Zivilisten. Das Bedürfnis nach authentischen Berichten aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 wurde in Deutschland vor allem durch den Umstand genährt, dass die Kriegshandlungen fast ausschließlich auf französischem Boden und damit für die meisten Deutschen jenseits ihrer Lebenswelt stattfanden.37 Nur ein Bruchteil der Bevölkerung, vornehmlich Soldaten, waren ›Miterlebende‹; und nur sie konnten unmittelbar am kriegerischen Geschehen teilnehmen, die ›Daheimgebliebenen‹ hingegen nur mittelbar. Die Letztgenannten waren daher vor allem auf die im doppelten Wortsinn ›mit-geteilten‹ Erfahrungen der ›Miterlebenden‹ angewiesen.38 Für die Weitergabe dieser Erfahrungen nahmen zunächst die Massenmedien der Presse eine zentrale Rolle ein. Die Presse gab von den Schlachtfeldern aber vor allem das an die Leserinnen und Leser weiter, was ihr Soldaten und die neue im eigenen Selbstverständnis elitäre Gruppe der Kriegsberichterstatter »nach hinten« meldeten.39 Augenzeugenberichte von der Front standen bei den Lesern in besonders hohem Kurs, konnten sie doch im Gegensatz zu den amtlichen Nachrichten das ausgeprägte Authentizitätsverlangen in der Öffentlichkeit befriedigen.40 Dadurch wurde allerdings eine »zweite Wirklichkeit« des Krieges geschaffen und die Deutungen der Kriegsereignisse waren immer stärker von der Wahrnehmung im öffentlichen Raum, und nicht mehr »von ihrer faktischen Gestalt« abhängig.41 Nicht mehr der Krieg formte das Kriegsbild, sondern die gleichzeitig zum Ereignis erzeugten Darstellungen des Krieges. Waren für die zeitnahen Kriegsdeutungen zunächst die Zeitungen meinungsbildend, so wurde ihre Rolle mittel- und langfristig durch Erinnerungsliteratur abgelöst. Flankiert durch weitere Phänomene der Erinnerungskultur – z.B. Denkmalbauten, Kriegervereine und Sedantag – wurde der Deutsch-Französische Krieg im 1871 neugegründeten Deutschen Kaiserreich zu einem über das Konfliktende anhaltenden gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsereignis.42
Als federführend in diesem Kommunikationsprozess lässt sich ein spezifisches Milieu ausmachen; die meisten der überwiegend männlichen Autoren entstammten bürgerlichen Bildungsschichten.43 Trotz konfessioneller, professioneller und regionaler Heterogenität zeigt sich in der Unmenge von Kriegsdarstellungen der Wunsch des deutschen Bürgertums, »wenn man schon in der politischen und militärischen Wirklichkeit nur geringe Mitwirkungschancen gehabt hatte, […] das Kriegsbild, die kollektive Wahrnehmung der Geschehnisse, in seinem Sinne aktiv mitzugestalten«.44 Gleichzeitig profitierten die »protestantischen Theologen, Historiker, Schriftsteller, Beamten [und] Gymnasiallehrer« des Kaiserreichs von dem Umstand, dass sie in ihren Texten den Konflikt aus der Retrospektive deuten konnten: »Das nachträgliche Abfassen von Kriegserinnerungen bringt eine sehr spezielle Quellengattung hervor, in die das Wissen um den Ausgang des Konflikts, die persönlichen Erfahrungen und die Situation des Verfassers im Moment der Niederschrift mit einem großen zeitlichen Abstand zum Geschehen einfließen.«45
Im Nachgang zum eigentlichen Konflikt war es zwar weiterhin vorrangig an den ›Miterlebenden‹, ihre im Krieg gemachten Erfahrungen aufzuarbeiten, zu deuten und den ›Daheimgebliebenen‹ als Geschichte aus und über den Krieg von 1870/71 anzubieten, doch auch ›Daheimgebliebene‹ beteiligten sich zunehmend an der Produktion von Deutungsangeboten. Der Pfarrer Karl Klein aus dem elsässischen Dorf Fröschweiler war allerdings beides, ›Daheimgebliebener‹ und ›Miterlebender‹, war doch der Krieg zu ihm nach Hause gekommen.
Der Autor – Karl Klein (1838 bis 1898)
Obwohl bis zu seinem Tode die ›Fröschweiler Chronik‹ bereits in der 15. Auflage erschienen war, wurden für Karl Klein erst posthum Lebensdarstellungen verfasst und gedruckt. Denn bis 1898 fand die Person Karl Klein in schriftlicher Form nur in seinen eigenen Texten, in den zur damaligen Zeit nicht zugänglichen ihn betreffenden Akten oder mehr als Figur denn als Person in anderen Kriegserinnerungen statt. Es gibt verschiedene Abschnitte in der ›Fröschweiler Chronik‹, die als Selbstzeugnis, gewissermaßen als eine Art privates Kriegstagebuch gelesen werden könnten; Gleiches gilt auch für das wesentlich unbekanntere Werk ›Vor dreissig Jahren‹, in dem autobiographische Hinweise auf Kindheit und die ältere Familiengeschichte zu finden sind.46 Die kurzen Hinweise auf Karl Klein in weiteren Texten zum Krieg 1870/71 haben dagegen stets etwas Anekdotenhaftes und wirken in der Rückschau teilweise wie ungelenke Versuche, mit der Bekanntheit des Autors der ›Fröschweiler Chronik‹ auch die eigene Publikation schmücken zu wollen.47
Unmittelbar nach seinem Tode entstanden dann allerdings innerhalb kürzester Zeit umfangreiche biographische Darstellungen. Diesen Texten gemein sind mehr oder weniger detailverliebte und nur in Nuancen unterscheidbare Aussagen über Karl Kleins Werdegang und Schaffen, die im Ganzen durchweg in wohlwollender Absicht geschrieben wurden. Es drängt sich daher die Frage auf, auf welchem Wege die Verfasser ihre Informationen gewannen; sie drängt sich aber auch besonders vor dem Hintergrund auf, dass alle später entstandenen biographischen Abhandlungen zu Karl Klein inhaltlich auf diesen ersten Texten aufbauen.
Den Anfang machte der bereits zitierte Vikar Bruglocher mit seinem am Grab verlesenen Lebenslauf, dessen Abdruck dann durch C. H. Beck besorgt wurde, dem Nördlinger Verlag, in dem auch die ›Fröschweiler Chronik‹ erschien.48 Die Nähe zum familiären und beruflichen Umfeld Karl Kleins lassen die Aussagen als triftig und plausibel erscheinen. Wenn auch am Grab sicherlich der Grundsatz ›De mortuis nihil nisi bene‹ galt, war doch während der Beerdigung das engste soziale Umfeld des Verstorbenen anwesend.
Parallel zur Grabrede erschien ebenfalls noch 1898 ein erster Nachruf im illustrierten Familienblatt ›Daheim‹, verfasst von Karl Hackenschmidt.49 Damit war auch die breite Öffentlichkeit informiert, denn das Blatt erreichte im Deutschen Kaiserreich mit durchschnittlich 40 000 gedruckten Exemplaren eine noch ungleich höhere Zahl an Lesern, da das Konzept der illustrierten Familienblätter eine Rezeption im Familienkreis, im Café oder durch Leihbibliotheken vorsah.50 Hackenschmidt schilderte ausführlich den Lebenslauf Karl Kleins aus einer Perspektive intimster Kenntnis, ebenso wie eine kürzere Fassung seines Textes im 1900 gedruckten ›Daheim-Kalender‹.51 Der Autor kannte die familiären und beruflichen Verhältnisse Karl Kleins aus eigener Anschauung nur zu genau, hatten sich ihre Lebenswege doch wiederholt gekreuzt, zuerst in der gemeinsamen Studienzeit in Straßburg und als Mitglieder derselben Studentenverbindung. Danach war Hackenschmidt zeitgleich mit Karl Klein in Fröschweiler ansässig und zwar als Hauslehrer im dortigen in Nachbarschaft zur Kirche gelegenen Schloss.52 Vom Sommer 1870 bis 1881 hatte Karl Hackenschmidt die Pfarrstelle in Jägerthal inne, keine sechs Kilometer von Fröschweiler entfernt, und auch er publizierte nach dem Krieg seine Erinnerungen an die Schlacht von Wörth.53
Abb. 1: Fotografie von Karl Klein, abgedruckt in verschiedenen Ausgaben der ›Fröschweiler Chronik‹. Die Aufnahme ist sehr wahrscheinlich nach 1880 entstanden, in Klein 1912, o. S.
Beide Texte Hackenschmidts wurden von dem Literatur- und Kulturhistoriker Ludwig Julius Fränkel als Grundlage für biographische Darstellungen an prominenterer Stellen genutzt, nämlich im ›Biographischen Jahrbuch und Deutschen Nekrolog‹ (1900) und in der ›Allgemeinen Deutschen Biographie‹ (1906).54 Dort zitiert Fränkel vielfach Hackenschmidt, außerdem noch das von Johannes Haußleiter verfasste Vorwort zur ›Fröschweiler Chronik‹ und die literarische Wertung derselben durch Adolf von Stählin.55 Johannes Haußleiter, ebenfalls evangelischer Theologe, war seit 1875 Gymnasiallehrer in Nördlingen und nach eigener Auskunft erheblich an der Drucklegung der ›Fröschweiler Chronik‹ beteiligt. Adolf von Stählin, auch evangelischer Theologe, war Pfarrer in Nördlingen gewesen und dort zugleich Referent für das städtische Schulwesen.56 Somit prägten Hackenschmidt, Haußleiter und Stählin durch ihre Texte das Bild über ihren Studienfreund, Nachbarn und Amtskollegen Karl Klein, und Autoren wie Fränkel und andere übernahmen dieses bis in die Gegenwart.57
Karl Klein wurde am 31. Mai 1838 im nordelsässischen Dorf Hirschland geboren. Sein Vater konnte trotz seiner Anstellung als örtlicher Schullehrer den fünf Kindern nur eine Kindheit in ärmlicher Umgebung bieten. Die schulische Laufbahn Karl Kleins auf einem Collège in Paris finanzierten deshalb Freunde der Familie. Während des sich seit 1856 anschließenden Theologiestudiums am Studienstift St. Thomas in Straßburg trat er der dem Dachverband ›Wingolfsbund‹ angehörenden christlichen, nichtschlagenden und deutschgesinnten Studentenverbindung ›Argentina‹ bei, in der Studierende der Theologie die deutliche Mehrheit stellten. Nach erfolgreichen Examina erhielt der dreiundzwanzigjährige Karl Klein 1861 eine Stelle als Vikar in Bühl im Unterelsass. In den wenigen Monaten seiner dortigen Tätigkeit führte eine Blatternepidemie den sonst als fröhlich und unternehmungslustig charakterisierten jungen Geistlichen bis an die Grenzen seiner physischen und psychischen Belastbarkeit, vor allem nachdem er sich zusätzlich mit Pockenviren infizierte und schwer erkrankte.
Nach seiner Genesung – Karl Klein blieb von Blatternarben gezeichnet – wurde er 1862 als Hilfsprediger nach Paris versetzt. Unter der Leitung von Pfarrer Hosemann58 war er als Gefängnisgeistlicher und bei der Betreuung Cholerainfizierter tätig. Im Mai 1865 heiratete Karl Klein Hosemanns Tochter, Elisabeth. Mit ihr zeugte er in den folgenden Jahren des Zusammenlebens neun Kinder, von denen eines früh verstarb.59 1867 wechselte Karl Klein auf die Pfarrstelle nach Fröschweiler. Dorthin folgten ihm neben Frau und Kindern auch seine Eltern und ein Teil seiner Geschwister; und an diesem Ort sollte er dann schließlich am 6. August 1870 die Schlacht von Wörth-Fröschweiler erleben, die sein weiteres Leben maßgeblich beeinflusste. Nachdem der Krieg über das kleine Dorf hinweggezogen war, galt es, zunächst die sichtbaren Spuren des Krieges zu beseitigen. Die Bestattung Tausender Gefallener, der Wiederaufbau der Fröschweiler Kirche, des Dorfes und die Betreuung der Gemeinde verlangten von dem jungen Pfarrer größte Anstrengungen. Neben der Verleihung des preußischen Kronenordens III. Klasse für »seine patriotische Haltung während des Krieges« wurde seinen Bemühungen um seine Gemeinde mit dem Besuch der neu erbauten ›Friedenskirche‹ durch Kaiser Wilhelm I. und Kronprinzen Friedrich am 27. September 1876 Aufmerksamkeit entgegengebracht.60
In unmittelbarer zeitlicher Nähe zu der Einweihung der Kirche erschien Ende 1876 dann auch die erste Ausgabe der ›Fröschweiler Chronik‹ im Nördlinger C. H. Beck Verlag. 1882 zog Karl Klein mit seiner Familie an den Verlagsort, um eine Stelle als Dekan und Hauptprediger anzutreten. 1885 erkrankte er physisch und psychisch schwer, wurde zunächst in Göppingen und ab 1887 in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren behandelt. Die umfangreichen Krankenakten attestierten ihm eine »chronische Melancholie von dämonischem Charakter. […] Der Patient zeigt immer dasselbe Verhalten; er seufzt und stöhnt und jammert beständig unter dem Druck einer All-Angst, die sein Gemüt mit der langen Erwartung eines von allen Seiten drohenden Unheils erfüllt und ihm Tag und Nacht keine Ruhe lässt.«61 Nach 13 Jahren stationärer Behandlung verstarb Karl Klein nicht einmal sechzigjährig am 29. April 1898 im Kaufbeurer Krankenhaus.62





























