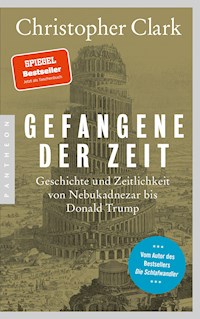17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 36,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das neue, epochale Werk von Bestsellerautor Christopher Clark: Der beliebte Historiker erklärt uns wie kein anderer, wie wir wurden, wer wir heute sind, welche Werte wir vertreten, wofür wir kämpfen
In der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen, der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammengehalten hatte, brach in sich zusammen.
Christopher Clarks spektakuläres neues Buch erweckt mit Schwung, Esprit und neuen Erkenntnissen diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Überall brachen sich neue politische Ideen, Glaubenssätze und Erwartungen Bahn. Es ging um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ende der Sklaverei, das Recht auf Arbeit, nationale Unabhängigkeit und die jüdische Emanzipation. Dies waren plötzlich zentrale Lebensthemen für unendlich viele Menschen - und es wurde hart um sie gekämpft.
Die Ideen von 1848 verbreiteten sich um die ganze Welt und veränderten die Verhältnisse zum Bessern, zuweilen aber auch zum viel Schlechteren. Und aus den Trümmern erhob sich ein neues und ganz anderes Europa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1777
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
In der Geschichte Europas gibt es keinen Moment, der aufregender, aber auch keinen der beängstigender war als der Frühling des Jahres 1848. Scheinbar aus dem Nichts versammelten sich in unzähligen Städten von Palermo bis Paris und Venedig riesige Menschenmengen, manchmal in friedlicher, oft auch in gewalttätiger Absicht. Die politische Ordnung, die seit Napoleons Niederlage alles zusammengehalten hatte, brach in sich zusammen.
Christopher Clarks Buch erweckt mit Schwung, Esprit und neuen Erkenntnissen diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Überall brachen sich neue politische Ideen, Glaubenssätze und Erwartungen Bahn. Es ging um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ende der Sklaverei, das Recht auf Arbeit, nationale Unabhängigkeit und die jüdische Emanzipation. Dies waren plötzlich zentrale Lebensthemen für unendlich viele Menschen – und es wurde hart um sie gekämpft. Die Ideen von 1848 verbreiteten sich um die ganze Welt und veränderten die Verhältnisse zum Besseren, zuweilen aber auch zum viel Schlechteren. Und aus den Trümmern erhob sich ein neues und ganz anderes Europa.
Autor
Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biographie Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers. Für sein Buch »Preußen« erhielt er 2007 den renommierten Wolfson History Prize sowie 2010 als erster nicht deutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. Sein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg, »Die Schlafwandler« (2013), führte wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestseller-Liste an und war ein internationaler Bucherfolg. 2018 erschien von ihm der vielbeachtete Bestseller »Von Zeit und Macht«, und 2020 folgte das von der Kritik gefeierte »Gefangene der Zeit«. Einem breiten Fernsehpublikum wurde Christopher Clark bekannt als Moderator der mehrteiligen ZDF-Doku-Reihen »Deutschland-Saga«, »Europa-Saga« und »Welten-Saga«.
Christopher Clark
FRÜHLINGDERREVOLUTION
Europa 1848/49 und der Kampf für eine neue Welt
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz, Klaus-Dieter Schmidt
Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2023 unter dem Titel »Revolutionary Spring. Fighting for a New World, 1848 – 1849« bei Allen Lane, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 Christopher Clark
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: akg-images /Album / Oronoz
Karten: Peter Palm, Berlin
Lektorat: Jonas Wegerer, Freiburg
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-23162-0V005
www.dva.de
INHALT
Einleitung
1 Soziale Fragen
2 Ordnungskonzepte
3 Konfrontation
4 Explosionen
5 Regimewechsel
6 Emanzipation
7 Entropie
8 Gegenrevolution
9 Nach 1848
Schluss
ANHANG
Dank
Karten
Anmerkungen
Register
Einleitung
In ihrer Intensität und geographischen Reichweite waren die Revolutionen von 1848 einzigartig – zumindest in der europäischen Geschichte. Weder die Französische Revolution von 1789 noch die Revolution von 1830, weder die Pariser Kommune von 1871 noch die russischen Revolutionen von 1905 und 1917 lösten eine vergleichbare transkontinentale Lawine aus. Das Jahr 1989 scheint sich besser für einen Vergleich zu eignen, aber noch heute ist umstritten, ob man die damaligen Aufstände überhaupt als »Revolutionen« bezeichnen kann. Im Jahr 1848 hingegen brachen politische Unruhen zeitgleich auf dem ganzen Kontinent aus, von der Schweiz und Portugal bis in die Walachei und Moldau, von Norwegen, Dänemark und Schweden bis nach Palermo und zu den Ionischen Inseln. Es war die einzige wahrhaft europäische Revolution der Geschichte.
In gewisser Hinsicht handelte es sich jedoch auch um einen globalen Aufstand, oder sagen wir, einen europäischen Aufstand mit einer globalen Dimension. Die Nachricht von der Revolution in Paris hatte tiefgreifenden Einfluss auf die französische Karibik, und die Maßnahmen, die London ergriff, um eine Revolution auf britischem Kernland zu verhindern, lösten in der gesamten Peripherie des Empires Proteste und Unruhen aus. Auch in den jungen Nationen Lateinamerikas elektrisierten die europäischen Revolutionen liberale und radikale politische Eliten. Sogar im fernen Australien schlug die Februarrevolution politische Wellen, auch wenn die Nachricht von deren Ereignissen erst am 19. Juni 1848 Sydney in der Kolonie New South Wales erreichte – eine Erinnerung an die »Tyrannei der Entfernung«, die der australische Historiker Geoffrey Blainey einst schwermütig beklagte.
An den Revolutionen war ein breites Panorama charismatischer und begabter Akteure beteiligt, von Giuseppe Garibaldi bis zu Marie d’Agoult, die Autorin (unter einem männlichen Pseudonym) der besten zeitgenössischen Geschichte der Revolutionen in Frankreich; vom französischen Sozialisten Louis Blanc bis zum Anführer der ungarischen Nationalbewegung Lajos Kossuth; vom brillanten konservativen, liberalen Gesellschaftstheoretiker, Historiker und Politiker Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville bis hin zum walachischen Soldaten, Journalisten und Agrarradikalen Nicolae Bălcescu. Vom jungen patriotischen Dichter Sándor Petőfi, dessen Vortrag einer neuen Nationalhymne für die Ungarn die revolutionären Massen in Budapest elektrisierte, bis hin zum unruhigen Priester Félicité de Lamennais, der durch seinen letztlich erfolglosen Versuch, seinen Glauben mit der Politik zu versöhnen, zu einem der bekanntesten Denker in der Welt vor 1848 wurde; von der Schriftstellerin George Sand, die für die provisorische Regierung in Paris »revolutionäre Bulletins« verfasste, bis zum römischen Volkstribun Angelo Brunetti, den man liebevoll Ciceruacchio oder »Pummelchen« nannte – ein wahrer Mann des Volkes, der maßgeblich am Verlauf der römischen Revolution 1848/49 beteiligt war. Ganz zu schweigen von den unzähligen Frauen, die auf den Straßen europäischer Städte Flugblätter und Zeitungen verkauften oder auf den Barrikaden kämpften (auf den Darstellungen dieser Revolutionen sind sie sehr prominent vertreten). Für politisch empfindsame Europäer war das Jahr 1848 ein umfassender Moment der gemeinsamen Erfahrung. Es machte sie alle zu Zeitgenossen, brandmarkte sie mit Erinnerungen, die sie ihr Leben lang nicht vergessen sollten.
Diese Revolutionen wurden als europäische Aufstände wahrgenommen – dafür gibt es eine Fülle an Hinweisen; im Rückblick jedoch wurden sie nationalisiert.[1] Die Historiker und Akteure der Erinnerungskultur der europäischen Nationen vereinnahmten sie zu spezifisch nationalen Geschichten. Das vermeintliche Scheitern der deutschen Revolutionen wurde in das nationale Narrativ vom »Sonderweg« aufgesogen; und dort trug es erheblich dazu bei, eine These über Deutschlands Irrweg in die Moderne zu befeuern – einen Weg, der in der Katastrophe der Diktatur Hitlers kulminierte. Etwas Ähnliches geschah in Italien, wo das Scheitern der Revolution im Jahr 1848 als Scheidepunkt der Entwicklung hin zu einer autoritären Tendenz im neuen italienischen Königreich und damit als Wegbereiter für den Marsch auf Rom 1922 und die anschließende faschistische Machtübernahme angesehen wurde. In Frankreich galt das Scheitern von 1848 als Vorbote für das bonapartistische Zwischenspiel des Zweiten Kaiserreichs, das wiederum den späteren Triumph des Gaullismus vorwegnahm. Mit anderen Worten, die Konzentration auf das angebliche Scheitern von 1848 hatte zugleich die Konsequenz, dass eine Kanalisierung dieser Geschichten in eine Vielzahl paralleler, auf den Nationalstaat fokussierter Narrative ermöglicht wurde. Nichts demonstriert eindrucksvoller die enorme Macht des Nationalstaats, die historische Überlieferung zu prägen, als diese miteinander zusammenhängenden Aufstände und ihre Zersplitterung im heutigen Gedächtnis – wir spüren diese Macht noch heute. Man kann die Ereignisse von 1848 in drei Phasen unterteilen: Im Februar und März verbreiteten sich Unruhen wie ein Lauffeuer über den ganzen Kontinent, sprangen von Stadt zu Stadt und lösten unzählige Aufstände in den Orten dazwischen aus. Der österreichische Kanzler, Fürst Metternich, floh aus Wien, die preußische Armee wurde aus Berlin abgezogen, die Könige von Sardinien, Dänemark und Neapel erließen Konstitutionen – alles schien so einfach. Das war der Tahrir-Platz-Moment: Es war durchaus verzeihlich zu glauben, dass die Bewegung die ganze Gesellschaft erfasst habe; die einmütige Euphorie war ansteckend: »Mich hielt es nicht in der Stube, ich mußte hinaus in die Winterkälte und bis zur Ermüdung fort und fort gehen«, schrieb ein deutscher Revolutionär, »um nur mein Blut zu beruhigen, mein Herz, welches vor ungeahnter und unverstandener Bewegung mir die Brust zu sprengen drohte, langsamer schlagen zu machen.«[2] In Mailand fielen sich völlig Fremde auf der Straße in die Arme. Das waren die Frühlingstage von 1848. Doch die Spaltungen innerhalb des Aufstands (die bereits in den ersten Stunden des Konflikts latent vorhanden waren) traten schon bald offen zutage: Im Mai versuchten radikale Demonstranten in Paris, die durch die Februarrevolution eingesetzte Nationalversammlung zu stürmen und zu stürzen, während in Wien österreichische Demokraten gegen die Langsamkeit der liberalen Reformen protestierten und einen Sicherheitsausschuss ins Leben riefen. Im Juni kam es auf den Straßen größerer Städte zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den liberalen (in Frankreich republikanischen) Führungen und radikalisierten Menschenmengen. In Paris kulminierte das Ganze in der Brutalität und dem Blutvergießen der »Juni-Tage«, bei denen mindestens 3000 Aufständische umkamen. Das war der lange heiße Sommer von 1848, den Karl Marx hämisch als den Moment erkannte, an dem die Revolution ihre Unschuld verlor und die süße (aber trügerische) Einmütigkeit des Frühlings dem erbitterten Klassenkampf wich.
Der Herbst 1848 bot ein komplexeres Bild. Im September, Oktober und November kam in Berlin, Prag, Wien und in der Walachei die Konterrevolution ins Rollen. Parlamente wurden geschlossen, Aufständische verhaftet und verurteilt, Soldaten kehrten in Scharen auf die Straßen der Städte zurück. Gleichzeitig brach jedoch eine zweite, von Demokraten und sozial gesinnten Republikanern unterschiedlicher Couleur dominierte Phase der radikalen Revolte an, nämlich in den süddeutschen Staaten (vor allem in Baden und Württemberg), im Westen und Süden Frankreichs und in Rom, wo die Radikalen nach der Flucht des Papstes am 24. November sogar eine Römische Republik ausriefen. In Süddeutschland wurde diese zweite Aufstandswelle erst im Sommer 1849 niedergeschlagen, als preußische Truppen die Festung Rastatt im Großherzogtum Baden einnahmen, die letzte Bastion des radikalen Aufstands. Kurz danach, im August 1849, zerschlugen französische Truppen die Römische Republik und stellten das Papsttum wieder her, sehr zum Ärger all jener, die Frankreich einst als Schirmherrin der Revolution auf dem ganzen Kontinent verehrt hatten. Um die gleiche Zeit ging auch der erbitterte Kampf um die Zukunft des Königreichs Ungarn zu Ende, als österreichische und russische Truppen das Land besetzten. Ende Sommer 1849 waren die Revolutionen weitgehend vorüber.
Diese düsteren und häufig sehr gewaltsamen Tage der Abrechnung hatten nicht zuletzt zur Folge, dass dem Narrativ dieser Aufstände ein erlösender Abschluss fehlte. Ebendieses Stigma des Scheiterns schreckte mich seinerzeit von den Revolutionen 1848 ab, als ich ihnen in der Schule zum ersten Mal begegnete. Komplexität und Scheitern, das ist eine unattraktive Kombination.
Warum sollten wir uns also heute die Mühe machen, uns mit den Ereignissen von 1848 zu befassen? Erstens sind die Revolutionen von 1848 in Wirklichkeit nicht gescheitert: In vielen Ländern bewirkten sie einen zügigen und dauerhaften konstitutionellen Wandel; und das Europa nach 1848 war oder wurde ein völlig anderer Ort. Man sollte sich diesen kontinentalen Aufstand eher als Teilchenbeschleuniger im Zentrum des europäischen 19. Jahrhunderts vorstellen. Menschen, Gruppierungen und Ideen flogen hinein, prallten aufeinander, verschmolzen oder zersplitterten und traten in Formen neuer Einheiten hervor, deren Spuren sich durch die kommenden Jahrzehnte ziehen. Politische Bewegungen und Ideen, vom Sozialismus und demokratischen Radikalismus bis hin zum Liberalismus, Nationalismus, Korporatismus und Konservatismus, wurden in dieser Kammer getestet; und sie wurden allesamt verändert, mit tiefgreifenden Konsequenzen für die neuere Geschichte Europas. Außerdem bewirkten die Revolutionen – ungeachtet dessen, dass sich die Vorstellung von ihrem »Scheitern« so hartnäckig hielt – einen tiefgreifenden Wandel in politischen und administrativen Verfahren auf dem ganzen Kontinent, gewissermaßen eine europäische »Revolution in der Regierung«.
Zweitens haben die Fragen, die die Aufständischen von 1848 stellten, nichts von ihrer Bedeutung verloren. Ein paar Ausnahmen liegen auf der Hand: Wir zerbrechen uns nicht länger den Kopf über die weltliche Macht des Papsttums oder die »Schleswig-Holstein-Frage«. Aber wir fragen uns immer noch, was geschieht, wenn Forderungen nach politischer oder wirtschaftlicher Freiheit im Konflikt stehen mit Forderungen nach sozialen Rechten. Pressefreiheit sei gut und schön, wurden die Radikalen von 1848 nicht müde zu betonen, aber welchen Sinn habe eine anspruchsvolle Zeitung, wenn man sie vor lauter Hunger nicht lesen könne? Deutsche Radikale brachten das Problem mit der hübschen Gegenüberstellung von »Pressefreiheit« und »Fressefreiheit« trefflich auf den Punkt.
Das Schreckgespenst der »Pauperisierung« hatte drohend über den 1840er Jahren gehangen. Wie war es möglich, dass selbst Menschen mit Vollzeitbeschäftigung kaum genügend verdienten, um sich zu ernähren? Ganze Sektoren der Fertigung – die Weber waren das bekannteste Beispiel – schienen von diesem misslichen Zustand betroffen zu sein. Aber was hatte diese Woge der Verelendung zu bedeuten? War die eklatante Ungleichheit zwischen Reich und Arm einfach ein gottgewollter Teil des menschlichen Schicksals, wie Konservative behaupteten, war sie ein Symptom für die Rückständigkeit und allzu starke Regulierung, wie Liberale argumentierten, oder war sie doch vom politischen und wirtschaftlichen System in seiner jetzigen Gestalt erzeugt worden, wie die Radikalen betonten? Konservative setzten auf wohltätige Linderung, Liberale auf wirtschaftliche Deregulierung und industrielles Wachstum, während die Radikalen weniger optimistisch waren: In ihren Augen gründete die ganze Wirtschaftsordnung auf der Ausbeutung der Schwachen durch die Starken. Diese Fragen haben von ihrer Aktualität nichts verloren. Das Problem der »Erwerbsarmut« zählt auch heute zu den brennendsten Fragen der Sozialpolitik. Und das Verhältnis zwischen Kapitalismus und sozialer Ungleichheit steht weiterhin auf dem Prüfstand.
Besonders heikel war die Frage nach der Arbeit. Was, wenn Arbeit selbst zur Mangelware wurde? Der Abschwung der Konjunktur im Winter und Frühjahr 1847/48 hatte viele Tausende Männer und Frauen ihren Job gekostet. Hatten Bürger das Recht, die Zuteilung eines Arbeitsplatzes zu fordern, der für ein würdiges Dasein unerlässlich war? Der Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu finden, brachte in Paris die umstrittenen Ateliers nationaux (»Nationalwerkstätten«) und ihre unzähligen Pendants in anderen Teilen Europas hervor. Und doch war es alles andere als einfach, hart arbeitende Bauern etwa im französischen Limousin zu überzeugen, dass sie zusätzliche Abgaben zahlen mussten, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Männer zu finanzieren, die sie als Pariser Herumtreiber ansahen. Andererseits löste ausgerechnet die unvermutete Schließung dieser Werkstätten, die 100 000 Arbeitslose wieder auf die Straßen der Hauptstadt spülte, die Gewalt der Pariser Junitage von 1848 aus.
Der Düsseldorfer Künstler Johann Peter Hasenclever fing diese Frage in seinem brillanten Ölgemälde Arbeiter vor dem Magistrat ein. Das 1849 gemalte und in mehreren Fassungen weithin ausgestellte Bild zeigt eine Arbeiterdelegation, deren Beschäftigungsprogramm – das die Ausgrabung verschiedener Arme des Rheins umfasste – im Herbst 1848 aus Mangel an Geldern eingestellt worden war. In einer opulent geschmückten Ratskammer legen die Arbeiter den Stadtvätern Düsseldorfs eine Protestpetition vor. Durch ein großes Fenster ist ein Redner zu sehen, der draußen auf einem Platz zu einer tobenden Menschenmenge spricht. Karl Marx liebte dieses Gemälde, weil es eindrücklich das abbildete, was er als einen Konflikt zwischen Klassen ansah. Am Ende eines langen Artikels für die New York Tribune lobte er den Künstler, weil er in einem Bild einen Zustand mit »dramatischer Vitalität« wiedergegeben habe, den ein fortschrittlicher Schriftsteller sich nur über viele Seiten hinweg zu analysieren erhoffen könne.[3] Fragen zu sozialen Rechten, zur Armut und zum Recht auf Arbeit zerrissen die Revolutionen im Sommer 1848. Man kann kaum sagen, dass diese Fragen an Dringlichkeit eingebüßt hätten.
Johann Peter Hasenclever, Arbeiter vor dem Magistrat (1849). Eine Gruppe Arbeiter, die seit der Einstellung des Arbeitsbeschaffungsprogramms am Rhein arbeitslos waren, legen im Herbst 1848 ihrem Stadtrat eine Petition vor, um die Wiederaufnahme der Arbeiten zu erreichen. Der Rat ist sichtlich bestürzt. Durch das Fenster ist ein Demagoge zu sehen, der zu einer aufgewiegelten Menge spricht. Das Gemälde bezieht sich auf ein Ereignis, das in Düsseldorf stattfand, aber die Architektur im Hintergrund ist nicht spezifisch für die Stadt und lässt auf ein allgemeineres städtisches Dilemma schließen.
© akg-images
Als nichtlinear verlaufene, phasenweise gewaltsame und transformative »unvollendete Revolution« bleibt 1848 auch für heutige Leser ein bemerkenswertes Studienobjekt. In den Jahren 2010/11 wiesen viele Journalisten und Historiker auf die verblüffende Ähnlichkeit zwischen der ungeordneten Abfolge von Aufständen, die häufig als »Arabischer Frühling« bezeichnet wurden, und den Revolutionen von 1848 hin, die auch als der »Völkerfrühling« bekannt sind. Genau wie die Aufstände in den arabischen Staaten waren sie verschiedenartig, geographisch weit verstreut und doch miteinander verbunden. Das wohl auffälligste Merkmal der Revolutionen von 1848 war ihre Gleichzeitigkeit – sie war schon den Zeitgenossen ein Rätsel, und sie ist ein solches für die Historiker geblieben. Die Gleichzeitigkeit war auch einer der rätselhaftesten Momente der Ereignisse von 2010/11 in den arabischen Ländern, die tiefe lokale Wurzeln hatten, aber eindeutig auch miteinander verknüpft waren. Zwar gleicht der Tahrir-Platz in Kairo in vielerlei Hinsicht nicht dem Markusplatz in Venedig, zwar ist die Vossische Zeitung nicht Facebook – aber die Dinge sind sich doch so ähnlich, dass einem größere, verbindende Gedanken in den Sinn kommen. Der entscheidende Punkt ist ein allgemeiner Aspekt: Mit ihrer verwirrenden Vielfältigkeit, mit der unvorhersehbaren Interaktion so vieler Kräfte ähneln die Unruhen um die Mitte des 19. Jahrhunderts den chaotischen Erhebungen unserer Zeit, bei denen es schwerfällt, klar definierte Endpunkte zu nennen.
Die Revolution von 1848 war eine Revolution der Versammlungen: die Konstituierende Versammlung in Paris, die den Weg für die Legislative mit einer Kammer namens Assemblée nationale frei machte; die Preußische Nationalversammlung in Berlin, die nach eigens zu diesem Zweck erlassenen Gesetzen gewählt worden war; das Parlament in Frankfurt, das im noblen Rundbau der Paulskirche in der Frankfurter Innenstadt einberufen wurde. Der ungarische Landtag war ein sehr altes Gremium, doch im Lauf der ungarischen Revolutionen von 1848 trat in der Stadt Pest ein neuer nationaler Landtag zusammen. Die revolutionären Aufständischen von Neapel, Sardinien, von der Toskana und dem Kirchenstaat gründeten allesamt neue parlamentarische Gremien. Die Revolutionäre von Sizilien, die sich von der neapolitanischen Herrschaft befreien wollten, gründeten ihr eigenes, rein sizilianisches Parlament, das im April 1848 den neapolitanischen Bourbonen, König Ferdinand II., absetzte.
Doch die Versammlungen waren nur ein Schauplatz. Im Sommer 1848 gerieten sie massiv unter Druck, nicht nur von Seiten der monarchischen Exekutive in vielen Staaten, sondern auch durch eine Reihe rivalisierender Akteure radikalerer Couleur: Netzwerke von Vereinen und »Komitees« etwa oder radikale Gegenversammlungen wie der in Frankfurt im Juli 1848 gegründete Deutsche Handwerker- und Gewerbe-Congress, der jene Arbeiter in Handwerksberufen repräsentierte, deren Interessen in der liberalen und von der Mittelschicht dominierten Nationalversammlung nicht berücksichtigt wurden. Sogar dieses Organ spaltete sich nach fünf Tagen wiederum in zwei separate Kongresse auf, weil es sich als unmöglich erwies, die Kluft zwischen Meistern und Gesellen zu überwinden.
Liberale verehrten die Parlamente und blickten mit Beklemmung auf die Vereine und Versammlungen der Radikalen, die in ihren Augen die großartige Kultur ordnungsgemäß gewählter und konstituierter Kammern allenfalls karikierten. Aus der Perspektive der »Kammerliberalen« noch alarmierender war jedoch die Aussicht, dass Demonstrationen eigens zu dem Zweck organisiert wurden, sich direkt in die Angelegenheiten der Parlamente einzumischen. Genau das geschah am 15. Mai 1848 in Paris, als eine Menschenmenge in den schwach bewachten Saal der Nationalversammlung eindrang, den Ablauf störte, eine Petition verlas und dann zum Hôtel de Ville abzog, wo sie eine »aufständische Regierung« unter Führung namhafter Radikaler ausrief. Die Spannung zwischen parlamentarischen und anderen Formen der Repräsentation – zwischen repräsentativen und direkten Formen der Demokratie – ist ein weiteres Merkmal von 1848, das noch in der heutigen politischen Landschaft nachklingt. Die Parlamente sehen sich derzeit mit einem Absinken der öffentlichen Wertschätzung konfrontiert, und eine breite Palette rivalisierender nicht- oder außerparlamentarischer Gruppierungen ist entstanden, die soziale Medien nutzen und sich im Umfeld von Themen organisieren, die professionelle Politiker möglicherweise nicht auf dem Schirm haben.
1848 war nicht nur eine Geschichte der Revolutionäre. Liberal gesinnte Historiker des 20. und 21. Jahrhunderts fühlten sich naturgemäß zu der Sache derjenigen hingezogen, deren Forderungen – nach Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit, nach Verfassungen, regelmäßigen Wahlen und Parlamenten – in das Repertoire der modernen liberalen Demokratie Einzug hielten. Ich teile zwar diese Affinität zu Zeitung lesenden, Kaffee trinkenden, prozessorientierten Liberalen, aber mir kommt es so vor, als würde eine Schilderung, die die Ereignisse lediglich von einem aufständischen oder liberalen Standpunkt aus betrachtet, einen wesentlichen Teil des dramatischen Verlaufs und der Bedeutung dieser Revolutionen außer Acht lassen. Sie waren ein vielschichtiges Aufeinandertreffen alter und neuer Kräfte, bei dem die alten ebenso zur Gestaltung der kurz- und langfristigen Ergebnisse der Revolutionen beitrugen wie die neuen. Doch selbst diese Korrektur greift zu kurz, weil die »alten Kräfte«, die die Revolution überstanden, ihrerseits durch sie verändert wurden, wenn auch im Großen und Ganzen nicht auf eine Weise, für die sich Historiker groß interessiert haben. Der künftige preußische Ministerpräsident und deutsche Staatsmann Otto von Bismarck war 1848 noch ein kleines Licht, aber die Revolution verschaffte ihm die Gelegenheit, sein persönliches Schicksal mit der Zukunft seines Landes zu verschmelzen. Sein Leben lang würdigte er 1848 als einen Bruch zwischen einer Epoche und der nächsten, als einen Moment des Wandels, ohne den seine eigene Karriere undenkbar gewesen wäre. Das Papsttum Pius’ IX. wurde durch die Revolutionen von Grund auf verändert, genau wie die katholische Kirche und ihr Verhältnis zur modernen Welt. Die heutige katholische Kirche ist in vieler Hinsicht die Frucht dieses Moments. Napoleon III. betrachtete sich keineswegs als Abrissbirne der Revolution, sondern vielmehr als Restaurator der Ordnung. Er sprach von der Notwendigkeit, die von der Revolution entfesselten Kräfte nicht abzublocken, sondern zu kanalisieren, den Staat als die Avantgarde des materiellen Fortschritts zu etablieren.
Es war ein Aufstand, bei dem es bisweilen schwerfiel und – fällt, die Trennlinie zwischen Revolution und Konterrevolution zu ziehen. Viele »1848er« starben für ihre Überzeugungen oder gingen ins Exil oder Gefängnis, andere aber wechselten die Seite, schlossen mit den postrevolutionären Regierungen ihren Frieden, die ihrerseits durch den revolutionären Schock verändert oder geläutert worden waren. So begann ein langer Marsch durch die Institutionen. Mehr als ein Drittel der Präfekten (der regionalen Polizeichefs) des bonapartistischen Frankreichs nach 1848 waren ehemalige Radikale; das Gleiche galt für den österreichischen Innenminister von Juli 1849 an, Alexander von Bach, dessen Name einst auf der Liste der verdächtigen Demokraten gestanden hatte, die die Wiener Polizei geführt hatte. Konterrevolutionäre waren – in ihren eigenen Augen – meistens die Vollstrecker der Revolution und nicht deren Totengräber. Indem wir diesen Aspekt verstehen, wird es uns möglich, klarer zu erkennen, inwiefern diese Revolution Europa veränderte.
In der Erinnerung waren die Revolutionen (zumindest bei vielen ehemaligen Teilnehmern) von starken Licht-Schatten-Kontrasten geprägt: die strahlende Euphorie der ersten Tage, dann die Enttäuschung, Bitterkeit und Melancholie, die sich einstellten, als die Konterrevolution »ein eisernes Netz« (wie die Berlinerin Fanny Lewald es nannte) über die aufständischen Städte ausspannte.[4] Euphorie und Enttäuschung waren Teil der Geschichte, aber auch Angst. Soldaten hatten vor wütenden Stadtbewohnern fast ebenso viel Angst wie Letztere vor ihnen. Die plötzlichen Panikausbrüche der Menschenmassen, denen sich Soldaten entgegenstellten, lösten unberechenbare Massenfluchten aus, die in jeder aufständischen Stadt zu beobachten waren. »Seit dem 25. Februar«, schrieb Émile Thomas, der Architekt der Nationalwerkstätten in Paris und später ein eifriger Bonapartist, »haben wir unter dem Einfluss der Angst regiert, unter jenem schlechten Ratgeber, der alle guten Absichten lähmt.«[5]
Anführer der Liberalen befürchteten, dass sie außerstande sein könnten, die durch die Revolution freigesetzten sozialen Energien zu kontrollieren. Menschen von geringerer sozialer Stellung hatten wiederum Angst, dass eine Verschwörung im Gange sei, um die Revolution hinters Licht zu führen, ihre Errungenschaften rückgängig zu machen und die einfachen Bürger für immer in Armut und Hilflosigkeit zu stürzen. Die Stadtbewohner der Mittelschicht zuckten zusammen, als ungehobelte Gestalten aus den Vorstädten durch die Stadttore strömten, von denen inzwischen die militärischen Wachen abgezogen waren. Sie hatten Angst um ihr Vermögen und bisweilen um ihr Leben. In Palermo hatte der Aufstand eine rohe, vielschichtige und potenziell unbeherrschbare soziale Unterströmung. Die ersten Führer der Revolution in der sizilianischen Stadt waren noch schwerfällige und berechenbare Würdenträger gewesen, bei denen man sich darauf verlassen konnte, dass sie maßvoll und vernünftig handelten. Wie Ferdinando Malvica, der Autor einer großen, unveröffentlichten zeitgenössischen Chronik der palermitanischen Revolution schilderte, füllten sich die Straßen jedoch schon bald mit bewaffneten maestranze (Zunftmitgliedern) und, noch beunruhigender, mit Trupps aus dem Umland: Dabei handelte es sich um »grausame Männer, so gut wie ohne menschliche Gefühle, ebenso blutrünstig wie rüpelhaft, hässliche Leute [von denen] sich die wunderschöne Hauptstadt Siziliens umgeben sah, infernalische Stämme, lediglich von Kreaturen bevölkert, an denen nichts Menschliches [war] außer ihren sonnenverbrannten Gesichtern«.[6] Ohne die treibende Kraft und die vermeintliche Bedrohung, die von solchen Leuten ausging, hätten die Aufstände von 1848 niemals Erfolg haben können; und doch lähmte eine alles durchdringende Angst vor den niederen Ständen die Revolution in den späteren Phasen und machte es leichter, verschiedene Interessengruppen gegeneinander auszuspielen, Liberale in die Arme der etablierten Obrigkeit zu treiben und Radikale als Feinde der gesellschaftlichen Ordnung zu isolieren. Andererseits konnte das Nachlassen der Furcht auch Ausbrüche euphorischer Emotionen auslösen, wie es in vielen europäischen Städten in den Frühlingstagen geschah, als Bürger plötzlich ihre Angst vor den Sicherheitskräften der Geheimpolizei ablegten oder überwanden. Konkrete Gefühlsausbrüche ließen sich als Ausdruck der revolutionären Empfindsamkeit deuten, und einige Emotionen vermitteln, wie unverwechselbar 1848 als Moment des Aufstands der Mittelschicht war. In den frühen Morgenstunden des 9. November 1848 wurde der radikale Abgeordnete Robert Blum – laut mehreren Gedichten und Liedern, die an seinen Tod erinnern – dabei beobachtet, wie er auf dem Weg zu seiner Hinrichtung eine Träne vergoss. Als ein Offizier daraufhin meinte: »Haben Sie keine Angst, in ein paar Augenblicken ist alles vorbei«, wischte Blum den Versuch, ihn zu trösten, beiseite und erwiderte, indem er sich zu seiner vollen (nicht allzu hohen) Größe aufrichtete: »Diese Träne ist nicht die Träne des Abgeordneten der deutschen Nation Robert Blum. Dies ist die Träne des Vaters und des Ehemanns.«
Blums Träne hielt Einzug in die Legende der Radikalen. Das Lied »Was zieht dort zur Brigittenau (Vom Tode Robert Blums)«, das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in allen süddeutschen Staaten gesungen wurde, enthält einen Verweis auf diesen Moment des privaten Kummers mitten im öffentlichen Ritual einer politisch motivierten Hinrichtung: »Die Träne für Weib und Kinder«, intoniert es feierlich, »entehret keinen Mann.« Die Träne lebte in der Erinnerung weiter, weil sie Blum als einen mit der Mittelschicht und deren Werten verbundenen Mann präsentierte, als Privatmann, der in die Politik eingetreten war. Das war Politik im bürgerlichen Sinn.
Selbstverständlich zeigten auch die Konterrevolutionäre Gefühle. Am Ende einer außergewöhnlichen Rede im Vereinigten Landtag in Berlin, in der Otto von Bismarck widerwillig erklärte, dass er die Revolution nunmehr als eine unumkehrbare historische Tatsache und das neue liberale Ministerium als die künftige Regierung akzeptiere, verließ er unter heftigem Schluchzen das Rednerpult. Diese Tränen waren, anders als diejenigen Blums, betont öffentlich, sowohl in ihrem performativen Charakter wie in ihrer Ursächlichkeit. Der Aufruf »Berliner Schweine!«, den Rekruten aus den dörflichen Provinzen Brandenburgs schrien, als sie in der Hauptstadt mit Knüppeln und Eisenstangen während der Märztage auf mutmaßliche Barrikadenkämpfer einprügelten, verrät uns einiges (wenn auch gewiss nicht alles) über die Gefühle, die die Jugend des Landes beim Auftrag der städtischen Aufstandsbekämpfung empfand. Rachsucht und Wut waren ausschlaggebend für die Brutalität österreichischer Generäle wie Julius von Haynau, der allem Anschein nach die Todesurteile und Hinrichtungen sehr genoss, die er gegen besiegte ungarische Aufständische vollstreckte.
Dieses Buch beschreibt in Kapitel 1 die prekäre soziale Welt in Europa vor 1848 – eine Ära, in der die große Mehrheit der Bevölkerung im Zuge des rasanten Wandels in Bedrängnis geriet und litt. Zwischen sozialer Not und politischen Unruhen bestand zwar ein tiefer, nicht aber zwangsläufig direkter Zusammenhang. Der wirtschaftlich motivierte Protest und das unübersehbare, soziale Elend entfesselten jedoch eine polarisierende, politische Energie, die dazu beitrug, die Loyalitäten jener zu prägen, die die Revolutionen von 1848 durchführen oder erben sollten. Das politische Universum, in dem die Revolutionen ausbrachen (Kapitel 2), war nicht durch feste Verpflichtungen und stabile Parteizugehörigkeiten strukturiert. Die Europäer dieser Zeit vollführten überaus eigenwillige Reisen durch einen regelrechten Archipel aus Argumenten und Gedankenketten. Sie waren in Bewegung, und das blieben sie auch während und nach den Revolutionen um die Mitte des Jahrhunderts. Die politischen Konflikte der 1830er und 1840er Jahre (Kapitel 3) wurden entlang unzähliger Spannungslinien ausgetragen. Es gab keine binäre Spaltung, sondern eine Fülle von Rissen, die in alle Richtungen liefen. Das blieb ein Merkmal der Revolutionen selbst, die auf den ersten Blick bemerkenswert chaotisch und undurchsichtig blieben – in dieser Hinsicht ähneln sie den Konflikten, die heute unsere Aufmerksamkeit fesseln.
Die Kapitel 4 bis 6 konzentrieren sich auf die Revolutionen selbst: Gestalteten die Revolutionäre die Geschehnisse, oder war es eher umgekehrt? Die Aufstände begannen mit Szenen, die häufig grandios dramatisch wirkten. Eine Schilderung des Beginns muss daher sowohl ihre große Wucht als auch die strukturelle und psychosoziale Anfälligkeit erklären, die ihnen später zum Verhängnis werden sollten. Kapitel 5 befasst sich mit den parallelen Vorgängen, die sich an allen Hauptschauplätzen abspielten: die Veränderung der Städte in Schaltkreise, die vor politischen Emotionen nur so brodelten, die feierliche Beisetzung der toten Revolutionäre, die Bildung neuer Regierungen, Kammern und Verfassungen, häufig unter extrem unsicheren Bedingungen. Die Revolutionäre von 1848 hielten sich für die Überbringer und Wegbereiter der »Emanzipation«, aber was hieß das für diejenigen, die hofften, durch sie Emanzipation zu erlangen? Das Nachzeichnen der Pfade der versklavten Afrikaner des französischen Kolonialreichs, der politisch aktiven Frauen, Juden und »Zigeuner-Sklaven« der rumänischen Gebiete ist eine Möglichkeit, das Ausmaß und die Grenzen dessen zu ermessen, was 1848 wirklich erreicht wurde.
Die Kapitel 7 und 8 untersuchen das Abfallen der Revolutionen, wobei zunächst das allmähliche Nachlassen der revolutionären Energien, die Zersplitterung der Anstrengungen und die Abspaltung von gemeinsamen Unternehmungen im Mittelpunkt stehen, die ein Merkmal des Sommers und Herbstes 1848 waren. Es folgt die lange Reihe zunehmend gewalttätiger Polizeimaßnahmen, die den Revolutionen ein Ende setzten. Um diesen Teil der Geschichte zu erklären, müssen wir nicht nur die Schwächen verstehen, die es ermöglichten, das Momentum der Revolutionen zu stoppen, sondern auch die Wurzeln des Erfolgs der Konterrevolution, die teils in latenten, aus der Vergangenheit ererbten Vorteilen, teils in den Lehren zu suchen sind, die man aus der Beobachtung des Verlaufs der Revolutionen zog. Unter anderem enthüllt diese Schlussphase, wie viel besser es die Konterrevolutionäre verstanden, auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten. Der Verlauf der Revolutionen von 1848 wurde, wie sich zeigt, ebenso sehr von den Beziehungen zwischen Staaten wie auch von den bürgerlichen Unruhen in ihnen geprägt. Kapitel 9 führt in Raum und Zeit von den Epizentren des Aufstands fort. In ganz Nord- und Südamerika, in Südasien und im Pazifischen Raum drangen die Erschütterungen, die von den europäischen Revolutionen ausgelöst worden waren, in komplexe Gesellschaften ein, polarisierten oder klärten politische Debatten und ermahnten alle Beteiligten an die Formbarkeit und Zerbrechlichkeit aller politischen Strukturen. Je weiter wir uns geographisch von Europa entfernen, desto weniger trifft die Metapher »Einfluss« zu – die Verbreitung inhaltlicher Aspekte wurde weniger wichtig als die selektiven Deutungen aus der Ferne, getrieben von lokalen Prozessen politischer Differenzierung und Konflikten. Auf dem europäischen Kontinent hingegen hinterließ 1848 ein tiefes und dauerhaftes Vermächtnis. Um dies klar zu erkennen, müssen wir den Menschen, den Ideen und der Geisteskultur der Mitte des 19. Jahrhunderts beim Eintritt in die Revolutionen von 1848 und wieder heraus folgen.
Europäer haben, wie alle Menschen, das Bedürfnis sich mitzuteilen, und dieses Bedürfnis hat sich in keiner Revolution so stark wie 1848 geäußert. Das Jahr brachte eine wirklich erstaunliche Fülle persönlicher Zeugnisse hervor. Ich habe mich durchweg bemüht, auf diese verschiedenen Stimmen zu hören und darüber nachzudenken, welche Hinweise sie uns zur tieferen Bedeutung der sie umringenden Geschehnisse geben können. Aber Redseligkeit ist nicht zwangsläufig kommunikativ, und es ist wichtig, sich auch mit jenen Situationen zu befassen, in denen die Akteure von 1848 eher aneinander vorbei als miteinander redeten. Reden konnten gleichzeitig aufrüttelnd und hohl sein. Liberale und Radikale sprachen lang und breit vor Dorfbewohnern über die Tugend und Notwendigkeit des revolutionären Kampfes, doch häufig mit dürftigen Ergebnissen. Liberale fanden Mittel und Wege, die Forderungen der Radikalen falsch auszulegen oder einfach zu überhören. Informationen kursierten – ganz ähnlich wie heute – in einem Nebel aus Gerüchten und Falschmeldungen, und die Angst ließ die Bevölkerung auf bestimmte Stimmen und Ideen hören, während sie ihre Ohren für andere verschloss.
Zu den auffälligsten Aspekten dieser Revolutionen zählt die Intensität des historischen Bewusstseins unter so vielen zentralen Akteuren. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen 1848 und dem großen Vorgänger im 18. Jahrhundert: Die Revolution von 1789 war völlig überraschend eingetreten, während die Zeitgenossen Mitte des 19. Jahrhunderts die Ereignisse dann vor dem Muster des großen Originals deuteten. Zudem taten sie es in einer Welt, in der der Begriff Geschichte ein enormes semantisches Gewicht erlangt hatte. Für sie ereignete sich, viel stärker als für die Männer und Frauen von 1789, in der Gegenwart Historisches. Ihre Bewegungen lassen sich in jeder Wende des Verlaufs der Revolution erkennen. Eine erstaunlich große Zahl von ihnen schrieb Erinnerungen oder historische Abhandlungen, die vor Fußnoten nur so wimmeln.
In den Augen mancher machte diese Tendenz zum Rückblick die Ereignisse von 1848 zu einer jämmerlichen Parodie des großen französischen Originals. Der eloquenteste Verfechter dieser Anschauung war Karl Marx. Aber für andere war das Verhältnis genau umgekehrt: Keineswegs war die epische Energie von 1789 für eine Karikatur vergeudet worden, sondern das durch die erste Revolution ermöglichte historische Bewusstsein hatte sich vielmehr vertieft und war viel breiter propagiert worden, sodass es die Ereignisse von 1848 mit Sinn erfüllte. Der chilenische Schriftsteller, Journalist, Historiker und Politiker Benjamin Vicuña Mackenna erfasste ebendiese Andeutung, als er in seinen Memoiren schrieb:
Die Französische Revolution von 1848 rief in Chile ein starkes Echo hervor. Für uns arme Bewohner einer Kolonie an den Küsten des Pazifik war ihr Vorgänger im Jahr 1789, der in der Geschichte so gefeiert wird, nur ein aufblitzendes Licht in unserer Dunkelheit gewesen. Ein halbes Jahrhundert später hingegen hatte ihre Zwillingsschwester jedes Merkmal eines brillanten Strahlens. Wir hatten sie kommen sehen, wir studierten sie, wir verstanden sie, wir bewunderten sie.[7]
1
Soziale Fragen
Im Folgenden geht es um wirtschaftliche Not, allgegenwärtige Angst, Ernährungskrisen und massive Gewalt. Wir befassen uns mit den Gesellschaften Europas vor 1848, wobei das Augenmerk auf Bereichen der Repression, Verdrängung, Unterdrückung und des Konflikts liegt. Soziale Unzufriedenheit »verursacht« keine Revolutionen – wenn sie das täte, käme es viel häufiger zu Revolutionen. Dennoch war die materielle Not der Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts der unverzichtbare Hintergrund für jene Prozesse der politischen Polarisierung, die die Revolutionen erst ermöglichten. Sie war ausschlaggebend für die Motivation vieler Teilnehmer an städtischen Unruhen. Ebenso wichtig wie die Realität und das Ausmaß des Leids waren die Mittel und Wege, mit denen diese Ära soziale Missstände wahrnahm und einordnete. Die »soziale Frage«, die Europäer Mitte des 19. Jahrhunderts beschäftigte, war ein ganzer Komplex realer Probleme, aber sie war zugleich auch eine Art der Wahrnehmung. Das Kapitel beginnt mit Szenen aus dem Leben der Armen und weniger Armen und setzt sich mit den Mechanismen auseinander, die soziale Gruppen voneinander entfremdet und über die Grenze zwischen Auskommen und Not gedrängt haben. Es untersucht die Methoden, die von jenen, die mit ihren Händen Dinge schufen (insbesondere die Weber), angewandt wurden, um ihre Lage durch gezielten Einsatz von Protest und Gewalt zu verbessern. Es schließt mit der politischen und sozialen Unruhe von 1846, als ein gescheiterter politischer Aufstand in Galizien durch einen gewaltsamen sozialen Aufruhr von unten vereinnahmt wurde – eine Episode, die die Menschen von 1848 eine Fülle düsterer Lektionen lehrte.
Die Politik der Beschreibung
Wer wissen möchte, wie die ärmsten Arbeiter leben, möge sich in die Rue des Fumiers begeben, die fast ausschließlich von dieser Klasse bewohnt wird. Bücken Sie sich und betreten Sie eine der Kloaken, die auf die Straße hinausgehen; treten Sie ein in einen unterirdischen Gang, wo die Luft feucht und kalt wie in einer Höhle ist. Sie werden merken, dass Ihre Füße auf dem verdreckten Boden rutschen; Sie werden Angst haben, in den Schlamm zu fallen. Auf beiden Seiten werden Sie, wenn Sie weitergehen, dunkle eisige Kammern antreffen, aus deren Wänden schmutziges Wasser sickert, nur vom schwachen Licht eines winzigen Fensters erhellt, das zu stümperhaft angefertigt ist, um es ordentlich zu schließen. Drücken Sie die dünne Tür auf und treten Sie ein, sofern die übel riechende Luft Sie nicht abstößt. Aber passen Sie auf, weil der dreckige, unebene Boden mit Unrat bedeckt ist und weder gepflastert noch ordentlich gefliest. Hier befinden sich drei oder vier schäbige Bettstellen, mit einem Seil zusammengebunden und von abgetragenen Lumpen bedeckt, die kaum jemals gewaschen werden. Und Schränke? Überflüssig. In einem Heim wie diesem gibt es nichts, was man darin aufbewahren könnte. Ein Spinnrad und ein Webstuhl vervollständigen die Einrichtung.
So beschrieben die beiden Ärzte Ange Guépin und Eugène Bonamy im Jahr 1835 die ärmste Straße ihrer Stadt.[1] Es handelte sich nicht um Paris oder Lyon, sondern um Nantes, eine Provinzstadt an der Loire in der Region Obere Bretagne, im Westen Frankreichs. Nantes war keine pulsierende Metropole: Im Jahr 1836 lebten dort knapp 76 000 Menschen, zusammen mit rund 10 700 überwiegend männlichen Wanderarbeitern, Seeleuten, Reisenden und Garnisonstruppen. Diese Zahlen brachten Nantes keineswegs auf die Liste der 40 bevölkerungsreichsten Städte Europas. Die Stadt hatte vielmehr immer noch alle Mühe, den Schock der Revolutions- und Napoleonischen Kriege zu überwinden. Diese geopolitischen Störungen hatten den Atlantikhandel einbrechen lassen (insbesondere jenen mit versklavten Afrikanern und Afrikanerinnen), der Nantes im 18. Jahrhundert reich gemacht hatte; an einigen der schönsten Straßen reihten sich die noblen Häuser wohlhabender Sklavenhändler.[2] Die Bevölkerung hatte während der Kriege abgenommen, und trotz eines wirtschaftlichen Aufschwungs nach 1815 wuchs sie weiterhin nur langsam, teils weil sich die französische Atlantikküste nie ganz von den Auswirkungen der britischen Blockade erholte, teils weil der Markt für Textilwaren zunehmend umkämpft war und teils weil eine Ansammlung von Schlick in der Loire inzwischen verhinderte, dass größere Schiffe die Kais der Stadt erreichten. Im Jahr 1837 hatte der Außenhandel der Stadt immer noch nicht den Stand von 1790 erreicht.[3] Eine vom Bürgermeister im Jahr 1838 in Auftrag gegebene Studie zeichnete ein industrielles Leben, das von relativ kleinen Unternehmen dominiert wurde: 25 Baumwollspinnereien mit 1327 Beschäftigten, 12 Bauhöfe mit 565 Beschäftigten, 38 Woll-, Barchent- und Textilfabriken, 9 Kupfer- und Eisengießereien, 13 kleine Zuckerraffinerien mit 310 Beschäftigten, 5 Konservenfabriken mit 290 Beschäftigten und 38 Gerbereien mit 193 Beschäftigten.[4] Eine weit größere Zahl arbeitete außerhalb der Fabriken und Gießereien. Diese Erwerbstätigen nahmen Stückarbeit an, wuschen Wäsche, arbeiteten auf Baustellen oder als Bedienstete der verschiedensten Art.
Doch die relativ bescheidene Stadt wies in ihrem Mikrokosmos extreme Unterschiede in der Lebensqualität auf, und ebendiese zogen die Aufmerksamkeit von Guépin und Bonamy auf sich, zwei Ärzten mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen. In einem umfangreichen Werk statistischer Erfassung führten sie dem Leser die Stadt Nantes vor Augen: ihre Straßen, Kais, Fabriken und Plätze, ihre Schulen, Klubs, Bibliotheken, Brunnen, Gefängnisse und Krankenhäuser. Die eindringlichsten Textstellen enthielt ein Kapitel gegen Ende des Buches über die »Daseinsformen verschiedener Klassen der Gesellschaft in Nantes«. Hier lag der Schwerpunkt auf der Vielfalt sozialer Schicksale. Die Autoren unterschieden acht »Klassen« in der Stadt – was nicht ganz dem dialektischen Dreiklang entsprach, der den Sozialismus nach Marx dominieren sollte. Die erste Klasse umfasste einfach die »Vermögenden«. Darauf folgten die vier Ränge des Bürgertums: das »gehobene Bürgertum«, das »wohlhabende Bürgertum«, das »notleidende Bürgertum« und das »arme Bürgertum«. Am unteren Ende der Pyramide waren die drei Arbeiterklassen angesiedelt: die »begüterten«, die »armen« und die »elenden«.[5]
Die ganzheitliche soziologische Qualität der Beobachtungen ist verblüffend. Die Autoren gingen über die Beschreibung der ökonomischen Bedingungen jeder Gruppe hinaus und tendierten bereits zu einer Bewertung der Lebensweisen, Bräuche, Einstellungen und Werte. »Die Reichen«, stellten sie fest, neigten dazu, wenig Kinder zu haben (im Durchschnitt zwei) und Wohnungen zu belegen, die zwischen zehn und 15 Zimmer aufwiesen, erhellt von zwölf bis 15 hohen und breiten Fenstern. Das Leben der Bewohner wurde durch »tausend kleine Annehmlichkeiten« versüßt, »die man für unverzichtbar halten könnte, wenn sie nicht einem gewaltigen Teil der Bevölkerung verwehrt wären«.
Die nächste Schicht, das gehobene Bürgertum, unternahm enorme Anstrengung zur Organisation der jahreszeitlichen Bälle, welche es für ihre Töchter ausrichtete. Ganze Wohnungen wurden ausgeräumt, um Platz für die Tänzer zu schaffen; für die ältere Generation wurden in der Mansarde Liegen hergerichtet. Die Friseure brachte die Ballsaison schier um den Verstand, weil sie belagert wurden wie Ärzte bei einer Epidemie (sowohl Guépin als auch Bonamy hatten bei der Bekämpfung der Cholera, die 1832 in Nantes grassierte und 800 Bewohner tötete, eine bedeutende Rolle gespielt). Ob die Nacht der Festivitäten wirklich die ganze Mühe wert gewesen war, sei, zumindest nach der Einschätzung der Autoren, fraglich. Denn in Wahrheit sei ein großer Ball in Nantes doch »ein Gedränge, in dem man endlos schwitzt, stickige Luft einatmet und mit Sicherheit die eigenen Aussichten auf ein langes Leben mindert«. Und am nächsten Morgen finde man, wenn es kalt gewesen war, in den Fensterrahmen »Klumpen schrecklich schmutzigen Eises« vor. »Der Dampf, der beim Kondensieren diese Eisklumpen bildete, war die Atmosphäre, wo 300 Gäste atmeten.«[6]
Während das gehobene Bürgertum eigene Pferde und Kutschen unterhielt, gaben sich die Angehörigen eines Haushalts des »wohlhabenden« Bürgertums (Schicht 3) damit zufrieden, im Stellwagen durch die Stadt zu fahren. Der Hausherr sei ein loyaler Abonnent seines Leseklubs, wussten die Autoren, aber er lebe auch in ständiger Angst, weil er »stets weiß, dass Sparsamkeit und Arbeit nötig sein werden, um seine ganzen Kosten zu decken«. Aufgrund der Notwendigkeit hauszuhalten war die extravagante Lebensweise ausgeschlossen, die die beiden obersten Schichten an den Tag legten, auch wenn sich die Kinder dieser Klasse im Umgang mit den sozial Bessergestellten leichter taten als noch ihre Eltern.
Ganz besonderes Mitgefühl verdiente das »notleidende Bürgertum« (Bourgeois gênés: Schicht 4). Dabei handelte es sich um Angestellte, Professoren, Schalterbeamte, Ladenbesitzer, »die untere Schicht der Künstler«: Gemeinsam bildeten sie »eine der am unglücklichsten Klassen«, weil Kontakte zu einer reicheren Schicht sie in Unkosten stürzten, die ihre Mittel überstiegen. Diese Familien konnten sich lediglich mithilfe strengster Sparsamkeit ernähren. Das »arme Bürgertum« (Schicht 5) nahm in dem sozialen Gefüge einen paradoxen Ort ein: Mit etwa 1000 bis 1800 Franc im Jahr verdienten sie kaum mehr als bessergestellte Arbeiter, die die nächste Schicht belegten, und konnten sich lediglich zwei oder drei Zimmer, keine Bediensteten und eine ungleichmäßige Erziehung für ihre Kinder leisten. Es handelte sich um Büroangestellte, Kassierer und niedere Akademiker, deren Los »das Überleben für die Gegenwart und Angst um die Zukunft war«. Was sie unter Armut verstanden, war jedoch großer Reichtum für »begüterte Arbeiter« (Schicht 6), die »ohne Sorgen um die Zukunft« mit einem geringeren Einkommen leben konnten (ihre Löhne reichten von 600 bis 1000 Franc). Das war die Klasse der Drucker, Maurer, Zimmerleute und Tischler, »die Klasse guter Arbeiter, im Allgemeinen ehrlich, ihren Freunden treu, sympathisch, drinnen sauber, die voller Fürsorge eine große Familie aufziehen«. Ihre Arbeit war lang und hart, aber sie erledigten sie mit Mut und sogar Freude. Sie hatten aufgrund des Umstands, dass ihre Familie gekleidet und versorgt war, das Gefühl, etwas geleistet zu haben; wenn sie abends heimkehrten, konnten sie »im Winter ein Feuer [antreffen] und ausreichend Lebensmittel, um ihre Kraft wiederherzustellen«. Demnach waren sie die glücklichsten Stadtbewohner, weil unter ihnen die Mittel und die Ansprüche am besten abgestimmt waren.[7]
Am unteren Ende der Pyramide, noch unter einer schemenhaften Schicht »armer Arbeiter«, die von 500 bis 600 Franc lebten (Schicht 7), befanden sich jene, die in einem Zustand »extremen Elends« (Schicht 8) ihr Dasein fristeten. Das Leben dieser Menschen unterschied sich in jeder Hinsicht von dem der begüterten Arbeiter, nicht nur weil ihr Einkommen (um 300 Franc jährlich) so karg war, sondern auch weil es ihnen an der Vielzahl nicht fassbarer Annehmlichkeiten und Entschädigungen mangelte, die den wohlhabenderen Zeitgenossen den Tag versüßten: Nach der Arbeit gab es keine echte Rast, keine Vergünstigung im Gegenzug für gut erledigte Arbeit, »kein Lächeln auf einen Seufzer«. Die materiellen und moralischen Vergnügungen und das Gefühl, etwas geleistet zu haben, das die Maurer und Tischler anspornte, hatten im Leben dieser elendsten keinen Platz. »Für sie heißt leben: nicht sterben.« Diese Leute lebten in den übel riechenden Kellern der Rue des Fumiers und anderer vergleichbarer Straßen, etwa die Rue de la Bastille oder die Rue du Marchix. Hier arbeiteten sie täglich 14 Stunden beim Licht einer Kerze für einen Lohn von 15 bis 20 Sous.[8]
Immer wieder griffen die Autoren auf statistische Angaben zurück, nicht nur weil sie dazu dienten, ihre Beschreibungen auf einen Sockel unbestreitbarer Tatsachen zu heben und damit von einer rein politischen Aussage zu distanzieren, sondern auch weil Zahlen bisweilen mehr als Worte aussagten. Hier sind die Ausgaben, die ein Haushalt hatte, der von 300 Franc im Jahr lebte:
Was immer wir über diesen elenden Sektor der Gesellschaft sagen können – die Aufzählung seiner Ausgaben wird mehr aussagen; hier ist die Liste:
Miete
25
Fr.
Wäsche
12
Heizung (Holz und Torf)
35
Beleuchtung
15
Reparatur kaputter Möbel
3
Umzug (mindestens einmal jährlich)
2
Schuhwerk
12
Kleidung
0
(sie ziehen alte Sachen an, die Leute ihnen geben)
Arzt
0
Apotheke
0
(Wohltätige Schwestern bringen ihnen auf Anweisungen von Ärzten Medikamente)
––––––––
––––––––
104
Fr.
Bei derartigen Ausgaben blieben einem armen Haushalt noch 196 Franc im Jahr, um alle anderen Bedürfnisse zu decken. Und davon mussten allein 150 Franc für Brot aufgewendet werden, sodass noch 46 Franc (im Jahr!) für den Kauf von Salz, Butter, Kohl und Kartoffeln blieben. »Wenn man bedenkt, dass ein gewisser Betrag auch in der Kneipe ausgegeben wird, wird deutlich, dass das Dasein dieser Familien trotz der Brotlaibe, die von Zeit zu Zeit von wohltätigen Organisationen verteilt werden, furchtbar ist.«[9]
Nirgendwo sprachen die Zahlen zu den Männern, Frauen und Kindern der Stadt eine deutlichere Sprache als bei den Sterblichkeitsraten der verschiedenen Viertel. Am Quai Duguay-Trouin, einer vornehmen Straße mit großen Häusern, stellten Guépin und Bonamy eine Sterblichkeitsrate von einem Toten auf 78 Anwohner jährlich fest. Doch an der Rue des Fumiers, dem Epizentrum der Armut in der Stadt und im selben Viertel in der Nähe der Chaussée Madeleine gelegen, dokumentierten sie einen Toten auf 17 Anwohner im Jahr. Um die Diskrepanz noch drastischer auszudrücken: Die Autoren errechneten, dass das Durchschnittsalter der Toten an der Rue des Fumiers bei 31,16 Jahren lag, während die Anwohner der Rue Duequesclin im Durchschnitt mit 59,2 Jahren starben.
In den 1830er und 1840er Jahren schwappte eine Welle solcher Berichte durch ganz Europa. Die Autoren hatten die Fabriken aufgesucht und die Behausungen der ärmsten Stadtbewohner betreten. Ihre Bücher und Pamphlete zeichneten sich durch präzise Beobachtung und Quantifizierung aus. Im Jahr 1832 hatte James Kay, ein Medizinabsolvent der University of Edinburgh, eine kurze Studie über die Baumwollarbeiter in Manchester veröffentlicht. Auch hier wurden die Sterblichkeitsraten unter Webern diskutiert, und die Studie enthielt Tabellen, die die Verteilung feuchtkalter Unterkünfte, ungepflasterter Straßen und offener Kloaken in den ärmsten Stadtbezirken aufzeigten. Ferner gab es Überlegungen zur Tristheit und dem Elend des täglichen Lebens für beschäftigte Arme. Das Leben sei hart für die Baumwollarbeiter, schrieb Kay, und für die hauptsächlich irischen Weber an einem Handwebstuhl seien die Bedingungen besonders schlimm, weil die Einführung des mechanischen Webstuhls den Wert ihrer Arbeit gemindert habe. In ihren Behausungen fanden sich allenfalls ein oder zwei Stühle und ein wackliger Tisch, eine rudimentäre Kochausrüstung und »ein oder zwei Betten, abstoßend vor Dreck«. Unter Umständen schlief eine ganze Familie in einem einzigen Bett, zusammengekauert unter einem Stapel schmutzigen Strohs und einer Decke aus alten Säcken. Es gab feuchte, übel riechende Kellerräume, in denen bis zu 16 Personen aus mehr als einer Familie zusammengepfercht waren.[10]
Louis-René VillermésTableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie (1840) war wiederum das Ergebnis jahrelanger Studien unter den Baumwollarbeitern der Regionen Haut-Rhin, Seine-Inférieure, Aisne, Nord, Somme, Rhône und des Kantons Zürich in der Schweiz. Villermé, ein bahnbrechender Fürsprecher einer Reform der Hygienemaßnahmen und früher Vertreter einer sozialen Epidemiologie, interessierte sich für die Auswirkung der Industrialisierung auf die Gesundheit und Lebensqualität der arbeitenden Klassen. Das von der Académie des sciences morales et politiques in Paris in Auftrag gegebene Buch war ein Werk mühsamer Klassifizierung, gestützt auf die akribische Analyse der Daten, die er über genaue Beobachtung gewonnen hatte. Villermé interessierte sich für die Länge des Arbeitstags, die Zeit, die mit der Einnahme der Mahlzeiten verbracht wurde, die Entfernung zum Arbeitsplatz, die Art und Höhe der Entlohnung. Villermé hatte die Orte aufgesucht und die Menschen, die er beschrieb, beobachtet. Geduldig war er seinen Probanden durch ihren langen Arbeitstag gefolgt und war sich dabei der, wie er selbst schrieb, »strikten Pflicht« bewusst, »die Fakten genauso zu schildern, wie ich sie gesehen habe«.[11] Während er elsässische Baumwollarbeiter beobachtete, wie sie sich morgens ihrer Fabrik näherten und abends wieder gingen, bemerkte er »eine Vielzahl blasser, magerer Frauen, die barfuß durch den Schlamm gingen«. Neben ihnen lief eine Schar »junger Kinder, ebenso schmutzig, ebenso ausgezehrt und mit Lumpen bedeckt, die von dem Öl ganz fettig waren, das bei der Arbeit von den Maschinen auf sie getropft war«. Diese Kinder hatten keine Taschen, um ihren Proviant zu tragen: »Sie hielten das Stück Brot, das sie nähren musste, bis es für sie an der Zeit war, nach Hause zurückzukehren, einfach in der Hand oder verbargen es unter ihren Hemden.«[12]
Wie Guépin und Bonamy hatte auch Villermé die Unterkünfte der Arbeiter betreten: dunkle Zimmer, in denen zwei Familien schliefen, jeweils in eine Ecke gekauert, auf Stroh, das auf dem Fußboden ausgestreut war und von zwei Brettern zusammengehalten wurde, zugedeckt nur von Lumpen und einer dreckigen Steppdecke. Er sah und beschrieb ebenfalls die karge Kochausrüstung und die Möbelstücke. Zudem notierte er die exorbitanten Mieten, die für so unzureichende Wohnungen verlangt wurden – Mieten, die Spekulanten dazu verleiteten, immer mehr solcher Mietshäuser zu bauen, in dem Wissen, dass sie schon bald mit Bewohnern gefüllt würden. Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung entging auch Villermé nicht. Im Département Haut-Rhin, wo Frankreich an die Schweiz grenzt, war die Armut so groß, dass sie sich drastisch auf die Länge eines Menschenlebens auswirke: Während man in den Familien von Kaufleuten, Geschäftsleuten und Fabrikdirektoren erwarten konnte, dass die Hälfte der Kinder das Alter von 29 Jahren erreiche, starb die Hälfte der Kinder von Webern und Baumwollspinnern, bevor sie zwei wurden. »Was sagt uns das«, fragte Villermé und verknüpfte sein Mitgefühl mit einem tadelnden Aspekt, »über den Mangel an Fürsorge, die Vernachlässigung seitens der Eltern, über deren Entbehrungen, über deren Leid?«[13]
Graf Carlo Ilarione Petitti di Roreto, der Autor einer Studie über die Auswirkung von Fabrikarbeit auf Kinder, war ein hoher Beamter im Dienst des Königreichs Piemont-Sardinien und zählte zu den angesehensten piemontesischen Liberalen seiner Ära. Petitti machte von Anfang an deutlich, dass er den Wert und die Notwendigkeit von Kinderarbeit in Fabriken anerkannte. Kinder waren klein und flink: Man konnte sie für das Zusammenbinden, Aufspulen oder Haspeln zerrissener oder missratener Fäden einsetzen; sie konnten unter Maschinen kriechen, um während des Betriebs nachzujustieren, ohne dass der Rhythmus der Produktion unterbrochen wurde (deshalb die Ölflecken, die Villermé auf den Kleidern der Kinder bemerkte, die aus Baumwollfabriken im Elsass kamen); sie waren für etliche Aufgaben hervorragend geeignet, bei denen man kleine Finger und schnelle Reflexe brauchte. Sie waren billiger als Erwachsene und somit wichtig, um die Kosten möglichst niedrig zu halten. Und sie stockten das Familieneinkommen der ärmsten arbeitenden Eltern auf.
Der Einsatz von Kindern für solche Tätigkeiten hatte stetig zugenommen. Inzwischen begannen Kinder schon mit sieben oder acht Jahren zu arbeiten, und ihre Zahl hatte einen Punkt erreicht, wo sie sage und schreibe die Hälfte der in solchen Betrieben beschäftigten Arbeiter ausmachten. Petitti wies darauf hin, dass der Fabrikbesitzer ein nachvollziehbares Interesse habe, die Produktion zu maximieren und die Kosten zu minimieren. Folglich forderte er die größtmögliche Anstrengung, selbst von seinen jüngsten Beschäftigten. Verarmte Eltern hatten ihrerseits ein Interesse daran, die Bürde des Unterhalts ihrer Sprösslinge zu mindern, und neigten somit dazu, ihre Kinder so früh wie möglich arbeiten zu lassen. Alle beteiligten Gruppen (außer den Kindern selbst), so schien es, hatten ein Interesse an diesem System der Ausbeutung, und das Ganze hatte bedauernswerte Folgen. Von der endlosen Plackerei erschöpft und ohne ausreichenden Schlaf dämmerten diese kleinen Proletarier häufig ein und träumten von »Laufen und Springen«, bis eine strenge Stimme sie wieder an ihre Aufgaben ermahnte. Wenn sie sich weigerten, wurden sie geschlagen, oder es wurde ihnen das Essen weggenommen.[14]
Je jünger die Kinder waren, wenn sie zu arbeiten anfingen, desto größer war die Gefahr, dass bestimmte Tätigkeiten charakteristische Krankheiten und Missbildungen im Erwachsenenalter hervorriefen. Bei der Beobachtung der Weber Lyons, eines der großen europäischen Zentren für Seide, fielen Philibert Patissier Anzeichen einer allgemeinen Debilität der Arbeiter auf, die allem Anschein nach mit der Art ihrer Tätigkeit zusammenhing und sich nicht nur in ihrem Äußeren und dem Grad der Lebensfreude, sondern auch in Stimmung und Haltung manifestierte. Neben der blassen Hautfarbe wiesen Weber Gliedmaßen auf, die »schwaches oder mit lymphatischer Flüssigkeit aufgeblähtes, weiches Fleisch hatten, dem es an Kraft mangelte, [und] kleiner als die durchschnittliche Statur« waren. »In ihrem Gesichtsausdruck war ein gewisser Zug der Einfältigkeit und Dummheit; ihr Akzent bei der Unterhaltung ist einzigartig langsam und flach«. Ihre Körper waren durch fehlerhafte und schlechte Haltung so verformt, dass man sie schon aus der Ferne »aufgrund der irregulären Entwicklung des Skeletts [und] an ihrem unsicheren und absolut unschönen Gang« erkannte.[15]
Die Fabrik habe einen so starken Einfluss auf die Verfassung der Menschen, die dort arbeiteten, schrieb Patissier, dass junge Leute, die aus dem Land um Lyon kommen, um diesen Beruf zu ergreifen, schon bald ihre Frische und Rundlichkeit verlören: »Variköse Verstopfung der Beine und mehrere Erkrankungen skrofulöser Art deuten schon bald die Veränderung an, die in ihnen stattgefunden hat.«[16] Hinzu kamen die abstoßenden Lebensbedingungen in den ärmsten Vierteln Lyons, wo sich in dunklen und übel riechenden Straßen schlecht gebaute und stickige Häuser aneinanderreihten, bis zum Überlaufen gefüllt mit »einer großen Zahl an Personen beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen«. Die Beziehungen unter Arbeitern, die auf diese Art hausten, seien so intim, dass unter ihnen unweigerlich ein »Libertinismus« Einzug halte, »lange bevor ihre Organe dafür die nötige Stärke und den Entwicklungsgrad erlangten. Der Brauch der Masturbation beginnt unter diesen Handwerkern so früh, dass man kaum das Alter bestimmen kann, in dem sie damit angefangen haben.«[17]
Im Jahr 1843, als Bettina von Arnim eine Aufsatzsammlung unter dem Titel Dies Buch gehört dem König veröffentlichte, in dem sie den preußischen Staat kritisierte, weil er die Massen seiner ärmsten Untertanen vernachlässige, fügte sie dieser noch einen Bericht über die Elendsviertel von Berlin bei, den sie bei Heinrich Grunholzer, einem 23-jährigen Schweizer Studenten, in Auftrag gegeben hatte. Diese Entscheidung war für diese gebildete Schriftstellerin, Romanautorin und Komponistin ungewöhnlich. Während die Sozialkritik im Rest des Textes in pikaresken, mäandernden Dialogen mit einer rätselhaften weiblichen Protagonistin versteckt war, entschloss sich Arnim, die Notizen Grunholzers nicht in einen eigenen Text umzuformen, sondern sie unverändert zu veröffentlichen, als wolle sie »das Primat der sozialen Wirklichkeit über den Prozess der literarischen Verarbeitung« bekräftigen.[18] Seit dem Ende der Napoleonischen Kriege war die Bevölkerung der preußischen Hauptstadt von 197 000 auf knapp 400 000 Einwohner angewachsen. Viele der ärmsten Zuwanderer – größtenteils Lohnarbeiter und Handwerker – ließen sich in einem dicht besiedelten Armenviertel am nördlichen Rand der Stadt nieder. Und hier machte Grunholzer auch seine Beobachtungen für Arnims Buch. Vier Wochen lang zog er durch Mietskasernen und befragte deren Bewohner. Er dokumentierte seine Eindrücke in einer knappen Prosa, die in kurze, formlose Sätze gefasst war, und fügte die brutalen statistischen Angaben ein, die das Leben der ärmsten Familien in der Stadt prägten. Dialogpassagen waren in die Erzählung eingeflochten, und die häufige Verwendung des Präsens ließ auf Notizen schließen, die an Ort und Stelle geschrieben wurden.[19]
Friedrich Engels’ Studie zur Lage der arbeitenden Klasse in England, die 1845 veröffentlicht wurde, war nicht zuletzt ein Werk sozialer und kultureller Beobachtung – schon der Anfang des Untertitels »Nach eigner Anschauung« macht das deutlich. Auch Engels zählte akribisch Objekte und Phänomene auf und klassifizierte sie; und er sah und beschrieb viele Dinge, die Kay, Villermé, Grunholzer, Pettiti, Patissier, Guépin und Bonamy schon vor ihm beobachtet hatten. Auch ihm fiel die räumliche Nähe der ärmsten und reichsten Stadtbezirke auf. In St. Giles, London, nicht weit von der Regent Street und dem Trafalgar Square, traf er ein »Straßenknäul« voller drei- und vierstöckiger Mietshäuser an – innen ebenso schmutzig wie außen. Das war jedoch gar nichts im Vergleich zu den Behausungen in den Höfen und Gassen zwischen den Straßen, einem Wirrwarr aus verkommenen Müllhaufen, unverglasten Fenstern und zerbrochenen Türrahmen, wo sich die Ärmsten der Armen in Schmutz und feuchtkalter Dunkelheit aneinanderkauerten. Und Engels war, wie Villermé und viele andere, verblüfft über die Tatsache, dass selbst für diese Bruchbuden exorbitante Mieten gezahlt wurden. Er staunte, wie »die Armut dieser Unglücklichen, bei denen selbst Diebe nichts mehr zu finden hoffen, von den besitzenden Klassen auf gesetzlichem Wege ausgebeutet« wurde.[20]
Bei allen Unterschieden wiesen diese Werke eine gewisse Ähnlichkeit auf. Sie richteten für begrenzte Zeit einen Blick auf ihren Gegenstand, der durch Zahlen, Tabellen und präzise Beschreibungen bestach. Neue Trends in der statistisch belegten Argumentation erleichterten es, zwischen den Abstraktionen »großer Zahlen« und den Durchschnitten auf der einen Seite und dem Verhalten der Einzelpersonen auf der anderen zu vermitteln. Ebendieses Verhalten konnte nunmehr als emblematisch für breitere soziale Phänomene gelten. Den dominierenden Einfluss bei dieser statistischen Wende hatte der belgische Astronom, Statistiker und Soziologe Adolphe Quetelet, gewissermaßen das »Einmann-Orchester der Statistik des 19. Jahrhunderts«, dessen grundlegender Aufsatz über »Sozialphysik« (1835) argumentierte, dass lediglich die Untersuchung großer Datenmengen die gesetzmäßigen Kräfte des menschlichen Sozialverhaltens erhellen könne. Die Messung der Korrelationen, die auf umfangreichen Daten basierten, gestattete die Aufdeckung provokativer Kausalzusammenhänge etwa bezüglich der Wirkung des Einkommens auf die Sterblichkeit. Sobald dieser Paradigmenwechsel in der sozialen Erkenntnis vollzogen war, gab es kein Zurück. Guépins beißender Kommentar: »Es hat den Anschein, je weniger Steuer man zahlt, desto früher stirbt man«, trug den Stempel dieses neuen statistischen Bewusstseins.[21]
Die Beschreibung sozialer Verhältnisse hatte auch eine literarische Dimension. Die Schriftsteller der sozialen Frage schienen eine noch unentdeckte Welt aufzuzeichnen, eine Welt, die, wie der deutsche Radikale Friedrich Wilhelm Wolff es in einem viel gelesenen Artikel über die Elendsviertel Breslaus ausdrückte, »jedem täglich, ja stündlich« vor den Mauern der Stadt »zur Einsicht offen« stehe, die aber die meisten der wohlhabenderen Bewohner nicht sehen wollten.[22] Es handelte sich um eine nicht transzendente Welt, in der physische Nähe eine wichtige Rolle spielte: die groteske Nachbarschaft der reichsten und ärmsten Bezirke, die wuselnden schmutzigen Kinder in Lumpen und die promiskuitive Intimität Erwachsener in ungewaschenen Betten, die Haufen der Arbeiter vor den Fabriktoren, die gefährliche Nähe der Kranken zu den Gesunden. Das Auge des Lesers wurde unablässig durch den Raum gelenkt, von einem Gegenstand zum nächsten: ein zerschlagenes Fenster, ein Tisch mit zwei Beinen, eine gebrochene Schüssel, Lumpen, ein dreckiges notdürftiges Bett. Aber auch die anderen Sinne kamen nicht zu kurz: die Schwüle feuchter Wände, die Schreie unruhiger Säuglinge, der Gestank von Unrat.[23]
Zweifellos bedienten die Texte auch ein gewisses voyeuristisches Vergnügen der bürgerlichen Leser. Dieses Genre war so verführerisch, dass es die Grenzen zwischen Traktaten von Experten und offiziellen Berichten überwand und auch in die Fiktion Einzug hielt. Das bekannteste Beispiel – selbst wiederum ein bedeutender Einfluss auf die aufkeimende Praxis sozialer Beschreibung – war Eugène Sues bemerkenswert gut verkaufter zehnbändiger Roman über die Pariser Unterwelt, Les Mystères de Paris, der 1842/43 in Fortsetzungen erschien und in ganz Europa unzählige Nachahmer fand. Die Figuren, die Sues Werk bevölkern, sind überlebensgroße Absurditäten, doch die Welt, in der sie sich bewegen, ist ebenjenes Straßenlabyrinth, das im Unrat ertrinkt, dem wir in der Literatur der Industrialisierung und städtischer Armut begegnen:
Die schmutziggrauen Häuser hatten nur wenige Fenster mit wurmzerfressenen Rahmen und zerschlagenen Scheiben. Schwarze, stinkende Eingänge führten zu noch dunkleren, schmutzigen, oft steil aufsteigenden Treppen, die man nur mühsam mit Hilfe eines Seiles ersteigen konnte, das an eisernen Haken an den feuchten Mauern befestigt war.[24]
Sues Werk fand zahlreiche Nachahmer in ganz Europa.[25] Wenn die Leser bereit seien, sich in Sues farbenfroher Halbwelt zu verlieren, meinte Wilhelm Wolff, dann müssten sie sich desto stärker für die realen »Mystères de Breslau« vor der eigenen Haustür interessieren. August Brass, der Autor der Mysterien von Berlin (1844), stellte missbilligend fest, dass Sues deutsche Übersetzer aus den »Mystères« des Originaltitels »Geheimnisse« gemacht hatten. Das sei jedoch ein Fehler, protestierte er, weil es beim Leben der Armen keineswegs um Geheimnisse gehe; es handle von den Mysterien, »die täglich unter unseren Augen geschehen«. Jeder könne die Not und Verzweiflung der Unterwelt in der preußischen Hauptstadt beobachten, schrieb Brass, wenn man sich nur die Mühe mache, »die bequeme Hülle selbstsüchtiger Behaglichkeit abzuwerfen und einen Blick über die gewohnte Schranke unsers täglichen Wirkungskreises hinaus zu thun auf das Leben unserer Mitbrüder«.[26] Eugène Buret, der Autor der umfangreichen Studie De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France (1840), formulierte es prägnant:
Armut