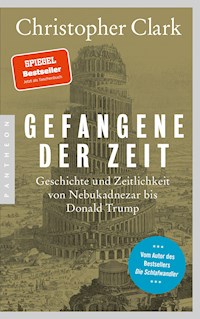
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Christopher Clark über Zeit und Macht von der Antike bis heute
Was hat der Brexit mit Bismarck zu tun? Was verbindet die antike Alexanderschlacht bei Issus mit der Schlacht gegen Napoleon bei Jena 1806? Was lehren uns Psychogramme aus dem Dritten Reich über Gehorsam und Courage? Und wie lässt sich Weltgeschichte schreiben, ohne dabei dem Eurozentrismus verhaftet zu bleiben? Christopher Clark, der mit seinen Büchern über Preußen und den Beginn des Ersten Weltkriegs Millionen Leser begeistert hat, beweist mit seinem neuen Band, wie vielfältig seine Interessen als Historiker sind. In insgesamt 13 ebenso klugen wie elegant geschriebenen Essays zeigt er, wie sehr historische Ereignisse und Taten, Vorstellungen von Macht und Herrschaft über die Zeiten hinweg fortwirken – bis heute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christopher Clark
GEFANGENE DER ZEIT
Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump
Aus dem Englischen von
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotive: Bridgeman Images (Der Turmbau zu Babel, nach der Beschreibung des Athanasius Kircher, Kupferstich 17. Jahrhundert) Vorne: © Bridgeman Images (Der Turmbau zu Babel, nach der Beschreibung des Athanasius Kircher, Kupferstich 17. Jahrhundert); Fotografie von Johannes Mühler, um 1913)
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-23164-4V003
www.dva.de
Über das Buch
Was hat der Brexit mit Bismarck zu tun? Was verbindet die antike Alexanderschlacht bei Issus mit der Schlacht gegen Napoleon bei Jena 1806? Was lehren uns Psychogramme aus dem Dritten Reich über Gehorsam und Courage? Und wie lässt sich Weltgeschichte schreiben, ohne dabei dem Eurozentrismus verhaftet zu bleiben? Christopher Clark, der mit seinen Büchern über Preußen und den Beginn des Ersten Weltkriegs Millionen Leser begeistert hat, beweist mit seinem neuen Band, wie vielfältig seine Interessen als Historiker sind. In insgesamt 13 ebenso klugen wie elegant geschriebenen Essays, die hier erstmals auf Deutsch vorliegen, zeigt er, wie sehr historische Ereignisse und Taten, Vorstellungen von Macht und Herrschaft über die Zeiten hinweg fortwirken – bis heute.
Über den Autor
Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biographie Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers. Für sein Buch »Preußen« erhielt er 2007 den renommierten Wolfson History Prize sowie 2010 als erster nicht-deutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. Sein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg, »Die Schlafwandler« (2013), führte wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestseller-Liste an und war ein internationaler Bucherfolg. Zuletzt erschien von ihm der vielbeachtete Bestseller »Von Zeit und Macht« (2018).
Inhalt
Vorwort: Wie aus Gegenwart Geschichte wird
Der Traum des Nebukadnezar oder Gedanken über die Macht
Die Juden und das Ende aller Tage
Welche Bedeutung hat eine Schlacht?
Von Bismarck lernen?
Liebesgrüße aus Preußen. Fanatismus, Liberalismus und Öffentlichkeit im Königsberg der 1830er Jahre
Der Kaiser und sein Biograph
Leben und Tod des Generalobersten Blaskowitz
Psychogramme aus dem Dritten Reich
Die Zukunft des Krieges
Hoch in heiterer Luft
Nachruf auf einen Freund
Von Nationalisten, Revisionisten und Schlafwandlern
Unsichere Zeiten
Anmerkungen
Register
VORWORT
WIE AUS GEGENWART GESCHICHTE WIRD
Im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts wurden die Monate, als das Gelbfieber in der Stadt grassierte, tiempo muerto, die tote Zeit, genannt. Wer es sich leisten konnte, verließ die Stadt. Die Toten waren allgegenwärtig: in Parks, auf Karren oder im Mississippi treibend. Die Krankheit, die COVID-19 genannt wird, ist längst nicht so tödlich wie das Gelbfieber, das in einem schlechten Jahr bis zu einem Zehntel der Bevölkerung dahinraffen kann. Im Jahr 2020 stapelten sich die Leichen in kleinerer Zahl und stachen nicht so ins Auge, wenn man nicht gerade im Krankenhaus, in der Leichenhalle oder im Krematorium arbeitete.
Doch die Wendung tiempo muerto betrifft auch einen Aspekt der Pandemie von 2020. Die große Entschleunigung aller Abläufe fühlte sich wie eine Umkehr der inneren Logik der Moderne an. Flüge, Vorträge, Konferenzen, Zeremonien und Versammlungen wurden abgesagt. Die Zeit floss nicht mehr so schnell wie das Wasser in einem Gebirgsbach. Sie konzentrierte sich um jede einzelne Aufgabe. Die Zukunft wurde verschwommen. Für einen erfahrenen Professor, der das Haus nicht verlassen durfte, war es die ideale Zeit, ein Buch zu schreiben oder einen Essayband zusammenzustellen. Für junge Leute im akademischen Bereich hingegen gab es keine Abschlussexamina, keine Verleihung von Titeln und keine Feiern mit Freunden und Verwandten. Die Wendepunkte, auf die sie hingearbeitet hatten, die Riten, die den Übergang von einer Lebensphase in die nächste markierten, waren verschwunden. Für sie war es, als wäre die Zukunft abgeschaltet worden.
Um meine eigenen Gedanken zu ordnen und um der Welt draußen zu signalisieren, dass Historiker auch dann denken, wenn die Welt ringsherum den Betrieb einstellt, begann ich eine Reihe von Podcast-Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen. Wir wollten herausfinden, inwiefern das Nachdenken über die Vergangenheit uns helfen kann, unsere derzeitigen Zwangslagen zu verarbeiten. Aus diesen Diskussionen gingen ebenso vielsagende wie widersprüchliche Erkenntnisse hervor.
Das nackte Entsetzen der früheren Begegnungen mit epidemischen Krankheiten war ein interessantes Thema. Im frühneuzeitlichen Venedig und Florenz wurde, wie meine Kollegen berichteten, die Angst an sich bereits als Gefahr angesehen, weil man glaubte, sie erhöhe die Ansteckungsgefahr. Die Gesundheitsbehörden versuchten, ihr entgegenzutreten, indem sie ruhig und einfühlsam mit der Bevölkerung umgingen. Doch das umgekehrte Problem stellte sich ebenfalls ein: Als Gesundheitsinspektoren eine Schar junger Florentiner auf dem Höhepunkt der Pestepidemie im 16. Jahrhundert bei einer fröhlichen Party antrafen, gingen sie auf einen nahen Friedhof und holten den Leichnam einer kürzlich verstorbenen jungen Frau. Sie warfen die Leiche mitten unter die Feiernden und riefen: »Sie will auch tanzen!«
Es sei ein auffälliges Merkmal der COVID-19-Pandemie, beobachteten meine Kollegen und Kolleginnen, dass unsere Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und zu kommunizieren, zwar unvergleichlich größer sei als bei unseren Vorgängern, doch unsere Fähigkeit, die Krankheit wirklich zu bekämpfen und zu behandeln, sei (zumindest bis zur Entwicklung eines zuverlässigen Impfstoffs) längst nicht so weit entwickelt, mit der Folge, dass wir tendenziell auf Methoden zurückgriffen, die bereits mittelalterliche und frühneuzeitliche Städte anwandten: Quarantäne, »Lockdown«, Abstand, Masken und die Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Geschäften, Märkten und Kirchen. Damals wie heute mussten die politischen Behörden die Gefahr für das Leben abwägen gegen die Gefahr für Einkommen und ökonomische Vitalität. In Handelsstädten wie New Orleans, Istanbul, Bombay (heute: Mumbai) und Hamburg war das ein schwieriger Balanceakt.
Die Maßnahmen, die die Herrschaftsgewalt anordnet, um die Gefahr einer ansteckenden Krankheit einzudämmen, beträfen stets den Kern des Gesellschaftsvertrags zwischen den Herrschern und den Beherrschten, sagte ein Kollege zu mir. Wo die Gefahr offensichtlich und die Maßnahmen vernünftig und transparent waren, war die soziale Anpassung an die Schritte zur Eindämmung der Pandemie tendenziell hoch. Wo die Bevölkerung hingegen kein Vertrauen zu den Behörden hatte, konnten Bemühungen, die Ansteckung durch Verordnungen zu unterdrücken, die die Bewegungsfreiheit und wirtschaftliche Aktivität einschränkten, Proteste und Krawalle auslösen – wie heute in den Vereinigten Staaten oder im von der Pest geplagten Bombay des späten 19. Jahrhunderts. Damals lösten die von den Briten durchgesetzten Maßnahmen einen Aufstand aus, der in der Ermordung des Pest-Kommissars der Stadt und seines Assistenten kulminierte. »Die Pest hat mehr Erbarmen mit uns«, schrieb der indische Nationalist Bal Gangadhar Tilak, »als ihre menschlichen Vorbilder, die derzeit die Stadt regieren.«
Die Gewohnheit, Seuchen eine moralische Bedeutung zuzuschreiben, ist ebenso alt wie die schriftliche Dokumentation ihrer Auswirkungen. Im Alten Testament werden Seuchen häufig als etwas von Gott Gewolltes präsentiert. »Denn ich hätte schon meine Hand ausrecken und dich und dein Volk mit Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt würdest«, sagt der Herr im Buch Exodus (9,15) zu Mose, damit dieser den Pharao entsprechend warnt. Daraus folgte, dass Epidemien Zeichen des göttlichen Grolls waren, die wiederum Taten der Versöhnung von Seiten der Menschheit erforderten. Die Städte des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europas hätten, teilten mir zwei Kolleginnen mit, ihre Gesundheitsmaßnahmen häufig mit Verordnungen flankiert, die Prostitution, Glücksspiel, Kartenspiel und allgemein frivoles Benehmen untersagten – mit der Begründung, diese würden eine ohnehin bereits gereizte Gottheit noch weiter provozieren. Diese Gewohnheit hat sich in manchen Kreisen bis heute gehalten: Man denke nur an den Geschäftsmann und Tycoon für Bettzubehör Mike Lindell, den CEO von MyPillow® Inc., der bei einer Pressekonferenz des Weißen Hauses an der Seite von Donald Trump erschien und in einem abwegigen Monolog erklärte, die derzeitige COVID-19-Pandemie sei Gottes Methode, ein Amerika zu strafen, das »sich von Gott abgewandt« habe. Die Amerikaner sollten sich wieder darauf besinnen, mit ihren Familien »das Buch« zu lesen.
Dabei hat es natürlich stets auch eine alternative Sichtweise gegeben. In seiner Schilderung der Pestepidemie im alten Athen kommentierte der Historiker Thukydides schelmisch, dass die Frommen und die weniger Frommen in gleicher Zahl an der Seuche starben. Im Buch Hiob ist die Seuche, erinnerte mich ein Kollege, keine Strafe, sondern die Folge einer finsteren Wette zwischen Gott und dem Satan. Da der Teufel auf Hiobs Loyalität zu Gott eifersüchtig ist, verführt er den Allmächtigen dazu, ihm die Erlaubnis zu geben, den frommen Mann auf die Probe zu stellen. Prompt schickt der Teufel zuerst Hiobs Vieh Seuchen und Tod, dann dessen Frau und Kindern und zu guter Letzt Hiob selbst. Der gute Mann erduldet all diese Schrecken in einem Zustand tiefster Verwunderung, weil er nicht begreifen kann, warum er so arg gequält wird. Das Bedürfnis nach einer moralischen Einsicht ist immer noch stark. Selbst im relativ säkularisierten Umfeld des heutigen Westens gibt es den Drang, die Sinnlosigkeit des Leidens und Todes zu lindern, indem man hoffnungsvoll darüber spekuliert, dass uns die Pandemie womöglich achtsamer für das ökologische Gleichgewicht unserer Welt und sensibler für die Bande der Solidarität und Interdependenz machen werde, die uns mit unseren Mitbürgern verbinden.
Man glaubt gerne, dass sich ansteckende Krankheiten gleichmäßig unter der menschlichen Bevölkerung ausbreiten wie Billardkugeln, die über einen Tisch rollen. Doch in Wirklichkeit ist ihr Verlauf extrem ungleichmäßig, weil er so gut wie immer von Strukturen sozialer Ungleichheit beeinflusst wird. In den Städten des frühneuzeitlichen Europas und des Osmanischen Reiches konnten die Reichen aus überfüllten Städten auf Landsitze flüchten, wo eine Ansteckung weniger wahrscheinlich war. In den Pestjahren des frühneuzeitlichen Cambridge wurden die höchsten Sterbequoten aus den Vororten zwischen Jesus College und Barnwell gemeldet, wo College-Bedienstete und arme Arbeiter lebten. In New Orleans starben tendenziell neue Einwanderer, vor allem Iren und Deutsche, in großer Zahl am Gelbfieber, weil sie in billigen Zimmern in überfüllten Mietshäusern lebten, wo eine hohe Ansteckungsgefahr bestand. Im kolonialen Amerika grassierten Seuchen am schnellsten unter Bevölkerungsgruppen, die durch Unterernährung bereits geschwächt waren. Im 18. Jahrhundert wiesen indigene Amerikaner eine erhöhte Anfälligkeit für Pocken auf, wie eine Kollegin mir sagte, weil sich ihre Ernährung durch die Zwangsumsiedlung verschlechtert hatte.
Heute gibt es in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern Anzeichen für große Unterschiede bei den Todeszahlen, die mit dem Einkommen und dem Niveau der Gesundheitsversorgung korrelieren. Selbst in den wohlhabendsten Teilen der Welt hat die Pandemie das soziale Bewusstsein geschärft. Pflegekräfte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Sanitäter und die Fahrer der Lieferdienste rückten in den Fokus – Mitbürger, deren Tätigkeit in der Regel nicht gerade üppig entlohnt wird, deren Bedeutung uns aber schlagartig vor Augen geführt wurde. Menschen lernten ihre Nachbarn kennen, brachten Männern und Frauen aus Risikogruppen, die in ihren Wohnungen eingesperrt waren, Lebensmittel, Einkäufe und Medikamente. Viele Briten kamen aus ihren Häusern, um den Gesundheitsarbeitern zu applaudieren (zumindest bis die Regierung sie ausdrücklich dazu aufforderte, wonach die Begeisterung schlagartig abnahm). Auch hier gibt es Parallelen zur Vergangenheit. Selbst bei Ausbrüchen der Beulenpest, einer erbarmungslosen und schrecklichen Seuche mit einer weit höheren Sterblichkeitsrate als COVID-19, bewiesen mittelalterliche englische Gemeinden ein außerordentlich hohes Maß an gesellschaftlicher Solidarität. In Venedig und Florenz ergriffen die Behörden vielfältige Maßnahmen: die Zahlung von Urlaubsgeld, kostenlose Lebensmittellieferungen (samt einem Liter Wein täglich), Steuer- und Mietstopps sowie Bemühungen, den Leuten wieder Arbeitsstellen zu vermitteln, sobald die Seuche vorüber war. Die Pockenepidemie im kolonialen Amerika brachte enorme pflegerische Heldentaten mit sich, in erster Linie von Frauen, die häufig die Kinder toter Nachbarn, Freunde und Verwandter aufnahmen und großzogen. Statt die Bande der Solidarität zu zerstören und für Anarchie zu sorgen, verstärkte die Begegnung mit epidemischen Krankheiten den sozialen Zusammenhalt und bestätigte moralische Standards.
Während des Lockdowns las ich zufällig Heinrich Heines Französische Zustände, eine Reihe von Artikeln, die er während seines Aufenthalts in Paris 1832 geschrieben hat. Mitten in einem Beitrag vom April 1832 entdeckte ich die folgende Klammer, die einige Jahre später eingeschoben wurde:
Ich wurde in dieser Arbeit [dem Schreiben] viel gestört, zumeist durch das grauenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera starb. Überhaupt muss ich bemerken, dass die damaligen Umstände auch auf die folgenden Blätter misslich eingewirkt; ich bin mir zwar nicht bewusst, die mindeste Unruhe empfunden zu haben, aber es ist doch sehr störsam [sic], wenn einem beständig das Sichelwetzen des Todes allzu vernehmbar ans Ohr klingt.
Heine hatte gesehen, wie Menschen den verstümmelten Leichnam eines Mannes durch die Straßen zerrten, den ein Mob gelyncht hatte, weil man eine Substanz aus weißem Pulver bei ihm gefunden hatte. Man hatte es für einen die Cholera verbreitenden Giftstoff gehalten (in Wirklichkeit entpuppte sich das Pulver als Kampfer, von dem manche meinten, es schütze vor der Krankheit). Er hatte gesehen, wie weiße Säcke voller Leichen im weitläufigen Saal eines öffentlichen Gebäudes aufgestapelt wurden, und die »Leichenwächter« beim Zählen der Säcke beobachtet, als sie an die Totengräber übergeben wurden, um sie auf Wagen zu verladen. Er erinnerte sich, wie zwei kleine Jungen mit betrübten Gesichtern neben ihm standen und ihn fragten, in welchem Sack denn ihr Vater stecke. Ein Jahr danach waren das Leid und die Angst vergessen. Im gleichen Saal sah er »das lustige Volk […] die springend munteren Französchen [sic], die niedlichen Plaudertaschen von Französinnen, die dort lachend und schäkernd ihre Einkäufe machten«. Die Choleramonate waren eine »Schreckenszeit« gewesen, weit furchtbarer als jeder politische Terror des Jahres 1793. Die Cholera war »ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine ambulante durch Paris zog«. Nichtsdestotrotz hatte die Seuche allem Anschein nach der frivolen Lebensfreude der Stadt keinen Abbruch getan.
Ich begann über den Stellenwert epidemischer Katastrophen in der Geschichte nachzudenken. Es gibt unzählige hervorragende Studien über die Auswirkungen von Seuchen: Richard Evans’ Standardwerk Tod inHamburg über die Choleraepidemien im 19. Jahrhundert; Laura Spinneys 1918 – Die Welt im Fieber über die Spanische Grippe von 1918/19; und Kathryn Olivarius’ Studie über das Gelbfieber in New Orleans vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg, um nur ein paar zu nennen. Es war jedoch verblüffend, wie wenig Spuren selbst die furchtbarsten Begegnungen mit tödlichen Krankheitserregern in den großen historischen Darstellungen und im öffentlichen Gedächtnis hinterlassen hatten.
Einer meiner Gesprächspartner meinte, er habe sein ganzes Erwachsenenleben über den Einfluss des Krieges auf die amerikanische Regierungsarbeit nachgedacht, aber noch keine einzige Zeile über die Grippeepidemie 1918/19 geschrieben, durch die mehr Amerikaner als im Ersten Weltkrieg umkamen. Wie viele Amerikaner wissen heute noch, dass in den amerikanischen Revolutionskriegen mehr Landsleute an den Pocken starben als durch den bewaffneten Konflikt?
Offenbar ist das ein für die Neuere Geschichte und die Zeitgeschichte typisches Problem: Der Schwarze Tod zählt zu den zentralen Themen mittelalterlicher Studien, und auch Experten für die frühe Neuzeit sind sich der Bedeutung von Seuchen bewusst. Die Eroberung Amerikas durch die Spanier wäre, merkte einer meiner Gesprächspartner an, möglicherweise nicht so verlaufen, wenn die Konquistadoren nicht »unsichtbare Verbündete« in Gestalt von Seuchen gehabt hätten, die auf der Iberischen Halbinsel endemisch, aber in Mexiko und in den Andenregionen unbekannt waren. Deren Bewohner, die aus immunologischer Sicht diesen Erregern hilflos ausgeliefert waren, wurden durch sie so gut wie ausgerottet. Erst in der Neuzeit wurden Seuchen offenbar an den Rand des Sichtfelds und der Sichtbarkeit gedrängt. Eine Kollegin vermutete, dass das mit Genderfragen zu tun haben könnte: Da Frauen bei Seuchenausbrüchen den Löwenanteil an der Pflege geschultert hätten, so argumentierte sie, habe das Thema bei männlichen Historikerkollegen prompt jede Anziehungskraft eingebüßt. Angesichts des Umstands, dass die Grippeepidemie in vielen Schilderungen des US-amerikanischen Beitrags zum Ersten Weltkrieg so gut wie unsichtbar ist, behauptete ein anderer Kollege, eine Historiographie, die auf das Ringen und Schicksal der Nationalstaaten ausgerichtet sei, sei stärker an jenes Leiden und Opfer gewöhnt, das auf den Schlachtfeldern stattfinde, als an jenes, das sich in Krankenhäusern abspiele, wenn die Zahl der Todesopfer steige.
Und womöglich gibt es auch in der Natur einer Epidemie etwas, das sich unseren Bemühungen widersetzt, sie in eine große Darstellung einzubeziehen. Historiker und allgemein Menschen sind geradezu süchtig nach menschlicher Urheberschaft, sie lieben Geschichten, in denen Menschen einen Wandel bewirken oder auf ihn reagieren. Sie denken in langen Kausalketten. Zu einer Epidemie kommt es hingegen, wenn ein nichtmenschlicher Akteur ohne Vorwarnung unter der menschlichen Bevölkerung ausbricht. Ein auf Menschen ausgerichtetes Narrativ, deutete ein Kollege von mir an, werde niemals imstande sein, ein Phänomen wie COVID-19 vernünftig auszuloten, dessen lebenszerstörender Erreger die Grenze zwischen der tierischen und menschlichen Welt überschritt. Eine andere Form der Geschichtsdarstellung sei nötig, eine, die nicht nur Raum für die von Menschen herbeigeführten Störungen lässt, sondern auch für das empfindsame Wirken der Schuppentiere und Zibetkatzen und die nicht empfindungsfähige Energie atmosphärischer Systeme und der physischen Umgebung.
Menschen haben größtenteils Darstellungen von Seuchen bevorzugt, die entweder die himmlische Urheberschaft (als eine Geißel Gottes oder der Götter) oder die menschliche Verursachung hervorhoben. Im 14. Jahrhundert verdächtigte man die Juden, sie würden Brunnen vergiften; im Mailand des 16. Jahrhunderts richtete sich der Verdacht gegen untori, Pest-»Beschmierer«. Das waren Fremde aus anderen italienischen Städten, die angeblich die Kirchenaltäre mit einer pestbringenden Paste bestrichen. Und im Paris des 19. Jahrhunderts fielen Pöbelhaufen über Männer her, die sie für »Giftmischer« hielten. Heute spricht der US-amerikanische Präsident vom »chinesischen Virus« und scherzt unter seinen Gefolgsleuten über »Kung Flu«, während im Internet eine Fülle von Theorien kursiert, wonach COVID-19 von chinesischen, amerikanischen oder russischen Spezialisten in Laboratorien ausgebrütet worden sei. Eine der derzeit beliebtesten Verschwörungstheorien weltweit behauptet, das COVID-19-Virus werde über 5G-Funkmasten verbreitet. Eine seltsame Variante davon, die in Brasilien, Pakistan, Nigeria und Argentinien besonders verbreitet ist, verbreitet die These, Bill Gates habe die derzeitige Pandemie persönlich inszeniert, um zusammen mit dem Impfstoff den Menschen Mikrochips einzupflanzen, damit sie über 5G-Netze »kontrolliert« werden können. Es ist zu hoffen, dass derartige Ausflüge in eine kollektive Idiotie nicht die Akzeptanz eines Impfstoffs behindern, sobald einer verfügbar ist.
Wir haben so viel gelernt und gleichzeitig haben wir so wenig gelernt. Als ich Tag für Tag Präsident Donald Trump vor laufender Kamera sah, wo er wie ein Quacksalber aus dem Wilden Westen der Öffentlichkeit nicht erprobte Therapien empfahl, seinen eigenen Gesundheitsexperten widersprach und versuchte, der schlechten Regierungsarbeit demokratischer Gouverneure und Bürgermeister die Schuld an der Virulenz der Krankheit in die Schuhe zu schieben, musste ich unwillkürlich an Wilhelm II. denken, den letzten und unfähigsten deutschen Kaiser. Die beiden Männer sind sich verblüffend ähnlich. Beide weisen eine ausgeprägte Neigung auf, über alles zu plappern, was ihnen in einem bestimmten Moment gerade durch den Kopf geht. Eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, extreme Reizbarkeit, die Tendenz, unter Belastung logisch inkohärentes Zeug zu faseln, Probleme bei der Aggressionsbewältigung, ein gebieterisches Auftreten, Gefühlskälte und fehlende Empathie, eine ungeheure Prahlsucht, regelrechte Schnapsideen, sarkastische Seitenhiebe und anzügliche Witze sind bzw. waren bei beiden gang und gäbe. Wilhelm II. sagte einmal zu seinen Beratern: »Ihr wisst alle gar nichts. Nur ich weiß etwas, nur ich entscheide«, aber kein Mensch würde sich heute wohl wundern, diese Worte von Donald Trump zu hören. Beide Männer verunglimpften Demonstranten im eigenen Land als Anarchisten und Unruhestifter, und beide forderten nachdrücklich Repressionsmaßnahmen gegen sie. Beide waren bei Konflikten große Freunde von Nullsummen-Szenarien, denen zufolge der Sieg des einen Landes zwangsläufig die Niederlage des anderen bedeuten muss. Genau wie Trump war auch der deutsche Kaiser völlig unfähig, aus den eigenen Fehlern zu lernen.
Wir haben alle den angespannten Gesichtsausdruck der Experten und Mitarbeiter, die rings um den Präsidenten standen, gesehen, während er von dem eigens für ihn vorbereiteten Text in narzisstische Spekulationen abschweifte, die mit der Realität offensichtlich nicht das Geringste zu tun hatten. Im Jahr 1907 fing Rudolf Wilke in einer berühmten Karikatur, die unter der Überschrift »Während einer Kaiserrede« in der Zeitschrift Simplicissimus erschien, exakt das gleiche Phänomen trefflich ein. Eine Gruppe von Generälen lauscht einer Rede, die in drei Phasen verläuft. Während des »schöne[n] Anfang[s]« schauen die Herren ruhig und aufmerksam zu. Dann folgt »Die brenzlige Stelle«, also die spontane Botschaft des Kaisers: Die Generäle streichen sich über den Bart, richten ihre Monokel und blicken peinlich berührt auf die Dekoration. Zu guter Letzt kommt »Der Schluss: Hurra – hurra – hurra!!« Die Rede ist zu Ende, Gott sei Dank!
Allerdings sollte man derartige Beobachtungen nicht übertreiben: Wilhelm II. war viel zu gut erzogen, um mit seinen Erfolgen bei Frauen zu prahlen. Die Vulgarität der öffentlichen Angriffe Trumps auf Frauen hätte ihn schockiert. Er war häufig unbeherrscht und taktlos in seiner Kommunikation mit ausländischen Staatsoberhäuptern, doch während der gesamten Laufbahn Wilhelms II. gab es meines Wissens nichts, was mit den Schimpftiraden zwischen Trump und Kim Jong Un im Jahr 2017 oder mit den Seitenhieben des US-Präsidenten gegen die Regierungschefs Mexikos, Deutschlands, Kanadas und Frankreichs vergleichbar gewesen wäre. Und Wilhelm II. interessierte sich, im Gegensatz zu Trump, für manche Dinge wirklich: etwa die Telegraphie und die griechische Antike. Im Sommer 1916 vertiefte er sich zufällig in die aktuellen Berichte über die philologische Rekonstruktion der hethitischen Sprache.
Bei diesen Überlegungen geht es nicht darum, Wilhelm II. besser dastehen zu lassen, denn dafür taugen sie nicht. Es ist eher so, dass man von dem außergewöhnlichen Schauspiel der Präsidentschaft Trumps sagen könnte, dass es den Referenzrahmen verändert hat. Früher wirkte der Kaiser wie eine einzigartig deutsche Katastrophe. Das gebieterische Auftreten, die hohlen Posen, der grotesk affektierte Gesichtsausdruck bei öffentlichen Anlässen, die Impulsivität, die Selbstbefangenheit – all dies wirkte wie die Symptome einer spezifisch deutschen Malaise. In einer eloquenten Studie über den kaiserlichen Hof schilderte John Röhl den »Byzantinismus« des kaiserlichen Gefolges, die kriecherische, hackenschlagende Verehrung gegenüber der »Allerhöchsten Person«. Alles, was damals in Deutschland schieflief, schien hier wie auf dem Präsentierteller zur Schau gestellt. Trumps Präsidentschaft hat dieses Narrativ natürlich nicht widerlegt, aber sie wirkt wie ein Störsignal auf unsere historische Wahrnehmung. Wohl niemand, der die im Fernsehen übertragene Kabinettssitzung des Weißen Hauses vom Juni 2017 gesehen hat, dürfte jemals vergessen, wie sich die frisch von Trump ernannten Kabinettsmitglieder gegenseitig in Lobpreisungen und Bekundungen der Treue zum Präsidenten überboten. Niemand hat Wilhelm II. gewählt – er wurde den Deutschen durch die unbeugsame Logik der dynastischen Thronfolge übergestülpt. Trumps Präsidentschaft hat bewiesen, dass sogar eine reife, mächtige und selbstbewusste Demokratie, die sich auf liberale Werte stützt, atavistische Ungeheuerlichkeiten hervorbringen kann.
Was wir aus der Pandemie lernen werden, bleibt abzuwarten. Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch nicht klar, wie schnell und wie umfassend sich die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt von dieser Krise erholen werden. Die Begegnung mit einer Pandemie ist nicht neu, neu sind jedoch die Maßnahmen, um ihre Verbreitung zu verhindern. Wie ein Podcast-Partner ganz richtig bemerkte, sind die Geschwindigkeit und das Ausmaß des wirtschaftlichen Stillstands absolut einzigartig. Die Krisen von 1929 und 2007/08 unterschieden sich voneinander, aber beide wurden von internen Fehlfunktionen des weltweiten Wirtschaftssystems ausgelöst. Die pandemische Krise hingegen ist ein exogener Schock, ein rasches Einfrieren der realen Wirtschaft per Regierungsdekret. Die Geschwindigkeit des Handelns ist wichtig, weil sie zur Folge hatte, dass die beteiligten Akteure so gut wie keine Zeit hatten, ihr Verhalten an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Ob eine teilweise eingefrorene Weltwirtschaft wieder aufgetaut und wieder angekurbelt werden kann, wird sich erst zeigen. An diesem Punkt stand die Menschheit noch nie.
Die in diesem Band zusammengestellten Aufsätze wurden ausgewählt, weil sie Themen behandeln, die meine Tätigkeit prägten, seit ich Student der neueren europäischen Geschichte wurde: Religion, politische Macht und das Bewusstsein der Zeit. Die Religionsgeschichte hat mich schon immer interessiert, weil religiöse Traditionen das menschliche Bestreben in den größtmöglichen Kompass einordnen. Politische Macht verbindet Kultur, Wirtschaft und Persönlichkeit mit Entscheidungen, die eine große Zahl von Menschen betreffen. Und das Studium der Zeit, nicht als durchsichtiges Plasma, durch das sich die Geschichte bewegt, sondern als etwas, das von Narrativen, religiösen ebenso wie säkularen, konstruiert und geformt wird, hat mich stets fasziniert, weil es verrät, wie die Präsenz von Macht, in welcher Form auch immer, unser Bewusstsein, unseren Sinn für Geschichte prägt. Die meisten Aufsätze sind das Produkt mehrfacher Überarbeitungen und Erweiterungen. Sie sind insofern allesamt Essays, als es sich eher um forschende Gedankenketten handelt als um hieb- und stichfeste Übungen in der historischen Diskussion. Einige von ihnen gehen auf öffentliche Vorträge zurück, andere auf Rezensionen. Lediglich zwei Aufsätze (»Liebesgrüße aus Preußen« und »Leben und Tod des Generalobersten Blaskowitz«) sind mit Anmerkungen versehen, weil sie sich stark auf Archivquellen stützen. Ich habe zwei kurze Beiträge aufgenommen, in denen ich jeweils auf das Werk eines Kollegen eingehe, um zu zeigen, wie die Arbeit anderer unseren Weg als Historiker ebenso wie als Mensch erhellen kann. Ich habe nicht versucht, einen dieser Aufsätze zu »aktualisieren« – dem Leser wird auffallen, dass der letzte, »Unsichere Zeiten«, zwar zeitgenössisch ist, aber aus jener fernen Zeit vor COVID-19 und den derzeitigen Spannungen um den »Aufstieg Chinas« stammt. Es erschien mir zu riskant, ihn an die aktuelle Lage anzupassen, weil er dann womöglich weniger frisch wirken könnte. Die Aufsätze in diesem Buch sind, genau wie ihr Verfasser und die darin auftretenden Protagonisten, Gefangene der Zeit.
DER TRAUM DES NEBUKADNEZAR ODER GEDANKEN ÜBER DIE MACHT
Dieser Text ist ein Amalgam ausverschiedenen Vorträgen und einem Essay, den ich für einen Sammelbandzur Geschichtsschreibung verfasst habe. Es ging nicht darum, eine Theorieder Macht zu präsentieren, sondern darüber zu reflektieren, wie sichdieses rätselhafte Ding in einer Vielzahl historischer Kontexte äußert undwie ihre Präsenz historische Darstellungen prägt.
Ich möchte die folgenden Gedanken mit einem Auszug aus dem alttestamentarischen Buch Daniel beginnen. Das zweite Kapitel dieses Buches fängt mit einer Szene an, in der König Nebukadnezar II. aus dem neubabylonischen Reich vorkommt, der von 605 bis 562 v. Chr. herrschte – insgesamt 43 Jahre. Heute ist Nebukadnezar hauptsächlich für zwei Dinge bekannt: für den Bau der Hängenden Gärten von Babylon – eins der sieben Weltwunder der Antike – und für die Belagerung Jerusalems und die Zerstörung des Tempels, die das sogenannte »Babylonische Exil« der Juden einleiteten.
Kapitel zwei des Buches Daniel schildert einen Morgen im zweiten Jahr der Herrschaft Nebukadnezars, nach der Plünderung Jerusalems. Der König erwacht beunruhigt aus einem Traum. Er findet keine Ruhe mehr und ruft die weisen Männer zu sich, »alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager«. Sie kommen zu ihm und bitten ihn, den Traum zu beschreiben: »Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten.« Aber der König weigert sich, den Inhalt seines Traums zu erzählen. Allem Anschein nach hat er seinen Traum vergessen. Die Stimmung im Saal sinkt auf den Nullpunkt: Die Weisen (die sich jetzt gar nicht sonderlich weise vorkommen) versuchen, so behutsam wie möglich die Information zu vermitteln, dass ihre Deutungsfähigkeiten, so beeindruckend sie auch sein mögen, nicht die Fähigkeit einschließen, die Gedanken schlafender Könige zu lesen: »Denn was der König fordert, ist zu schwer, und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen.« Mit anderen Worten: »Es tut uns leid, Chef, aber das übersteigt unsere Zuständigkeit bei Weitem.«
Den weisen Männern dürfte in diesem Moment nicht ganz wohl gewesen sein, und das aus gutem Grund, denn im nächsten Augenblick sagt der König: »Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden.« Das Gespräch geht noch weiter, doch der Tenor der Haltung des Königs ist bereits klar: Die Weisen sind reine Platzverschwendung. Dieses Reich hat von den Experten genug. In seinem Zorn befiehlt der König, alle weisen Männer in Babylon hinzurichten.
Der Befehl des Königs löst Bestürzung aus. Unter den Menschen, die geschockt sind, als sie davon hören, ist auch ein junger jüdischer Gefangener, genau genommen ein Kriegsgefangener namens Daniel – ein Mann von adliger Herkunft, den man nach der Belagerung und Zerstörung Jerusalems nach Babylon verschleppt hat. Daniel gehört einer kleinen Gruppe stattlicher und gebildeter junger Israeliten aus gutem Hause an, die man aus der zerstörten Stadt mitgenommen hat, damit sie die Literatur und Sprache Babylons lernen und am Hof des Königs dienen. Folglich zählt auch Daniel möglicherweise zu jenen »Weisen«, denen die Hinrichtung droht, wenn der Befehl des Königs ausgeführt wird. Das Buch berichtet, dass Daniel mit einem der Palastwächter spricht. Er fragt, was denn mit dem König los sei. Der Wächter erklärt es ihm. Daniel möchte wissen, ob er einmal persönlich mit dem Monarchen sprechen könne (ich übersetze hier recht frei aus dem Aramäischen). Der Wächter willigt ein, eine Audienz anzuberaumen. Daniel geht daraufhin zu den Freunden, mit denen er die Wohnung teilt: Hananja, Mischael und Asarja. »Leute«, sagt er, »lasst uns Gott um Erleuchtung bitten. Lasst uns den Gott des Himmels um Gnade bitten wegen dieses Geheimnisses«.
Am nächsten Morgen begibt sich Daniel zum König. Wir können davon ausgehen, dass der König anfangs skeptisch ist: Wenn die weisen Männer Babylons allesamt an dieser Aufgabe scheiterten, was konnte Daniel dann zu erreichen hoffen? Doch zur Überraschung des Königs beschreibt Daniel den Traum, oder genauer: er beschreibt einen Traum, einen Traum, von dem er hofft, dass der König ihn als seinen eigenen akzeptieren wird. Er macht daraus nicht nur ein beunruhigendes nächtliches Erlebnis, sondern eine prophetische Offenbarung: »Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dereinst geschehen würde; und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird.« Darauf folgt der Traum selbst. Der König habe, so Daniel, ein riesiges, glänzendes Bild, einen Koloss erblickt: »Und siehe, ein sehr großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen.« Das Haupt war aus Gold, so leuchtend wie die Sonne. Die Brust und Arme waren aus Silber. Der Bauch und die Lenden waren aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton.
Was das denn zu bedeuten habe, will der König wissen. Man kann nur vermuten, dass Daniel in diesem Moment ein großer Stein vom Herzen fiel. Immerhin hatte er nicht wissen können, ob der König den Traum akzeptieren würde, den Daniel ihm präsentierte. Daniel beginnt mit der Deutung des Traums, den er dem König in den Kopf gesetzt hat: »Du, König, König aller Könige, […] bist das goldene Haupt.« Denn dir hat »der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben […], und […] alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben«, und er hat dir »über alles Gewalt verliehen«. An diesem Punkt geht Daniel – das lässt sich nicht leugnen – brillant mit der Situation um. Er schmeichelt dem König, zunächst einmal, indem er andeutet, dass er der privilegierte Empfänger von Geheimnissen sei, die ihm vom Herrn aller Geheimnisse offenbart wurden, und zum zweiten, indem er andeutet, dass diese göttliche Autorität die Macht des Königs stütze. Der König will es genauer wissen: Wofür stehen die Brust aus Silber, der Bauch aus Bronze, die Schenkel aus Eisen etc.? Daniel erklärt: Nach dem goldenen Zeitalter des Nebukadnezar, dessen Glanz niemals übertroffen werden wird, wird ein geringeres Zeitalter aus Silber kommen und danach ein noch geringeres aus Bronze. Und dann wird ein richtig übles Zeitalter von Eisen und Ton kommen, in dem Menschen gegen Menschen und Könige gegen Könige kämpfen werden. »Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird.« Der Traum und die Deutung Daniels enthalten noch weitere Details, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.
Die Reaktion des Königs auf diese Enthüllungen ist absolut außergewöhnlich: »Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen.« Die Massenhinrichtung der weisen Männer wurde abgesagt.
Die Geschichte nimmt noch weitere dramatische Wendungen: Die Stimmungsschwankungen Nebukadnezars verschlimmern sich erheblich – er verbringt einen Zeitraum von sieben Jahren in einem Zustand seelischer Qual, in der er bei den wilden Tieren in Höhlen und auf Feldern lebt. Im frühen 19. Jahrhundert fing der Künstler William Blake diese Phase im Leben des Nebukadnezar in einem unvergesslichen Druck ein, wie er nackt und schmutzig auf allen Vieren kriecht und den Betrachter in einem schieläugigen Wahn anstarrt.
Die Seelenqualen eines einstmals mächtigen Herrschers. William Blake, Nebukadnezar (ca. 1795–1805).
© mauritius images (The Picture Art Collection/Alamy)
Das Buch Daniel, ein sehr exzentrisch strukturierter Text, dokumentiert noch weitere Träume und Visionen, und Daniel gerät selbst in manche Gefahren – die wohl berühmteste ist die beängstigende Begegnung mit einigen Löwen in einer Grube.
Wenn wir uns jedoch die Anfangsszene genauer ansehen, in der Daniel den Traum erzählt und deutet, entdecken wir eine wunderbare und subtile Parabel der Macht. Die Geschichte erzählt uns, dass selbst der mächtigste Mensch auf der Welt gegenüber seinen nächtlichen Schrecken machtlos ist. Er bestellt die Inhaber der bürokratischen Macht zu sich, die Gelehrten und die Hüter des privilegierten Wissens. Aber es gelingt ihnen nicht, eine Lösung zu präsentieren, und als Folge verlieren sie ihre Macht und potenziell sogar ihr Leben. In eben diese angespannte Konstellation tritt jemand, der nicht die geringste Macht besitzt: ein rechtloser junger Fremder, ein Kriegsgefangener, eine Geisel aus einer geplünderten Stadt. Es ist nicht definitiv geklärt, ob Gott wirklich Daniel den Traum des Königs offenbarte oder ob der junge Mann womöglich einfach die nötige menschliche Einsicht besaß, um das wahre Wesen der Not des Königs zu erkennen. Das Buch enthält weiter hinten zwar Verse, in denen Gott dafür gedankt wird, dass er Daniel zur Seite stand. Doch das ist eine Interpolation. Die Geschichte selbst legt eine ganz andere Schlussfolgerung nahe, nämlich dass der junge Mann die Lage zu deuten wusste, in der sich der König befand. Was konnte ein so mächtiger Mann wie Nebukadnezar schon fürchten außer der eigenen Sterblichkeit? Und wie könnte man ihn besser mit dieser furchtbaren Gewissheit versöhnen, als indem man seine ewige Vorherrschaft über den Rest des menschlichen Unterfangens festschrieb? Gleichzeitig teilte Daniel dem König etwas mit, was er selbst als Sohn einer zerstörten Stadt erfahren hatte, eine Weisheit, nämlich dass Macht stetszeitlich befristet ist. Und der Lohn für diese Weisheit ist, dass der größte König auf Erden ihm zu Füßen liegt.
Die Bedeutung von Nebukadnezars (Daniels) Traum für das Thema dieses Essays kann man gar nicht hoch genug veranschlagen. Denn aus dem Koloss des Traums, den Daniel als eine Prophezeiung ausgab, entstand das Vorhaben, sich die Weltgeschichte als die Abfolge von etwas Vorherbestimmtem, als ein von der biblischen Prophezeiung sanktioniertes Narrativ vorzustellen. Bis in die frühe Neuzeit hinein war es üblich, die Weltgeschichte als eine eschatologische Reihe von Hegemonialreichen zu betrachten, angefangen bei den Babyloniern, darauf die Perser (mit der Option, die Meder mitzuzählen), die Griechen und schließlich die Römer. Auf diese Vorstellung werde ich noch zurückkommen.
***
Macht ist das Thema der Geschichtsschreibung, dem man fast überall begegnet, das aber zugleich am schwersten zu fassen ist. Machtfragen stehen im Zentrum der meisten historischen Narrative, doch der Begriff selbst wird selten hinterfragt oder analysiert. Es gibt zwar Studien, die versuchen, die Unterschiede zwischen verschiedenen Formen der Macht zu klären, doch sie stammen tendenziell von Soziologen oder Politologen, nicht von Historikern, und bislang ist kein Konsens über die Definitionen erzielt worden. Selbst auf dem Feld der Politik- und Diplomatiegeschichte, die sich in erster Linie mit der Ausübung von Macht befasst, wird der Begriff stets als offensichtliche Bezeichnung verwendet, deren Bedeutung keiner weiteren Erklärung bedarf. Im Gegensatz zu »Gender« und »Kultur« ist »Macht« nie zum Fixpunkt für jene Form von Subdisziplin geworden, die eine konzertierte theoretische und vergleichende Auseinandersetzung mit dem Problem der Macht quer durch das ganze Spektrum der historischen Praxis gerechtfertigt hätte. Wenn man im Netz nach »Machtstudien« oder, wie es auf Englisch heißt, nach »power studies« sucht, wird man auf Seiten stoßen, die sich der strategischen und konzeptionellen Untersuchung der Luft- und Weltraummacht oder dem Schutz persönlicher und elektrischer Geräte durch elektrisches Sicherheitstraining oder der Optimierung der Leistung des Stromnetzes widmen.
Woran liegt das? Ein Grund dürfte das Wesen der Macht selbst sein. Sie ist, wie ein Mediävist es einmal formulierte, »begrifflich so weitreichend und so unergründlich aufgebläht, dass man instinktiv dazu neigt, das Wort im Plural zu gebrauchen«. »Macht« ist keine Eigenart, die man Gruppen oder Einzelpersonen zuschreiben kann; vielmehr drückt sich darin eine Beziehung untereinander aus. Folglich ist Macht weder eine substantielle Entität, noch eine Institution, geschweige denn etwas, das man besitzt, sondern ein Attribut der Beziehungen, innerhalb derer sie ausgeübt wird. Gerade weil Michel Foucault, der einflussreichste Nachkriegstheoretiker der Macht, dies erkannte, lehnte er es ab, den Begriff unter einer separaten Rubrik zu behandeln, sondern bettete seine Überlegungen in eine Analyse der spezifischen institutionellen und disziplinarischen Kontexte und Praktiken ein.
Eben darauf ist es zurückzuführen, dass die Macht ein so problematischer Gegenstand synoptischer historischer Betrachtungen ist, denn die Beziehungen, in denen sie sich bemerkbar macht, sind ebenso vielfältig wie das gesamte Feld der menschlichen Erfahrung. Als rein relationales Konzept lässt sich Macht oftmals nur schwer lokalisieren. Das mag nicht zuletzt die endlosen Debatten erklären, die in der historischen Forschung über das Ausmaß der Macht geführt werden, die bestimmte Souveräne und Regime tatsächlich ausübten. Zumindest lassen sie auf eine anhaltende Unsicherheit schließen, wie und wo Macht in komplexen Systemen eigentlich entsteht und sitzt und ob die Ausübung stärker von Zwang oder von der Zustimmung derjenigen abhängt, über die angeblich Macht ausgeübt wird.
Die unzähligen Konnotationen, die in und um den Begriff »Macht« mitschwingen, erschweren das Ganze zusätzlich. »Macht« und »Einfluss« werden zwar austauschbar verwendet, sind aber nicht unbedingt gleichbedeutend. Ich weiß noch, dass ich einmal eine Kollegin in Cambridge sah und schmunzeln musste, als mir die Worte auf dem T-Shirt ihrer dreijährigen Tochter ins Auge sprangen: »Ich bin vielleicht klein, aber ich habe großen Einfluss.« Der Theoretiker der internationalen Beziehungen Robert Keohane stellte das gleiche Ungleichgewicht in dem, wie er es nannte, »großen Einfluss kleiner Bündnispartner« fest. »Wie ein Elefant, der vor eine Gruppe kleinerer Tiere gespannt ist«, schrieb er, seien die Vereinigten Staaten durch verschiedene internationale Abkommen an eine Reihe kleinerer und schwächerer Bündnispartner gebunden. »Das sind die Dachse, Mäuse und Tauben der internationalen Politik, und in vielen Fällen ist es ihnen gelungen, den Elefanten zu lenken.« Die Grenzen zwischen Macht und Autorität sind häufig fließend, ungeachtet der langen europäischen Tradition, über das Verhältnis zwischen säkularer und geistlicher Autorität im Sinne der Unterscheidung zwischen potestas und auctoritas zu theoretisieren. Um Macht zu deuten, muss man folglich häufig die verschiedenen Faktoren herausarbeiten, auf die zurückgegriffen wird, um sie zu erhalten.
Aus diesem Grund wird hier nicht der Versuch unternommen, chronologisch die Entwicklung der historischen »Machtstudien« (weil es so etwas schlicht nicht gibt) zu skizzieren. Ebenso wenig werde ich die verschiedenen Formen kategorisieren, in denen Historiker den Begriff verwendet oder zu definieren versucht haben. Vielmehr werden im Folgenden knapp einige Konfigurationen untersucht, innerhalb derer die Mechanismen der Machtausübung die Aufmerksamkeit der Historiker erregten: die »Mächte« und »Supermächte« des internationalen Systems, Macht und persönliche Herrschaft, die Macht der Staaten, die Hyperkonzentration von Macht in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts, ihre Stellung in pluralistischen demokratischen Systemen und die angebliche Machtdiffusion im Zeitalter des »Spätkapitalismus«.
Die von den Historikern genutzten Quellen sind häufig selbst Artefakte der Macht. Viele Archive, in denen Historiker arbeiten, sind die versteinerten Überreste einst mächtiger Bürokratien; und Historiker sind keineswegs immun gegen die verführerischen und abstoßenden Wirkungen der Macht. In Anbetracht dessen schließe ich mit einigen Gedanken zur Auswirkung der Macht auf die Geschichtsschreibung.
Die Macht der Mächte
Das Buch Daniel schuf die Grundlage für eine Sichtweise der Weltgeschichte, die von einer prophezeiten Abfolge von Reichen ausgeht. Auf das Zeitalter der Babylonier folgte das der Meder und Perser. Danach kamen die Griechen und zuletzt die Römer, deren Herrschaft nach Auffassung vieler Europäer in der Form des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation das Altertum überdauerte. Dieses Muster hatte bis weit in die frühe Neuzeit großen Einfluss und ist noch heute in der Welt der Entrückungs-Websites stark verbreitet. Der Begriff »Entrückung« spielt auf eine eschatologische Doktrin an, die postuliert, dass die Weltgeschichte mit einer siebenjährigen Phase der Kümmernis enden wird, bevor oder nachdem die Christen in den Himmel entrückt werden, um zu Christus zu gelangen.
Mit anderen Worten: Daniels Prophezeiung stellte sich die Weltgeschichte, ehe sie überhaupt geschehen war, als eine Aufeinanderfolge von Mächten, eine Folge von Hegemonien vor. Die Faszination dieser Vision ließ erst dann allmählich nach, als der sächsische politische Philosoph Samuel Pufendorf, neben anderen Gelehrten, im 17. Jahrhundert erstmals behauptete, dass die Zeit der Römer vorüber sei. Pufendorf bestritt, dass das Heilige Römische Reich deutscher Nation (im prophetischen oder sonstigen Sinn) die Fortsetzung des alten Römischen Reichs sei, und stellte damit den Einfluss der Offenbarung auf die Geschichte infrage. Für Pufendorf war nicht die diachrone Abfolge der Reiche das Wesentliche an der Geschichte, sondern die synchronen Beziehungen zwischen ihnen – in der Form von Bündnissen, Konflikten und Kriegen. Die Beziehungen unter den Mächten seien, so argumentierte Pufendorf, naturgemäß chaotisch und unberechenbar, weil sich die Interessen jedes Territorialstaats fortwährend entsprechend den Verschiebungen im bestehenden Kräftegleichgewicht zwischen ihnen veränderten. Die Vorstellung von Kräften, die innerhalb eines kompetitiven mehrstaatlichen Systems um die Vorherrschaft kämpfen oder zumindest nach Sicherheit streben, trug somit dazu bei, die »Menschheitsgeschichte« als eigenständige Disziplin zu etablieren, im Unterschied zur historia divina, die von Prophezeiungen geschrieben wird.
Losgelöst von der Prophezeiung konnte sich die Geschichte der Mächte unter der Rubrik Disruption und Wandel entfalten. »Zerbrechlichkeit und Instabilität sind untrennbar mit den Werken der Menschen verbunden«, schrieb Friedrich II. von Preußen im Jahr 1751. Und das sei auch gut so, glaubte der König, denn wenn es keine großen Unruhen gebe, gebe es »auch keine großen Ereignisse«. Der Bogen von Aufstieg und Niedergang, den die großen Mächte der Weltgeschichte beschrieben, erinnerte den König an die regelmäßigen Bewegungen der Planeten, die sich, »nachdem sie den Raum des Firmaments zehntausend Jahre lang durchwandert hatten, am selben Orte wiederfanden, an dem sie ihre Reise begonnen hatten«. Die Untersuchung der »Laufbahn« großer Staaten handelte somit von der Veränderlichkeit und Unbeständigkeit von Macht. Die Hegemonie jedes einzelnen Staates war stets befristet. Die mächtigen Reiche des Altertums im Nahen Osten, in Griechenland und Rom sind inzwischen nur noch Ruinen. Der heute große Potentat ist der Osymandias von morgen. Die spanisch-habsburgische Vorherrschaft des 16. Jahrhunderts wich dem holländischen Reich des Goldenen Zeitalters; die Hegemonie Frankreichs am Ende des 17. Jahrhunderts machte nach langen und erbitterten Kämpfen dem britischen Empire des 19. Jahrhunderts Platz, einem riesigen Seefahrer-Unternehmen, das von der Stärke der Industrie und beispiellosen finanziellen Ressourcen getragen wurde. Aber auch die britische Imperialhegemonie war zeitlich befristet; sie sollte das »amerikanische Jahrhundert«, wie Henry Luce es bekanntlich nannte, nicht überleben.
Die Gewohnheit, sich Geschichte als eine Abfolge von Reichen vorzustellen, war nur schwer zu erschüttern. Und daraus erwächst eine der zentralen Fragen, die US-amerikanische Politologen stellen: Wird es den Vereinigten Staaten, deren relativer Vorsprung bei der militärischen Macht in der Weltgeschichte beispiellos ist, gelingen, mittel- und langfristig die Führungsposition zu halten? In diesem Kontext ist viel von soft power die Rede, einer Form von Legitimität, die entsteht, wenn der dominante Staat mit einer universalistischen Kultur, attraktiven Wertvorstellungen und einem liberalen und/oder multilateralen Engagement für andere Staaten und transnationale Organisationen assoziiert wird. Soft power sei wichtig, argumentierte der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph Nye, weil sie danach trachte, der externen Projektion der Macht Legitimität zu verleihen.
Legitimität ist genau das, woran es häufig mangelt, wenn mächtige Staaten jenseits der eigenen Grenzen Gewalt anwenden wollen. Überdies ist der Versuch, die eigene Macht in eine Umgebung zu projizieren, in der die Einheimischen sie nicht akzeptieren, ein Unterfangen, das unweigerlich Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese Lektion musste jede neuzeitliche Generation von Neuem lernen. Selbst die Vereinigten Staaten haben, ungeachtet ihrer eindeutigen globalen Überlegenheit in Sachen hardpower, gelegentlich nicht die Ziele erreicht, die sie sich gesetzt hatten. Der Historiker Arthur Schlesinger erinnert daran, dass Präsident Lyndon B. Johnson es auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs »intuitiv für unvorstellbar hielt, dass die, wie Walt Rostow ihm unablässig versicherte, ›größte Macht der Welt‹ nicht mit einem Haufen Terroristen in schwarzen Pyjamas fertig wurde«. Selbst militärische Eroberungen – also die durchschlagendste und offensichtlichste Anwendung von »harter« Macht – werden im Laufe der Zeit tendenziell untergraben, wenn sich die Mehrheit der besetzten Bevölkerung nicht mit den Werten der neuen Herrscher identifiziert. Macht ist immer noch die entscheidende Instanz des internationalen Systems, doch ihre effektive Anwendung, um damit dauerhafte Lösungen zu erreichen, könnte selbst unter extrem asymmetrischen Rahmenbedingungen von einer paradoxen Verknüpfung von Zwang und Zustimmung abhängen. Und bei der Werbung um Zustimmung gibt unter Umständen soft power den Ausschlag.
Konzentration und Zerstreuung
Natürlich ist nicht jede Form von Macht gleich Regierungsgewalt. Doch der Aufstieg und/oder Niedergang von Regierungen und später von Beamten als den Inhabern eines »Monopols legitimer, physischer Gewaltsamkeit« (Max Weber) zählt zu den zentralen europäischen Geschichten über Macht. Es kann zu einer Konzentration der Macht in Regierungen, Staaten und Bürokratien kommen, aber sie kann sich auch wieder zerstreuen. In einer klassischen Darstellung zur Entstehung der »Feudalgesellschaft« beschreibt der französische Mediävist Georges Duby, wie die alles umfassenden Strukturen des Karolingerreiches in immer stärker lokalisierte Einheiten zerfielen, die sich auf die Befestigungen und militärische Macht der Burgvögte stützten, jene Männer, die über Burgen, Pferde und Waffen verfügten. Im Zuge dessen veränderte sich die Bedeutung von Macht; ihre Ausübung wurde weniger »öffentlich«, sondern hing stärker mit den Besitzverhältnissen zusammen. Sie nahm aggressivere und ausbeuterischere Formen an.
Doch auf diese Phase der Zersplitterung folgte, zumindest laut einiger Gelehrter, der Aufstieg neuer Formen der Verwaltung und die Sehnsucht nach einer »guten Regierung«, in der Tugend und Macht im Einklang sind und die Macht der Autorität der Justiz untersteht. Lorenzettis gemalte Allegorie einer guten Regierung aus den Jahren 1338/39, der wohl eindrucksvollste Ausdruck dieses Ideals, regt an, dass eine gute Regierung den Rahmen für einen staatsbürgerlichen Frieden schafft, der wiederum Reichtum und Wohlergehen der Untertanen gewährleistet.
Aus einer Welt, in der die gesamte Macht in Gestalt lokal begrenzter und persönlicher Adelsherrschaft ausgeübt wurde, entwickelten sich neue Regierungsformen aufgrund der Notwendigkeit, die Auswüchse ausbeuterischer und gewaltsamer Formen lokaler Herrschaft einzudämmen. Das Beharren auf den Adelsprivilegien wurde von der »Anerkennung eines kollektiven Interesses« verdrängt, nach dem Regieren erstmals nicht nur Zwang und Strafe, sondern auch »Amt, Rechenschaft, Kompetenz, Gemeinwohl« bedeutete. In England wurde der Staat im Zeitraum von 1160 bis 1250 »wohl mächtiger als jemals sonst in der englischen Geschichte«. Und diese Entwicklungen machten den Weg frei für den »institutionalisierten Territorialstaat« des Spätmittelalters (Theodor Mayer), in dem sich die Macht des Souveräns zunehmend auf die gesamte Fläche eines bestimmten Gebiets erstreckte – eine Entwicklung, die von der verstärkt »räumlichen« Orientierung des spätmittelalterlichen Rechtsdiskurses unterstützt wurde.
Wir brauchen hier nicht näher auf diese Diskussionen einzugehen, geschweige denn auf die akademische Auseinandersetzung über deren Wahrheitsgehalt. Aus unserer Sicht viel wichtiger ist die zugrunde liegende Logik. Macht ist ständig im Fluss; sie wird zerstreut, lokalisiert sich und verändert dabei ihr Wesen. Dann wird sie auf einer höheren Ebene neu ausgerichtet. Ein konstanter Zustand wird niemals erreicht; auf lange Sicht sind sämtliche Beziehungen Neuverhandlungen unterworfen, und soziale Unruhen und Kriege können stets eintreten und das Gleichgewicht neu austarieren. In England etwa lösten die dynastischen Bürgerkriege, die sogenannten Rosenkriege (1455–1485), eine strukturelle Verschiebung in der Beziehung zwischen niederem und hohem Adel aus, welche die Regierungsgewalt wiederum in den Händen des monarchischen Staates konzentrierte und den Weg für die darauffolgende Ära der starken Tudor-Könige frei machte.
Legitimität
Diese Veränderungen gingen mit einem verstärkten Interesse am Gegensatz zwischen legitimen und illegitimen Formen von Macht einher. Diejenigen, die illegitim regierten, wurden »Tyrannen« genannt; in der Auseinandersetzung mittelalterlicher kirchlicher Moralisten fungierten sie als »Antitypen des guten Herrschers« (auch wenn Johannes von Salisbury postulierte, dass der Tyrann eventuell Gottes Methode sei, sündige Untertanen zu bestrafen). Die Vorstellung einer legitimen menschlichen Macht bereitete in einem Universum, in dem alle Macht von Gott ausging, gewisse Schwierigkeiten. »Wer wüsste denn nicht«, schrieb Papst Gregor VII. an Bischof Hermann von Metz, »dass Könige und Herzöge ihren Ursprung bei denen genommen haben, die Gott nicht kannten und durch Hochmut, Raub, Hinterlist, Mord, kurz durch Verbrechen aller Art und angestiftet vom Fürsten dieser Welt, nämlich dem Teufel, über ihresgleichen, nämlich Menschen, zu herrschen suchten in blinder Gier und unerträglicher Anmaßung?« Diese Worte, ausgesprochen von einem Papst auf dem Höhepunkt seines Machtkampfs mit einem deutschen Kaiser, waren freilich parteiisch. Aber sie rührten an einen tief verwurzelten Strang des mittelalterlichen Denkens über das Problem der Souveränität, eine Tradition, die bis zu Augustinus zurückreicht. Thomas von Aquin räumte ein, dass Herrschaftsverhältnisse in Anbetracht des menschlichen Wesens eine naturgegebene, gesellschaftliche Tatsache seien, aber auch er war, wie viele einflussreiche Kirchendiener, überzeugt, dass es sich um eine auf der Sünde fußende Einrichtung handelte. Selbst als die Strukturen fürstlicher und staatlicher Macht im Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts allmählich rationalisiert und verfestigt wurden, wurden in den Bibelkommentaren Nordfrankreichs, wie Philippe Buc aufzeigt, erneut die negativen Aspekte von potestas und dominatio hervorgehoben.
Die Unterscheidung zwischen repressiver Gewalt und rechtmäßig verliehener Autorität blieb eines der anregendsten Probleme des frühneuzeitlichen politischen Diskurses. »Fürsten wollen oft Macht, sie haben oft Recht […] ohne Macht«, schrieb der puritanische Geistliche Thomas Gataker 1620. »Und tyrannische Usurpatoren haben mehr Macht, als es geziemt; sie haben […] Macht ohne Recht.« Allein die Erwartung, dass Herrschaft sich »legitimieren« sollte, impliziert bereits, wie David Sabean bemerkt hat, dass sie in gewisser Weise willkürlich ist, dass ihre Ausübung eine Rechtfertigung oder Tarnung erfordert.
Bezeichnenderweise wichen ausgerechnet die beiden einflussreichsten frühneuzeitlichen Erkunder des Problems säkularer Macht, nämlich Machiavelli und Hobbes, der Frage nach der Legitimität aus (oder stellten sie in einen neuen Rahmen): Ersterer, indem er den Beweggrund fürstlicher Macht schlicht auf das Streben nach Ruhm und den »Erhalt des eigenen Staates« mit allen opportun erscheinenden Mitteln verengt, und Letzterer, indem er Souveränität funktional gesehen als den bestmöglichen Hüter der öffentlichen Ordnung und als Schutz für Leben und Besitz rechtfertigt. Ob der Leviathan von Hobbes, der in seiner gewaltigen Größe dem Koloss ähnelt, den Daniel Nebukadnezar eingegeben hatte – ob diese »künstlich geschaffene Person« nun liebenswürdig ist oder nicht, ob sie sich an allgemeine moralische Normen hält oder nicht, ist für ihre Funktion als Garant der öffentlichen Ordnung bedeutungslos. So gesehen wurde der Beweggrund für die Ausübung souveräner Macht losgelöst – man könnte sagen: emanzipiert – von Fragen nach der Gottesfurcht oder Tugend des Fürsten.
Der Aufstieg des Staates
Der »Absolutismus« war ein Konzept, mit dessen Hilfe Historiker den Übergang von höchst mittelbaren und persönlichen Formen der Macht, wie sie in der mittelalterlichen Gesellschaft dominierten, zur vermeintlich zentralisierten und konzentrierten Macht moderner Staaten beschrieben. Man ging davon aus, dass moderne, zentralisierte Staaten (zumindest auf dem europäischen Kontinent) aus einem langen Machtkampf zwischen fürstlichen Beamten und den Eliten der Provinz hervorgingen. Angesichts der wachsenden Kosten und Lasten der Kriege mit anderen Staaten fegte das Modell des zentralisierten Staates sämtliche vor ihm existierende Formen hinweg, weil neue Staatseinnahmen benötigt wurden – das Aufeinanderprallen von Mächten begünstigte folglich die Konzentration von Macht und umgekehrt. Die fürstlichen Regierungen im 17. und 18. Jahrhundert lösten die Organe ständischer Vertretungen (die Ständeversammlungen, Cortes, Reichstage) auf, ersetzten lokal organisierte und finanzierte Milizen durch stehende Heere, setzten supraterritoriale Rechtsprechungen außer Kraft und führten neue Steuern und territoriale Gesetzeskodizes ein. Die Zahl der fürstlichen Beamten wuchs: Im Jahr 1715 hatte Ludwig XIV. zehn Mal so viele officiers wie noch Franz I. (1515–1547), um eine nur geringfügig gewachsene Bevölkerung zu regieren. Im Zuge dieses Prozesses wurden die verschiedenen Provinzen »zusammengesetzter Monarchien« schrittweise zu einem engeren und homogeneren Verbund vereint.
Die zeitgenössische politische Theorie begrüßte ausdrücklich die Aufstockung der fürstlichen Beamten. In den Augen des Juristen Samuel Pufendorf, des einflussreichsten deutschen Lesers von Hobbes, leitete sich die Legitimität der Staaten aus der Notwendigkeit ab, durch die Konzentration von Autorität ein Chaos zu verhindern. Da es jedoch in Friedens- oder Kriegszeiten unmöglich ist, die staatlichen Angelegenheiten zu regeln, ohne dass Kosten anfallen, hatte der Souverän das Recht, »alle Unterthanen [sic] [anzuhalten], von ihren Gütern so viel zusammen zu tragen, als zu Bestreitung erforderten Unkosten nöthig zu seyn erachtet wird«. Hier haben wir einen überzeugenden Beweggrund, die staatliche Autorität auszuweiten. Gegen die libertas der Stände hob Pufendorf die necessitas des Staates hervor.
Aber wie weit ging dieser Konsolidierungsprozess? Selbst im späten 18. Jahrhundert waren, wie die meisten Historiker inzwischen einräumen, die Befugnisse des monarchischen Staates noch recht begrenzt. Mag sein, dass die Stände nicht mehr in landesweiten Versammlungen zusammenkamen, doch die Adligen, die nach ständischem Vorbild organisiert waren, hatten in den Provinzen immer noch das Sagen. Gewiss nahm die Zahl der zentralen Beamten zu, blieb aber dennoch klein. Im Jahr 1715 hatten die zentralen Verwaltungsbehörden des französischen Staates nicht mehr als 1000 Mitarbeiter; und eine Bevölkerung von knapp 20 Millionen wurde von einem Korps aus lediglich 2000 Polizeibeamten überwacht. Könige benötigten weiterhin die Unterstützung und das Wissen der Eliten in der Provinz, von deren Patronagenetzwerken ganz zu schweigen.
Hatte Peter der Große die Privilegien des russischen Adels infrage gestellt und ausgehöhlt, so machte Katharina die Große die Auswüchse des Staatsbildungsprozesses wieder rückgängig und beschloss stattdessen, die Adligen wieder als tragende Säule der Autokratie zu bestätigen. Zwischen den Regierungszeiten des Großen Kurfürsten und König Friedrichs II. spielte sich in Preußen ein ganz ähnlicher Prozess ab. Selbst nachdem mehrere aufeinanderfolgende Generationen der Hohenzollern die Machtgrundlage des Landadels ausgehöhlt hatten, war das politische Leben des Königreichs Preußen weiter von übrig gebliebenen ständischen Netzwerken der Adelsherrschaft geprägt, was Wolfgang Neugebauer einmal »ständische Latenz« genannt hat.
Somit bleibt eine gewisse Unsicherheit bestehen, wie die Macht denn genau verteilt war, wenn man bedenkt, dass Machtverhältnisse allzu häufig die wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisse kaschierten. Das Problem reichte bis ins Zentrum des königlichen Beamtenapparats, denn selbst die mächtigsten Monarchen waren auf jene angewiesen, die sie berieten; die Abhängigkeit verstärkte sich sogar, als die Funktionen des expandierenden Staates immer komplexer wurden. Eben dieses Problem des »Zugangs zum Machthaber« erregte die Aufmerksamkeit Carl Schmitts, einer der scharfsinnigsten Autoren des 20. Jahrhunderts, der sich mit der Funktionsweise politischer Macht auseinandersetzte.
Die Konzentration von Macht im Zuge der Staatsbildung ist keineswegs auf Europa beschränkt. In China hielt sich die staatliche Struktur über mehrere Jahrhunderte, weil es den aufeinanderfolgenden Generationen von Herrschern gelang, ein Bündnis mit dem kriegerischen Landadel der Regionen einzugehen. Doch die Beziehung zwischen dem imperialen Zentrum und der Peripherie veränderte sich im Laufe der Zeit erheblich. Der chinesische Staat übte begrenzte politische Kontrolle über die Nicht-Han-Völker am südlichen Rand des Reiches aus. Unter der Ming-Dynastie (1368–1644) wurde die imperiale Autorität über ein System »einheimischer Stammesführer« vermittelt, denen man die Kontrolle über die Nicht-Han-Gebiete übertragen hatte. Doch Kaiser Yongzhen, der im Jahr 1723 den Thron bestieg, beschloss, die Stammesführer abzuschaffen. Die Einsetzung der Stammesführer zwischen ihm selbst und einem Teil der Bevölkerung war mit seiner Vorstellung vom Staat als einer zentralisierten Einheit nicht versöhnbar.
Auch in Japan können wir ein Hin und Her zwischen Konzentration und Diffusion beobachten, das in groben Zügen der europäischen Version ähnelt. Im frühen 8. Jahrhundert wurde ein zentralisiertes Gemeinwesen errichtet, das die unabhängigen Herrschaftsbereiche der Clans ablöste, die zuvor die japanischen Inseln dominiert hatten. Die unterschiedlichen lokalen Ahnenkulte wurden durch ein landesweites Ritual der Anbetung ersetzt, das sich auf den halbgöttlichen Status der Yamamoto-Monarchie konzentrierte. Neue Gesetzeskodizes aus den Jahren 705 und 757 bestätigten, dass jede Befehlsgewalt allein vom »himmlischen Herrscher« in Kyoto ausging. Im 13. und 14. Jahrhundert forderten jedoch mächtige Provinzfürsten immer wieder die Autorität des Hofes und seiner Militärregierung, des Shōgunats, heraus. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts hatten Aufstände und Kriege zwischen den Clans die Autorität des zentralisierten Gemeinwesens zerstört – der Hof war eine leere Hülle.
Erst im Jahr 1603 wurde Japan unter Shōgun Iyeyasu aus dem Haus Tokugawa wiedervereinigt, der das Fundament für »eine neue und weit mächtigere Form der Regierung als in der Vergangenheit« legte. Unter dem Tokugawa-Shōgunat baute die Verwaltung in Edo einen beeindruckenden bürokratischen Apparat mit 17 000 Beamten auf.
Das Tokugawa-Shōgunat herrschte über Provinz-Potentaten, sogenannte daimyō, die nach und nach immer mehr Unabhängigkeit erlangten. Auch hier ist die vertraute Dialektik zu beobachten: Die daimyō begannen als Nutznießer der Tokugawa-Herrschaft und Instrumente der Befehlsgewalt der Tokugawa in der Provinz, doch im Lauf der Zeit entzogen sie dem Zentrum Macht und häuften sie bei sich an. Als die daimyō unabhängiger wurden, fingen diese regionalen Potentaten an, ihre Gebiete als autonome Fürstentümer zu behandeln. Die ersten Tokugawa-Shōgune hatten die daimyō fest im Griff gehabt, doch im späten 17. Jahrhundert hatten die daimyō damit begonnen, sich wie kleine Shōgune aufzuführen, indem sie eigene Gesetzeskodizes und lokale Währungen herausgaben, Steuern verhängten und neue Verwaltungssysteme einführten, während sie sich gleichzeitig bemühten, nach außen den Schein der Loyalität zum Shōgunat zu wahren. Nach Ansicht einiger Historiker erklärte paradoxerweise eben diese zunehmende Beschränktheit der Herrschaft der Schogune die Langlebigkeit der Tokugawa-Dynastie. Mit der Meiji-Restauration (1868) schwang das Pendel wieder zurück in Richtung Konzentration. Der unblutige Staatsstreich gegen das Tokugawa-System hatte zum Ziel, den Dezentralisierungsprozess umzukehren und die zentrale Regierungsgewalt auf die 280 unabhängigen Herrschaftsgebiete der daimyō auszudehnen. Der Anspruch auf Legitimität wurde durch die Behauptung gewahrt, dass das neue Regime die zentrale Bedeutung und Autorität (allerdings nicht die politische Macht) des »himmlischen Herrschers« (tennō) wiederherstellen werde. Genau wie wiederholt in der europäischen Geschichte wurde ein Machttransfer mit dem Deckmantel der Kontinuität einer alten Tradition kaschiert.
Das Paradigma staatlicher Macht als Bestreben, eine mehr oder weniger homogene Form von Autorität auf ein abgegrenztes Gebiet zu projizieren, lässt sich nicht verallgemeinern. Beispielsweise wurde in Mexiko beobachtet, dass die Fähigkeit des Staates, Macht auszuüben, je nach Landschaft variierte: Hügel und Berge wurden mit »Wildnis, Gewalt und politischer Freiheit« assoziiert, während die Ebenen die Konnotationen »Fügsamkeit, Befriedung und Anfälligkeit für Repressionen« hatten. In den Staaten Südostasiens haben Historiker ein steiles Gefälle abnehmender Macht und Kontrolle vom Zentrum hin zur Peripherie des Staatsgebiets festgestellt; Grenzen waren relativ bedeutungslos, denn das Gemeinwesen konzentrierte sich in der Residenz oder »Hauptstadt«. Für die Vereinigten Staaten im 18. und 19. Jahrhundert basierte die These von der sogenannten »Frontier« auf der Prämisse, dass staatliche Macht nicht scharf umrissen war, sondern sich in dem Maß verlor, wie die Dichte der weißen Besiedlung abnahm.





























