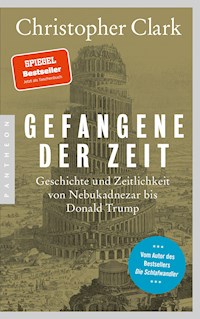18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Christopher Clarks fulminante Geschichte Preußens – ein brillant erzähltes Meisterwerk
Preußen stand stets in einem Spannungsfeld: seit seinem Aufstieg vom kleinen, an Bodenschätzen armen Territorium um Berlin bis zu seiner Blüte als der dominierenden Macht in Europa. Es verkörpert nicht nur Aufklärung und Toleranz, etwa in der Gestalt Friedrichs des Großen, sondern steht auch - vor allem durch Wilhelm II. - für Militarismus, Maßlosigkeit, Selbstüberschätzung.
Meisterhaft erzählt Christopher Clark die Geschichte Preußens von den Anfängen bis zur Auflösung des Staates im Jahr 1947. Mit seiner großen, 350 Jahre umfassenden Darstellung gelingt es Clark nicht nur, die äußerst ambivalente Geschichte dieser europäischen Großmacht lebendig und anschaulich zu schildern, sondern auch, sie von etlichen Mythen zu befreien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1570
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Für Nina
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Am 25. Februar 1947 unterzeichneten Vertreter der alliierten Besatzungsbehörden in Berlin ein Gesetz zur Auflösung des preußischen Staates. Von diesem Tage an gehörte Preußen der Geschichte an.
Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern, erlässt der Kontrollrat das folgende Gesetz:
ARTIKEL I
Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit aufgelöst.1
Das Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontrollrats war weit mehr als ein bloßer Verwaltungsakt. Indem sie Preußen von der europäischen Landkarte tilgten, fällten die alliierten Behörden zugleich ihr Urteil über dieses Land. Preußen war kein deutsches Land wie jedes andere, auf einer Stufe mit Baden, Württemberg, Bayern oder Sachsen. Preußen war der eigentliche Ursprung der deutschen »Krankheit«, die Europa ins Unglück gestürzt hatte. Preußen war der Grund, warum Deutschland den Pfad des Friedens und der politischen Moderne verlassen hatte. »Das Herz Deutschlands schlägt in Preußen«, sagte Churchill am 21. September 1943 im britischen Parlament. »Hier liegt der Ursprung jener Krankheit, die stets neu ausbricht.«2 Dass Preußen von der politischen Landkarte Europas verschwand, war daher zumindest symbolisch eine Notwendigkeit. Seine Geschichte war »zum Alb geworden, der auf dem Gehirne der Lebenden lastete«.
Dieses schmachvolle Ende lastet auf dem Gegenstand dieses Buches. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte man ein überwiegend positives Bild der preußischen Geschichte gezeichnet. Die protestantischen Historiker der »Preußischen Schule« feierten den preußischen Staat als Vehikel der effektiven Verwaltung und des Fortschritts, als Befreier des protestantischen Deutschlands von der österreichisch-habsburgischen und der französisch-napoleonischen Plage. Sie sahen den 1871 gegründeten, von Preußen dominierten Nationalstaat als den natürlichen, unvermeidlichen und bestmöglichen Endpunkt der historischen Entwicklung Deutschlands seit der Reformation.
Dieses rosarote Bild der preußischen Vergangenheit verblich nach 1945, als die Verbrechen des NS-Regimes ihren langen Schatten auf die deutsche Geschichte warfen. Der Nationalsozialismus sei kein Zufall gewesen, argumentierte der bekannte Historiker Ludwig Dehio, sondern »das akute Symptom eines chronischen [preußischen] Gebrechens«. Der Österreicher Adolf Hitler sei von seiner Mentalität her ein »Wahlpreuße« gewesen.3 Diese Deutung, derzufolge die deutsche Geschichte der Neuzeit vom »normalen« (d.h. britischen, amerikanischen oder westeuropäischen) Reifeprozess zu weitgehender Liberalität und politischer Stabilität abgewichen sei, fand immer mehr Anhänger. Während in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden die Macht der traditionellen Eliten und politischen Institutionen durch »bürgerliche Revolutionen« gebrochen worden sei, so die Begründung, sei dies in Deutschland nicht gelungen. Stattdessen sei Deutschland einem »Sonderweg« gefolgt, der in zwölf Jahren nationalsozialistischer Herrschaft gipfelte.
In diesem Szenario der politischen Fehlentwicklung kam Preußen eine Schlüsselrolle zu, denn hier waren die klassischen Kennzeichen des Sonderwegs am deutlichsten ausgeprägt. Das wichtigste dieser Kennzeichen war die ungebrochene Macht der Junker, jener adeligen Gutsbesitzer in den Gebieten östlich der Elbe, deren dominierende Stellung in der Verwaltung, im Militär und in der ländlichen Gesellschaft das europäische Zeitalter der Revolutionen unbeschadet überstanden hatte. Die Folgen für Preußen (und damit für Deutschland) waren, so schien es, verheerend: eine von Engstirnigkeit und Intoleranz geprägte politische Kultur, der Hang, Macht höher einzuschätzen als Recht und Gesetz, und eine ungebrochene militaristische Tradition. Im Zentrum fast aller Diagnosen des Sonderwegs stand der Gedanke einer einseitigen oder »unvollständigen« Modernisierung, bei der die Entwicklung der politischen Kultur mit den Innovationen und dem Wachstum im Bereich der Wirtschaft nicht Schritt gehalten habe. Dieser Lesart zufolge war Preußen der Fluch des neuzeitlichen Deutschlands und der europäischen Geschichte. Preußen habe dem jungen deutschen Nationalstaat den Stempel seiner eigenen politischen Kultur aufgedrückt, die liberalere politische Kultur Süddeutschlands beiseitegeschoben und so die Grundlagen für politischen Extremismus und ein diktatorisches Regime gelegt. Autoritarismus, Unterwürfigkeit und Gehorsam hätten zum Zusammenbruch der Demokratie geführt und der Diktatur den Weg geebnet.4
Dieser Paradigmenwechsel in der historischen Wahrnehmung stieß bei jenen Historikern, die den aufgelösten Staat zu rehabilitieren versuchten, auf energischen Widerspruch (vor allem in der Bundesrepublik, und vor allem bei Historikern, die liberal oder konservativ eingestellt waren). Sie betonten die positiven Errungenschaften Preußens – die unbestechliche Beamtenschaft, die Toleranz gegenüber religiösen Minderheiten, das von den anderen deutschen Staaten bewunderte und nachgeahmte preußische » Allgemeine Landrecht« von 1794, die im 19. Jahrhundert von keinem anderen Staat übertroffene Alphabetisierungsrate und die beispielhafte Effizienz der Bürokratie. Sie lenkten die Aufmerksamkeit auf die Dynamik der preußischen Aufklärung. Sie unterstrichen die Fähigkeit des preußischen Staates, sich in Krisenzeiten zu wandeln und neu zu konstituieren. Der politischen Unterwürfigkeit, immer wieder von den Anhängern des deutschen Sonderwegs in den Vordergrund gerückt, stellten sie bemerkenswerte Fälle von Ungehorsam gegenüber und betonten insbesondere die Rolle der preußischen Offiziere beim Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944. Das von ihnen gezeichnete Preußen war auch nicht frei von Fehlern, aber es hatte wenig mit dem Rassenstaat gemeinsam, den die Nationalsozialisten geschaffen hatten.5
Ihren Höhepunkt erreichten diese Bemühungen um eine Rehabilitation Preußens mit der großen Preußen-Ausstellung, die 1981 in West-Berlin gezeigt wurde und mehr als eine halbe Million Besucher anzog. Auf seinem Rundgang konnte der Betrachter mit Hilfe einer Vielzahl von Objekten und Texttafeln, die von einem internationalen Wissenschaftlerteam zusammengestellt worden waren, die Geschichte Preußens nach verfolgen. Neben militärischen Ausrüstungsgegenständen, Stammbäumen von Adelsfamilien, Darstellungen des höfischen Lebens und Bildern von historischen Schlachten gab es auch Räume zu den Themen »Toleranz«, »Emanzipation« und »Revolution«. Die Ausstellungsmacher wollten die Vergangenheit nicht in ein nostalgisches Licht tauchen (gleichwohl war vielen Kritikern auf der politischen Linken das Konzept definitiv zu wohlwollend), sondern abwechselnd Licht und Schatten zeigen und so eine »Bilanz« der preußischen Geschichte ziehen. Die Kommentare zu der Ausstellung – sowohl in den offiziellen Katalogen als auch in den Medien – beschäftigten sich vorrangig mit der Bedeutung Preußens im heutigen Deutschland. Ein Großteil der Diskussion kreiste um die Frage, welche Lehren aus der schwierigen Reise Preußens in die Moderne zu ziehen seien. Es sei notwendig, so war zu vernehmen, die »Tugenden« – wie Toleranz oder den uneigennützigen Dienst am Gemeinwohl – in Ehren zu halten und sich gleichzeitig von den weniger appetitlichen Eigenschaften in der preußischen Tradition zu lösen, etwa von autokratischen Einstellungen in der Politik oder der Tendenz, militärische Erfolge zu glorifizieren.6
Auch heute noch, über zwei Jahrzehnte später, scheiden sich an Preußen die Geister. Nach der Vereinigung Deutschlands 1990 und der Verlegung des Regierungssitzes vom katholisch geprägten Bonn im »Westen« in das protestantische Berlin im »Osten« kamen Bedenken auf, ob die Macht der preußischen Vergangenheit tatsächlich als »gezähmt« gelten könne. Würde der »altpreußische Geist« wiedererwachen und die deutsche Republik heimsuchen? Der Staat Preußen ist ausgelöscht, doch der Begriff »Preußen« als politisches Symbol hat eine gewisse Renaissance erlebt. Er ist zu einem Slogan der Rechten in Deutschland geworden, die in den »altpreußischen Traditionen« ein tugendhaftes Gegengewicht sehen zur »Orientierungslosigkeit«, dem »Werteverfall«, der »politischen Korruption« und dem Verlust einer kollektiven Identität im heutigen Deutschland.7 Für viele in Deutschland ist »Preußen« allerdings auch heute noch ein Synonym für alles Abstoßende in der deutschen Geschichte, für Militarismus, Eroberung, Arroganz und Intoleranz. Die Kontroverse über Preußen flackert immer dann wieder auf, wenn preußische Symbole ins Spiel kommen. Ereignisse wie die Umbettung der sterblichen Überreste Friedrichs des Großen in den Schlosspark von Sanssouci im August 1991 oder der Plan, das Berliner Stadtschloss der Hohenzollern wieder aufzubauen, führen immer wieder zu hitzigen öffentlichen Diskussionen.8
Im Februar 2002 wurde der Sozialdemokrat Alwin Ziel, bis dahin eher unauffälliger Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen in Brandenburg, schlagartig bekannt, als er sich in die Debatte um eine mögliche Zusammenlegung der Stadt Berlin mit dem Bundesland Brandenburg einschaltete. »Berlin-Brandenburg«, meinte er, sei ein ziemlich sperriger Begriff. Wie wäre es, wenn man das neue Bundesland »Preußen« nennen würde? Der Vorschlag schlug hohe Wellen. Kritische Stimmen warnten vor der Wiedergeburt Preußens, das Thema wurde landauf, landab in den Talkshows diskutiert, und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien eine Serie von Artikeln unter der Rubrik: »Darf Preußen sein?« Unter denen, die sich zu Wort meldeten, war auch Hans-Ulrich Wehler, einer der führenden Verfechter des deutschen Sonderwegs. Sein Artikel, in dem er den Vorschlag Ziels vehement zurückwies, war überschrieben mit »Preußen vergiftet uns«.9
Kein Versuch, die preußische Geschichte zu verstehen, kann sich dieser Debatte entziehen. Die Frage, inwieweit Preußen in die Katastrophen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert verwickelt war, muss Teil jeder Bewertung der Geschichte dieses Staates sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass man die Geschichte Preußens (oder irgendeines anderen Staates) ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Machtergreifung Hitlers betrachten muss. Ebenso wenig heißt es, dass man Preußen einzig nach ethischen Kategorien bewerten und pflichtbewusst das Gute loben und das Schlechte tadeln muss. Die stark polarisierten Urteile, die in zeitgenössischen Debatten (und in Teilen der geschichtswissenschaftlichen Literatur) immer wieder auftauchen, sind nicht nur deshalb problematisch, weil sie der wechselvollen preußischen Geschichte nicht gerecht werden, sondern weil sie diese Geschichte auf eine teleologische Betrachtungsweise der deutschen Schuld verkürzen. Die Wahrheit ist, dass Preußen ein europäischer Staat war, lange bevor es ein deutscher wurde. Deutschland – hier nehme ich eine der zentralen Thesen dieses Buches vorweg – war nicht die Erfüllung Preußens, sondern sein Verderben.
Aus diesem Grund habe ich gar nicht erst versucht, Laster und Tugenden Preußens herauszuarbeiten und sie gegeneinander abzuwägen. Ich habe nicht den Anspruch, irgendwelche »Lehren« in Form von moralischen oder politischen Ratschlägen für heutige oder zukünftige Generationen abzuleiten. Wer diese Seiten liest, wird weder dem rauen, kriegslüsternen Termitenstaat preußenfeindlicher Abhandlungen begegnen, noch der Lagerfeuerromantik der prussophilen Tradition. Als australischer Historiker, der im Cambridge des 21. Jahrhunderts arbeitet, bin ich glücklicherweise von der Verpflichtung (oder Versuchung) befreit, das historische Erbe Preußens zu beklagen oder zu feiern. Vielmehr stellt dieses Buch den Versuch dar, die Kräfte zu verstehen, die Preußen geformt und zerstört haben.
In jüngerer Zeit wird gerne betont, dass Nationen und Staaten keine naturgegebenen Phänomene sind, sondern mehr oder weniger zufällig entstandene, künstliche Schöpfungen. Man sagt, dass sie erfundene bzw. konstruierte Gebilde sind, mit einer kollektiven Identität, die durch bewusste Willensakte »geschmiedet« wird.10 Kein neuzeitlicher Staat ist besser geeignet, diese Sichtweise zu untermauern, als Preußen. Preußen war eine Ansammlung disparater, weit verstreuter Gebiete ohne natürliche Grenzen, die weder durch eine gemeinsame Kultur verbunden waren, noch durch ihren Dialekt oder ihre Küche. Diese ungünstige Ausgangslage wurde dadurch noch verschärft, dass im Rahmen der territorialen Expansion in unbestimmten Abständen immer wieder neue Bevölkerungsgruppen integriert werden mussten, deren Loyalität zum preußischen Staat nur durch einen langwierigen Assimilationsprozess gewonnen werden konnte – wenn überhaupt. Die Schaffung »preußischer« Untertanen war ein langwieriger Prozess, der immer wieder ins Stocken geriet. Als Preußen sein formales Ende ereilte, hatte dieser Prozess längst an Schwung verloren. Die Bezeichnung »Preußen« selbst hatte ja immer etwas Gezwungenes, weil sie nicht vom Kernland der Hohenzollerndynastie abgeleitet war (der Mark Brandenburg rings um Berlin), sondern von der östlichsten Provinz des Herrschaftsgebiets der Hohenzollern, einem Herzogtum an der Ostsee, das mit den übrigen Territorien gar nicht verbunden war. »Preußen« war sozusagen das Logo, das sich die brandenburgischen Kurfürsten zulegten, nachdem sie 1701 zu Königen aufgestiegen waren. Der eigentliche Kern, die eigentliche Essenz der preußischen Tradition war das Fehlen einer Tradition. Wie diesem abstrakten, leblosen Staatsgebilde Leben eingehaucht wurde, wie es sich von einer Ansammlung schablonenhafter Fürstentitel zu einem lebendigen Ganzen entwickelte, und wie es ihm gelang, die Loyalität seiner Untertanen zu gewinnen – diese Fragen stehen in diesem Buch im Zentrum des Interesses.
Im allgemeinen Sprachgebrauch steht »preußisch« noch heute für eine ganz bestimmte Art von autoritärer Planmäßigkeit, und daher ist die Versuchung groß, sich die preußische Geschichte als detailliert ausgearbeiteten Plan vorzustellen, nach dem die Hohenzollern die Macht des Staates immer weiter ausgedehnt, ihr Herrschaftsgebiet erweitert, neue Besitzungen eingegliedert und den regionalen Adel zurückgedrängt haben. In diesem Szenario erhebt sich der Staat aus dem Chaos und der Dunkelheit des Mittelalters, durchtrennt Traditionsstränge und errichtet eine rationale, allumfassende Ordnung. Dieses Buch will dieses Bild ins Wanken bringen. Es möchte dem Leser einen Zugang zur preußischen Geschichte eröffnen, in dem Ordnung und Unordnung gleichermaßen ihren Platz haben. Die Erfahrung des Krieges, der schrecklichsten Form der Unordnung, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte preußische Geschichte. Sie hat den Staatsbildungsprozess auf komplexe Weise beeinflusst, ihn mal beschleunigt, mal gebremst. Was die Konsolidierung des Staates im Inneren betrifft, so stellt sich diese als planloser, improvisierter Prozess dar, der sich in einem dynamischen, mitunter instabilen sozialen Umfeld vollzogen hat. Manchmal war »Verwaltung« ein anderes Wort für kontrollierte Umwälzungen. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gab es viele preußische Gebiete, in denen das Vorhandensein des Staates kaum spürbar war.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass man »den Staat« an den Rand der preußischen Geschichte drängen sollte. Man sollte ihn vielmehr als Produkt der politischen Kultur betrachten, als Spiegelbild des kollektiven Bewusstseins. Es gehört zu den bemerkenswerten Kennzeichen der intellektuellen Entwicklung Preußens, dass der Gedanke einer eigenen preußischen Geschichte stets aufs Engste verwoben war mit der Betonung der Legitimität und Notwendigkeit des Staates. Der Große Kurfürst zum Beispiel war Mitte des 17. Jahrhunderts der Ansicht, dass die Konzentration der politischen Macht in der Exekutive des monarchischen Staates die beste Sicherheit gegen Angriffe von außen garantiere. Doch dieses Argument – das von Historikern gelegentlich unter der Rubrik »Primat der Außenpolitik« aufgegriffen wird – war selbst Teil der Evolution des preußischen Staates. Es war eines der rhetorischen Mittel, mit denen der Fürst seinen Machtanspruch als Landesherr untermauerte.
Anders ausgedrückt: Die Geschichte des preußischen Staates ist zugleich die Geschichte der Geschichte des preußischen Staates, denn der preußische Staat erfand seine Geschichte sozusagen erst beim Erzählen und entwickelte nach und nach eine immer ausgefeiltere Darstellung seines bisherigen Werdegangs und seiner Ziele in der Gegenwart. Im frühen 19. Jahrhundert führte die Notwendigkeit, angesichts der Herausforderung durch die Französische Revolution die preußische Regierungsform zu rechtfertigen, zu einer einzigartigen Eskalation im Diskurs. Der preußischen Staat legitimierte sich als Träger des historischen Fortschritts und bediente sich dabei eines derart überschwänglichen Vokabulars, dass er zum Modellfall einer bestimmten Ausprägung der Moderne wurde. Doch die Autorität und Erhabenheit des Staates in den Köpfen gebildeter Zeitgenossen hatte wenig mit der tatsächlichen Bedeutung zu tun, die er für das Leben der breiten Mehrheit der Untertanen hatte.
Zwischen dem bescheidenen territorialen Erbe Preußens und seiner herausgehobenen Position im Gang der Geschichte besteht ein auffälliger Kontrast. Besucher in Brandenburg, dem historischen Kernland des preußischen Staates, waren seit jeher überrascht angesichts der Spärlichkeit seiner Ressourcen und der Provinzialität seiner verschlafenen Städte. Was sie vorfanden, deutete nicht gerade auf den außergewöhnlichen historischen Aufstieg Brandenburgs hin – ganz zu schweigen davon, dass es ihn erklärt hätte. »Jemand müsste etwas darüber schreiben, was da gerade geschieht«, schrieb Voltaire zu Beginn des Siebenjährigen Krieges (1756–1763), in dem sein Freund Friedrich der Große sich gegen die vereinten Kräfte Frankreichs, Russlands und Österreichs behaupten musste. »Es wäre von einigem Nutzen, wenn man erklären könnte, wie es dazu kam, dass das sandige Land Brandenburg so mächtig geworden ist, dass man mehr Streitkräfte gegen Brandenburg mobilisiert hat als jemals gegen Ludwig XIV.«11 Die offensichtliche Diskrepanz zwischen der militärischen Stärke des preußischen Staates und den spärlichen Ressourcen, die zu ihrer Aufrechterhaltung zur Verfügung standen, erklärt einen der seltsamsten Wesenszüge der Geschichte Preußens als europäische Macht, nämlich die Tatsache, dass sich Phasen frühreifer Stärke mit Phasen gefährlicher Schwäche abwechselten. Im öffentlichen Bewusstsein ist Preußen mit der Erinnerung an militärische Erfolge verbunden: Roßbach, Leuthen, Leipzig, Waterloo, Königgrätz, Sedan. Doch im Laufe seiner Geschichte stand Preußen mehrmals am Rande seiner politischen Auslöschung: während des Dreißigjährigen Krieges, während des Siebenjährigen Krieges, und noch einmal 1806, als Napoleon die preußische Armee vernichtete und den König zur Flucht durch halb Nordeuropa zwang, bis ins Memelgebiet im äußersten Osten seines Königreiches. Zeiten der Aufrüstung und der militärischen Konsolidierung wurden immer wieder von langen Phasen der schrumpfenden Ressourcen und des Niedergangs unterbrochen. Die Kehrseite des unerwarteten preußischen Aufstiegs war ein bleibendes Gefühl der Verwundbarkeit, das die politische Kultur Preußens zutiefst geprägt hat.
Dieses Buch beschreibt, wie Preußen entstanden ist und wie es unterging. Nur wenn man diese beiden Prozesse versteht, wird nachvollziehbar, warum ein Staat, der einst in den Köpfen so vieler Menschen einen so bedeutenden Platz eingenommen hat, ebenso restlos wie abrupt von der politischen Bühne verschwinden konnte, ohne dass ihm jemand eine Träne nachgeweint hätte.
Eine Geschichte von Brandenburg – Preußen in 6 Karten
1
Die brandenburgischen Hohenzollern
Das Kernland
Am Anfang war Brandenburg. Rings um Berlin erstreckte sich auf etwa 40.000 Quadratkilometern das Kernland jenes Staates, der später unter dem Namen Preußen in die Geschichte eingehen sollte.
Die Landschaft Brandenburgs war Teil der trostlosen Ebene, die sich von den Niederlanden bis zum Norden Polens erstreckte, eine Gegend ohne besondere Kennzeichen, die kaum je Besucher anlockte. Ihren Flüssen, die sich träge dahinschlängelten, fehlte die Erhabenheit des Rheins oder der Donau, ein Großteil der Fläche war von eintönigen Wäldern aus Birken und Föhren bedeckt. Der Verfasser einer frühen Beschreibung Brandenburgs, der Topograf Nicolaus Leuthinger, schrieb 1598 von einem »ebenen, bewaldeten Land mit vielen Sümpfen«. Sand, Ebene, Sümpfe und unkultivierte Flächen sind immer wiederkehrende Begriffe in allen frühen Berichten, selbst in den wohlwollendsten.1
Die Böden waren in weiten Teilen Brandenburgs von nur geringer Qualität. In einigen Gebieten, vor allem rings um Berlin, war der Boden so sandig und locker, dass nicht einmal Bäume wuchsen. In dieser Hinsicht änderte sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts wenig. Ein Engländer, der sich im Hochsommer Berlin von Süden her näherte, berichtete von »ganzen Gegenden voller blankem, heißem Sand; dazwischen hier und da ein Dorf und Wälder aus verkümmerten Föhren, die auf ausgebleichten, dicht von Rentiermoos bedeckten Böden stehen«.2
Metternich wird der Ausspruch zugeschrieben, Italien sei ein »geografischer Begriff«. Von Brandenburg ließ sich nicht einmal das behaupten. Es war ein Binnenstaat ohne natürliche Grenzen, die man hätte verteidigen können, ein rein politisches Gebilde aus Landstrichen, die man im Mittelalter heidnischen Slawen abgetrotzt hatte und in denen Einwanderer aus zahlreichen deutschsprachigen Gebieten, sowie aus Frankreich, den Niederlanden, Norditalien und England siedelten. Nach und nach verlor sich das slawische Erbe, aber bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gab es in den Dörfern des Spreewalds bei Berlin Enklaven mit Slawisch sprechenden Einwohnern, den Wenden. Der Grenzlandcharakter der Region, ihre Rolle als östliche Grenze der Besiedlung durch deutschsprachige Christen, fand ihren semantischen Niederschlag in der Bezeichnung »Mark«, die sowohl für Brandenburg insgesamt verwendet wurde, als auch für vier der fünf Teilgebiete: die Mittelmark um Berlin, die Altmark im Westen, die Uckermark im Norden und die Neumark im Osten (das fünfte Gebiet war die Prignitz im Nordwesten).
Die Voraussetzungen für den Warentransport waren primitiv. Brandenburg hatte keinen Zugang zum Meer und damit auch keinen Seehafen. Zwischen Elbe und Oder, die an der westlichen bzw. östlichen Flanke der Mark Richtung Nord- bzw. Ostsee flossen, gab es keine Wasserstraße, sodass die Residenzstädte Berlin und Potsdam nicht an die wichtigsten Transportwege der Region angebunden waren. Im Jahr 1548 hatte man mit dem Bau eines Kanals begonnen, der die Spree, die durch Berlin und ihre Schwesterstadt Cölln floss, mit der Oder verbinden sollte. Das Vorhaben erwies sich jedoch als zu teuer und wurde aufgegeben. Da in jener Zeit der Transport zu Lande sehr viel teurer war als zu Wasser, war der Mangel an schiffbaren Wasserwegen in West-Ost-Richtung ein schwerwiegendes Strukturdefizit.
Hochwertige landwirtschaftliche Produkte (Wein, Krapp, Flachs, Barchent, Wolle und Seide), wie sie in anderen deutschen Gebieten hergestellt wurden, suchte man in Brandenburg vergebens, und die Vorkommen der damals wichtigsten Erze (Silber, Kupfer, Eisen, Zink und Zinn) waren gering.3 Das wichtigste Zentrum der Metallverarbeitung war ein Eisenhüttenwerk, das in den 1550er Jahren in der befestigten Stadt Peitz errichtet worden war. Auf einer zeitgenössischen Darstellung sind solide Gebäude zu sehen, die zwischen schnell fließenden künstlichen Wasserwegen liegen. Die schweren Hämmer, die das Metall flachschlugen und formten, wurden von einem großen Wasserrad angetrieben. Für den Kurfürsten hatte diese Eisenhütte eine gewisse Bedeutung, waren seine Garnisonen doch auf Munition aus Peitz angewiesen, aber darüber hinaus war ihr wirtschaftlicher Nutzen gering. Das dort produzierte Eisen war bei Frost wenig bruchfest. Brandenburg war also auf dem regionalen Markt nicht konkurrenzfähig, und ohne Förderung durch den Staat in Form von Aufträgen und Einfuhrbeschränkungen wäre das zarte Pflänzchen eines metallverarbeitenden Sektors nicht lebensfähig gewesen.4 Brandenburg konnte sich in keiner Weise mit den florierenden Gießereien messen, die weiter südöstlich im erzreichen Kurfürstentum Sachsen lagen. Ebenso wenig war es im Hinblick auf die Waffenproduktion so autark wie Schweden, das sich im frühen 17. Jahrhundert als Regionalmacht etablieren konnte.
Frühe Berichte über die landwirtschaftliche Topografie in Brandenburg vermitteln einen zwiespältigen Eindruck. Die in weiten Landesteilen schlechte Bodenqualität führte zu niedrigen Erträgen. In manchen Gegenden war der Boden so schnell ausgelaugt, dass man nur alle sechs, neun oder zwölf Jahre aussäen konnte, ganz zu schweigen von den Landstrichen mit »unfruchtbarem Sandboden« oder Sumpfland, in denen gar nichts angebaut werden konnte.5 Andererseits gab es auch Gebiete – vor allem in der Alt- und Uckermark und im fruchtbaren Havelland westlich von Berlin –, die über genügend Ackerland verfügten, auf dem intensiver Getreideanbau möglich war. Hier gab es um 1600 deutliche Anzeichen von wirtschaftlicher Prosperität. Begünstigt vom langen Aufschwung, den Europa im 16. Jahrhundert erlebte, konnten die Grundbesitzer des brandenburgischen Adels ansehnliche Vermögen anhäufen, indem sie Getreide für den Export produzierten. Zeugnis von diesem Reichtum legten nicht nur die prunkvollen Renaissancehäuser ab, die sich wohlhabende Familien bauen ließen – von denen allerdings kaum eines erhalten ist –, sondern auch die zunehmende Bereitschaft, Söhne zum Studieren ins Ausland zu schicken, sowie der drastische Anstieg der Grundpreise. Ein weiteres Zeichen der wirtschaftlichen Blüte im 16. Jahrhundert waren die Wellen deutscher Einwanderer aus Franken, den sächsischen Fürstentümern, Schlesien und dem Rheinland, die sich auf leer stehenden Höfen niederließen.
Doch selbst die Profite der erfolgreichsten Grundbesitzer haben allenfalls auf lokaler Ebene zu Produktionssteigerungen geführt. Gesamtwirtschaftlich haben sie sich kaum ausgewirkt.6 Wegen der in Brandenburg weit verbreiteten Gutsherrschaft wurden nicht so viele Arbeitskräfte freigesetzt und die Kaufkraft nicht so sehr gesteigert, dass die Stadtentwicklung ähnlich vorangetrieben worden wäre wie im Westen Europas. Die Städte entwickelten sich zwar auch hier zu Verwaltungszentren, aber sie blieben deutlich kleiner als anderswo. Handwerk und Handel hatten lediglich lokale Bedeutung. Bei Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618 wohnten in der Hauptstadt, einem Doppelort, der damals Berlin-Cölln genannt wurde, nicht mehr als 10.000 Menschen – die Stammbevölkerung der Stadt London lag zu dieser Zeit bei etwa 130.000.
Die Dynastie
Wie kam es, dass dieses nicht gerade vielversprechende Territorium zum Kernland eines mächtigen europäischen Staates wurde? Der Schlüssel lag nicht zuletzt in der Umsicht und dem Ehrgeiz der herrschenden Dynastie. Die Hohenzollern waren eine aufstrebende Adelsfamilie süddeutscher Magnaten. Friedrich von Hohenzollern, Burggraf des kleinen, aber reichen Territoriums Nürnberg, erhielt Brandenburg im Jahr 1415 vom damaligen Landesherren, Kaiser Sigismund, zum erblichen Besitz als Dank für seine Unterstützung bei der Bewerbung um die römische Königskrone. Dieses Geschäft brachte ihm nicht nur Land ein, sondern auch einen Prestigegewinn, war Brandenburg doch eines von sieben Kurfürstentümern des Heiligen Römischen Reiches, eines Flickenteppichs aus Klein- und Kleinststaaten, der sich über den deutschsprachigen Teil Europas erstreckte. Indem Friedrich I. den Titel eines Kurfürsten von Brandenburg erwarb, übernahm er eine wichtige Funktion in einem politischen Gebilde, das heute vollständig von der europäischen Landkarte verschwunden ist: Das »Heilige Römische Reich Deutscher Nation« war im Wesentlichen ein Überbleibsel aus dem Mittelalter und fußte auf der christlichen Universalmonarchie, dem Prinzip der Herrschaftsteilung und gemeinsamen Privilegien der Fürsten. Es war kein »Reich« im modernen Sinn, in dem ein Territorium anderen ein Herrschaftssystem aufoktroyiert, sondern ein loser Verband mit dem kaiserlichen Hof als Zentrum, der durch verfassungsrechtliche Regelungen zusammengehalten wurde. Es umfasste über 300 souveräne Territorien, die sich in ihrer Größe und ihrem rechtlichen Status stark unterschieden.7 Neben Deutschen gehörten an den Rändern des deutschsprachigen Europas auch Französisch sprechende Wallonen, niederländische Flamen, Dänen, Tschechen, Slowaken, Slowenen, Kroaten und Italiener zu den Untertanen des Reiches.
Das wichtigste politische Organ war der Reichstag. Hier versammelten sich die Gesandten der »Reichsstände«, aus denen sich das Reich zusammensetzte: Fürstentümer, Bistümer, Klöster, Grafschaften und freie Reichsstädte – weitgehend unabhängige Kleinststaaten.
An der Spitze dieser buntscheckigen politischen Landschaft stand der römisch-deutsche König, der von den Kurfürsten gewählt wurde. Dieser war zugleich Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Theoretisch hätte also jeder Kandidat aus einer wahlberechtigten Dynastie dieses Amt übernehmen können. In der Praxis fiel die Wahl vom Ende des Mittelalters bis zur offiziellen Auflösung des Reiches 1806 fast immer auf den ältesten männlichen Habsburger.8 Seit den 1520er Jahren, nach einer Kette vorteilhafter Heiraten und glücklicher Erbfälle (vor allem in Böhmen und Ungarn), waren die Habsburger die mit Abstand reichste und mächtigste deutsche Dynastie. Zu den Besitzungen der böhmischen Krone gehörten das erzreiche Herzogtum Schlesien und die Markgrafschaften Ober- und Niederlausitz, wichtige wirtschaftliche Zentren. Der Habsburger Hof kontrollierte eine beeindruckende Ansammlung von Territorien, die von den westlichen Randgebieten Ungarns bis an die südliche Grenze Brandenburgs reichte.
Durch ihren Aufstieg zu Kurfürsten von Brandenburg gehörten die fränkischen Hohenzollern also einer kleinen Elite deutscher Fürsten an – insgesamt gab es nur sieben Kurfürsten –, die das Recht hatten, den deutschen König und damit Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu wählen. Der Titel eines Kurfürsten brachte gewaltige Vorteile mit sich. Er war das Symbol für eine herausgehobene Stellung, die ihren Ausdruck nicht nur in den dynastischen Insignien fand, sondern auch im aufwändigen Zeremoniell, das sämtliche offiziellen Anlässe des Reiches begleitete. Er ermöglichte es den Fürsten von Brandenburg, ihre Kurstimme regelmäßig gegen politische Konzessionen oder Geschenke des Kaisers einzutauschen. Solche Gelegenheiten ergaben sich nicht nur bei jeder Wahl, sondern immer dann, wenn der jeweilige König darauf bedacht war, schon im Vorfeld die Unterstützung für seinen Nachfolger zu sichern.
Die Hohenzollern arbeiteten intensiv daran, ihren Herrschaftsbereich zu konsolidieren und auszubauen. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts hinein gab es in der Regierungszeit fast jedes Kurfürsten bedeutende territoriale Zugewinne. Außerdem gelang es den Hohenzollern im Gegensatz zu einigen anderen Adelsfamilien in der Region, eine Teilung ihres Landbesitzes zu vermeiden. Die Unteilbarkeit Brandenburgs wurde durch die so genannte Dispositio Achillea gesichert, das Erbfolgegesetz von 1473. Zwar setzte sich Joachim I. Nestor (reg. 1499–1535) über dieses Gesetz hinweg und ordnete an, dass das Land nach seinem Tod zwischen seinen beiden Söhnen aufgeteilt werden sollte, aber der jüngere Sohn starb 1571 ohne Nachkommen, sodass die Einheit der Mark wiederhergestellt war. Kurfürst Johann Georg (reg. 1571–1598) schlug in seinem politischen Testament eine neuerliche Teilung der Mark zwischen seinen Söhnen aus mehreren Ehen vor. Sein Nachfolger, Kurfürst Joachim Friedrich (reg. 1598–1608), konnte nur deshalb das brandenburgische Erbe zusammenhalten, weil die südliche, fränkische Linie der Familie ausstarb. Dadurch konnte er seine jüngeren Brüder mit Ländereien außerhalb des brandenburgischen Herrschaftsbereiches entschädigen. Diese Beispiele machen deutlich, dass sich die Hohenzollern im 16. Jahrhundert noch nicht als Landesherren sahen, sondern sich nach wie vor wie Familienvorstände verhielten. Zwar gab es auch nach 1596 die Versuchung, das Wohl der Familie obenan zu stellen, aber sie war nicht mehr stark genug, um die territoriale Integrität des Landes zu gefährden. Während die Territorien anderer Dynastien in dieser Zeit von Generation zu Generation in immer kleinere Staaten zerfielen, blieb Brandenburg intakt.9
Der Kaiser aus dem Hause Habsburg nahm auf der politischen Landkarte der Kurfürsten aus dem Hause Hohenzollern eine herausgehobene Position ein. Er war ein mächtiger Fürst von europäischem Rang und zugleich der symbolische Grundpfeiler und Garant des Reiches, dessen tradierte Verfassung die Grundlage aller Herrschaftsausübung im deutschsprachigen Teil Europas war. Der Respekt vor seiner Machtstellung war zugleich Zeichen einer tiefen Verbundenheit mit der politischen Ordnung, die er verkörperte. Das bedeutete jedoch keineswegs, dass der Kaiser die Politik im Reich eigenmächtig bestimmen oder kontrollieren konnte. Es gab keine kaiserliche Zentralregierung, kein kaiserliches Recht der Steuererhebung, kein stehendes Heer und keine Reichspolizei. Wollte der Kaiser das Reich nach seinem Willen lenken, so kam er nicht umhin, mit den Territorialfürsten zu verhandeln, zu feilschen und geschickt zu taktieren. Bei aller Kontinuität mit der mittelalterlichen Vergangenheit war das Heilige Römische Reich ein hochflexibles und dynamisches System, das von einer prekären Machtbalance geprägt war.
Die Reformation
In den 1520er und 1530er Jahren brachten die von der Reformation freigesetzten Kräfte dieses komplexe System aus dem Gleichgewicht. Eine einflussreiche Gruppe von Territorialfürsten und etwa zwei Fünftel der freien Reichsstädte traten zum Luthertum über. Doch der habsburgische Kaiser war fest entschlossen, die katholische Ausrichtung des Römischen Reiches zu sichern und seine kaiserliche Machtstellung zu konsolidieren. Karl V. schmiedete eine Allianz gegen die Lutheraner, und im Schmalkaldischen Krieg von 1546/47 konnten diese Truppen eine Reihe bedeutender Siege erringen. Allerdings führte die Aussicht auf einen weiteren habsburgischen Machtzuwachs dazu, dass sich die Gegner der Dynastie innerhalb wie außerhalb des Reiches zusammenschlossen. Anfang der 1550er Jahre begann Frankreich, das stets darauf bedacht war, die Pläne der Habsburger zu durchkreuzen, die protestantischen deutschen Gebiete militärisch zu unterstützen. Die so entstandene Pattsituation hatte den Kompromiss zur Folge, der 1555 auf dem Reichstag in Augsburg erzielt wurde. Im Augsburger Religionsfrieden wurde die Existenz lutherischer Gebiete im Reich formell anerkannt und den lutherischen Landesfürsten das Recht zugestanden, für eine einheitliche Konfession ihrer Untertanen zu sorgen.
Während dieser Umwälzungen verfolgten die brandenburgischen Hohenzollern eine neutrale und umsichtige Politik. Weil sie es sich mit dem Kaiser nicht verscherzen wollten, wandten sie sich nur zögernd dem lutherischen Glauben zu. Nachdem sie offiziell übergetreten waren, führten sie die Reformation in ihrem Territorium so langsam und vorsichtig ein, dass sie erst Ende des 16. Jahrhunderts abgeschlossen war. Kurfürst Joachim I. Nestor von Brandenburg (reg. 1499–1535) wollte, dass seine Söhne katholisch blieben, aber 1527 nahm seine Frau Elisabeth von Dänemark die Sache selbst in die Hand und trat zum Luthertum über. Anschließend floh sie nach Sachsen, wo sie sich dem Schutz des protestantischen Kurfürsten Johann unterstellte.10 Der nächste Kurfürst, Joachim II. Hektor (reg. 1535–1571), war zwar noch katholisch, als er den brandenburgischen Thron bestieg, folgte aber dem Beispiel seiner Mutter und konvertierte zum Luthertum. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass der Ehefrau eines brandenburgischen Herrschers in Fragen der Konfessionspolitik eine entscheidende Rolle zukam.
Abb 1
1. Lucas Cranach d. J., Kurfürst Joachim II. (reg. 1535–1571), gemalt um 1551.
Bei aller persönlichen Sympathie für die Ziele der religiösen Reformbewegung zögerte Joachim II., seinen Untertanen offiziell den neuen Glauben vorzuschreiben. Er hing nach wie vor an der alten Liturgie und den prunkvollen katholischen Ritualen. Außerdem wollte er alles vermeiden, was die Stellung Brandenburgs im Gefüge des immer noch mehrheitlich katholischen Reiches gefährden konnte. Lucas Cranach der Jüngere hat um 1551 beide Seiten dieses Herrschers in einem Porträt eingefangen. Vor uns steht eine imposante, breite Gestalt mit geballten Fäusten, prunkvoll gekleidet im edelsteinbesetzten Gewand jener Tage. Seine Züge zeugen von Wachsamkeit. Aus einem eckigen Gesicht wirft er uns einen misstrauischen Blick zu.
In den großen politischen Kämpfen des Reiches wuchs Brandenburg mehr und mehr die Rolle des Vermittlers und ehrlichen Maklers zu. Gesandte des Kurfürsten waren an mehreren Versuchen beteiligt, einen Kompromiss zwischen dem protestantischen und dem katholischen Lager zu finden. Joachim ging gegenüber den Falken unter den protestantischen Fürsten auf Distanz und entsandte sogar ein kleines Kontingent berittener Truppen, um den Kaiser im Schmalkaldischen Krieg zu unterstützen. Erst 1563, in den vergleichsweise ruhigen Jahren nach dem Augsburger Religionsfrieden, verlieh Joachim seiner Zuneigung zur neuen Religion formell Ausdruck und bezeugte öffentlich seinen Glauben.
Eine deutlich lutherische Prägung erfuhren die brandenburgischen Lande dann erst unter Kurfürst Johann Georg (reg. 1571–1598), dem Sohn Joachims II.: Lehrstühle an der Universität in Frankfurt an der Oder wurden mit orthodoxen Lutheranern besetzt, die Kirchenordnung von 1540 wurde grundlegend überarbeitet, damit sie in jeder Hinsicht lutherischen Prinzipien entsprach, und zwischen 1573 und 1581 sowie 1594 wurde in zahlreichen Visitationen sichergestellt, dass der Wechsel zum Luthertum auf lokaler Ebene auch umgesetzt wurde. In der Reichspolitik dagegen unterstützte Johann Georg weiterhin loyal den habsburgischen Kaiser. Selbst Kurfürst Joachim Friedrich (reg. 1598–1608), der als junger Mann das katholische Lager gegen sich aufgebracht hatte, indem er offen die protestantische Sache unterstützte, wurde vorsichtiger, nachdem er Kurfürst geworden war. Er hielt sich von den diversen protestantischen Allianzen fern, die dem kaiserlichen Hof religiöse Zugeständnisse abringen wollten.11
Die brandenburgischen Kurfürsten handelten sehr umsichtig, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht ehrgeizig gewesen wären. Für einen Staat, der weder über natürliche Grenzen verfügte noch über die nötigen Ressourcen, um seine Ziele gewaltsam durchzusetzen, war Heiratspolitik das bevorzugte Instrument. Wenn man sich die Hochzeiten der Hohenzollern im 16. Jahrhundert ansieht, dann sticht ins Auge, auf welch breiter Front sie vorgegangen sind: 1502 und noch einmal 1523 kam es zu Verbindungen mit dem dänischen Herrscherhaus. Der Kurfürst hoffte (allerdings vergeblich), auf diese Weise einen Anspruch auf Teile der Herzogtümer Schleswig und Holstein und damit einen Zugang zur Ostsee zu erwerben. Im Jahr 1530 verheiratete er seine Tochter Margarete mit dem Herzog von Pommern, Georg I., in der Hoffnung, dass Brandenburg eines Tages das Erbe dieses Herzogtums zufallen würde, das ebenfalls an die Ostsee grenzte. Eine weitere Figur, der bei den brandenburgischen Planspielen eine wichtige Rolle zukam, war der König von Polen. Dieser war der Lehnsherr des Herzogtums Preußen, eines Fürstentums an der Ostsee, das vor der Säkularisation des Ordensstaates 1525 vom Deutschen Orden kontrolliert worden war und seitdem von Herzog Albrecht von Brandenburg-Ansbach regiert wurde, einem Hohenzollern und Cousin des Herzogs von Brandenburg.
Nach diesem attraktiven Gebiet streckte Kurfürst Joachim II. seine Hand aus, als er 1535 Prinzessin Hedwig von Polen heiratete. Als 1564 der Bruder seiner Frau auf dem polnischen Thron saß, konnte Joachim durchsetzen, dass seine beiden Söhne zu Miterben des Herzogtums eingesetzt wurden. Vier Jahre später, nach dem Tod von Herzog Albrecht, wurde dieser Status auf dem polnischen Reichstag in Lublin bestätigt. Dadurch bestand für Brandenburg die Aussicht, das Erbe im Herzogtum anzutreten, falls der neue Herzog, der 15-jährige Albrecht Friedrich, ohne männliche Nachkommen sterben sollte. Wie es der Zufall wollte, ging die Rechnung auf: Albrecht Friedrich lebte weitere 50 Jahre, bei schlechter geistiger Verfassung, aber guter körperlicher Gesundheit. Als er 1618 starb, hinterließ er zwei Töchter, aber keine Söhne.
In der Zwischenzeit ließen die Hohenzollern keine Gelegenheit aus, ihren Anspruch auf das Herzogtum Preußen mit allen möglichen Mitteln zu bekräftigen. Die Söhne machten dort weiter, wo die Väter aufgehört hatten. Im Jahr 1603 konnte Kurfürst Joachim Friedrich den polnischen König überreden, ihm die Regentschaft über das Herzogtum zu übertragen (was aufgrund des instabilen Geisteszustands des Herzogs nötig war). Bereits vorher hatte sein Sohn Johann Sigismund die Verbindungen mit dem Herzogtum Preußen weiter ausgebaut, indem er 1594 die älteste Tochter Herzog Albrecht Friedrichs, Anna von Preußen, geheiratet hatte, trotz der Warnung ihrer Mutter, sie sei »keine der Schönsten«.12 Schließlich heiratete der Vater, Joachim Friedrich, nach dem Tode seiner ersten Frau die jüngere Schwester der Ehefrau seines Sohnes – vermutlich, um eine andere Familie daran zu hindern, Erbansprüche zu erwerben. Der Vater war nunmehr der Schwager seines Sohnes, und Annas jüngere Schwester war zugleich ihre Schwiegermutter.
Der Antritt des preußischen Erbes schien damit gesichert. Die Ehe zwischen Johann Sigismund und Anna eröffnete jedoch darüber hinaus die Aussicht auf eine weitere lukrative Erbschaft im Westen. Anna war nicht nur die Tochter des Herzogs von Preußen, sondern auch die Nichte eines weiteren geisteskranken deutschen Herzogs, Johann Wilhelms von Jülich-Kleve, dessen Besitzungen neben den rheinischen Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg die Grafschaften Mark und Ravensberg umfassten. Annas Mutter, Maria Eleonora, war die älteste Schwester Johann Wilhelms. Die Verwandtschaft mütterlicherseits hätte nur wenig gegolten, wenn es im Hause Jülich-Kleve nicht einen Vertrag gegeben hätte, wonach Besitz und Titel der Familie über die weibliche Linie vererbt werden konnten. Durch dieses ungewöhnliche Arrangement wurde Anna von Preußen zur Erbin ihres Onkels, sodass ihr Mann, Johann Sigismund von Brandenburg, Anspruch auf die Gebiete von Jülich-Kleve erheben konnte.13 Dieser Fall veranschaulicht wie kein anderer die Irrungen und Wirrungen des Heiratsmarktes im Europa der Frühen Neuzeit, der geprägt war von rücksichtslosen Intrigen über die Generationen hinweg. Gleichzeitig macht er deutlich, welche Rolle in dieser entscheidenden Phase der Geschichte Brandenburgs der Heiratspolitik zukam.
Große Erwartungen
Die Perspektiven, die sich den Kurfürsten von Brandenburg an der Wende zum 17. Jahrhundert boten, waren ebenso berauschend wie beunruhigend. Weder das Herzogtum Preußen noch die verstreut liegenden Herzogtümer und Grafschaften des jülich-klevischen Erbes grenzten an die Mark Brandenburg. Letztere lagen an der Westgrenze des Heiligen Römischen Reiches, auf Tuchfühlung mit den Spanischen Niederlanden und der Republik der Vereinigten Niederlande. Es handelte sich um ein Konglomerat konfessionell gemischter Gebiete in einer der am stärksten urbanisierten und industrialisierten Regionen Europas. Das lutherische Herzogtum Preußen war ungefähr so groß wie Brandenburg und lag östlich des Heiligen Römischen Reiches an der Ostsee, umgeben von Polen und Litauen, die im Doppelstaat Polen-Litauen vereinigt waren. Es war geprägt von Stränden und Haffs, über die der Wind fegte, von fruchtbaren Ebenen, beschaulichen Seen, düsteren Wäldern und Sümpfen. Im Europa der frühen Neuzeit war es nicht ungewöhnlich, dass ein Herrscher über mehrere, weit verstreute Gebiete gebot, aber in diesem Fall waren die Entfernungen ungewöhnlich groß. Zwischen Berlin und Königsberg lagen mehr als 700 Kilometer Straßen und Wege, die bei nasser Witterung zum Teil unpassierbar waren.
Die brandenburgischen Ansprüche blieben selbstverständlich nicht unangefochten. Eine einflussreiche Fraktion im polnischen Reichstag wandte sich gegen die brandenburgische Erbfolge, und beim jülich-klevischen Erbe gab es mindestens sieben ernst zu nehmende Konkurrenten, die ebenfalls Ansprüche erhoben. Die beste Legitimation hatte (nach Brandenburg) der Herzog von Pfalz-Neuburg im Westen des Reiches. Hinzu kam, dass sowohl Preußen als auch Jülich-Kleve in, wie wir heute sagen würden, internationalen Spannungsgebieten lagen. In unmittelbarer Nachbarschaft von Jülich-Kleve flammte seit den 1560er Jahren immer wieder der niederländische Unabhängigkeitskampf von Spanien auf, und das Herzogtum Preußen lag im Konfliktgebiet zwischen dem expansionistischen Schweden und Polen-Litauen. Zudem beruhte das militärische Aufgebot des Kurfürsten auf dem veralteten Lehnswesen und befand sich um 1600 bereits seit einem Jahrhundert im Niedergang. Abgesehen von ein paar unbedeutenden Festungsgarnisonen und einigen Kompanien, die als Leibwache dienten, gab es kein stehendes Heer. Selbst wenn es Brandenburg also gelingen sollte, die neuen Territorien zu erwerben, würde man erhebliche Ressourcen mobilisieren müssen, um sie zu sichern.
Aber woher sollte man diese Ressourcen nehmen? Jeder Versuch des Kurfürsten, seine fiskalische Basis zu verbreitern, um den Erwerb neuer Gebiete zu finanzieren, löste im Inneren unweigerlich erbitterten Widerstand aus. Wie viele andere europäische Fürsten mussten sich die brandenburgischen Kurfürsten die Macht mit den so genannten Ständen teilen, regionalen Eliten, die in der Ständeversammlung organisiert waren. Die vom Kurfürsten erhobenen Steuern bedurften der Zustimmung durch die Stände, die (seit 1549) auch für deren Einzug sorgten. Als Gegenleistung erhielten sie weitreichende Befugnisse und Privilegien. Zum Beispiel war es dem Kurfürsten verboten, Bündnisse einzugehen, ohne vorher die Zustimmung der Stände einzuholen.14 In einer Erklärung von 1540, die bis 1653 bei unterschiedlichen Anlässen bekräftigt wurde, versprach der Kurfürst sogar, er wolle »keine wichtige Sache, doran der lande gedei und vorterb gelegen, ohn unserer gemeiner landstende vorwissen und raht schließen oder fürnehmen«.15 Insofern waren ihm die Hände gebunden. Der Löwenanteil des Grundbesitzes im Kurfürstentum war in der Hand des Landadels, der zugleich der wichtigste Kreditgeber des Kurfürsten war. Und der Gesichtskreis dieser Adeligen war sehr beschränkt. Sie hatten kein Interesse daran, den Kurfürsten beim Erwerb weit verstreuter Gebiete zu unterstützen, von denen sie nichts wussten. Und sie waren gegen alles, was die Sicherheit der Mark gefährden könnte.
Kurfürst Joachim Friedrich war sich der Tragweite des Problems bewusst. Am 13. Dezember 1604 rief er einen Geheimen Rat ins Leben, dem neun Berater angehörten und der die »ganz hoch angelegne beschwerliche sachen« diskutieren sollte, vor allem die Ansprüche auf Preußen und Jülich.16 Der Geheime Rat sollte kollegial organisiert sein, sodass Themen mit einem einheitlichen Ansatz aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden konnten. Das Gremium wurde allerdings nie das Zentrum einer staatlichen Bürokratie – es hatte lediglich beratende Funktionen, und es kam nie zu den regelmäßigen Zusammenkünften, die man ursprünglich vorgesehen hatte.17 Trotzdem zeugte die Bandbreite und Vielfalt seiner Aufgaben von der Entschlossenheit, Entscheidungsprozesse auf höchster Ebene zu konzentrieren.
In ihrer Heiratspolitik wandten sich die Hohenzollern nunmehr nach Westen. Im Februar 1605 wurde der zehnjährige Enkel des Kurfürsten, Georg Wilhelm, mit der achtjährigen Tochter des pfälzischen Kurfürsten Friedrich IV. verlobt. Die Pfalz, ein großes und reiches Territorium am Rhein, war das wichtigste deutsche Zentrum des Calvinismus, einer strengen Form des Protestantismus, die radikaler mit dem Katholizismus brach als die Lutheraner. Der calvinistische oder reformierte Glaube hatte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Teilen West- und Süddeutschlands Fuß gefasst. In Heidelberg, der Hauptstadt der Rheinpfalz, liefen die Fäden eines militärischen und politischen Netzwerks zusammen, das viele deutsche calvinistische Städte und Fürstentümer einschloss und sich darüber hinaus auch auf calvinistische Mächte außerhalb des Reiches erstreckte, insbesondere auf die Republik der Vereinigten Niederlande. Friedrich IV. von der Pfalz verfügte über eines der gewaltigsten Heere im Westen des Reiches, und der brandenburgische Kurfürst hoffte, durch engere Beziehungen zu ihm strategische Unterstützung für seine Ansprüche im Westen zu erlangen. Und tatsächlich wurde im April 1605 ein Bündnis zwischen Brandenburg, der Pfalz und der niederländischen Republik besiegelt, in dem die Niederländer sich verpflichteten, 5000 Mann in Bereitschaft zu halten, die im Namen des Kurfürsten Jülich besetzen sollten. Im Gegenzug erhielten sie militärische Subsidien.
Diese Allianz war ein Bruch mit der bisherigen Politik Brandenburgs. Indem die Hohenzollern sich mit den militanten Calvinisten verbündeten, überschritten sie die Grenzen des 1555 in Augsburg festgeschriebenen Kompromisses, der explizit nur den Lutheranern einen Anspruch auf Toleranz zugestanden hatte. Brandenburg stellte sich damit an die Seite der entschlossensten Gegner des habsburgischen Kaisers. Die Meinungen bei den Entscheidungsträgern in Berlin waren gespalten. Der Kurfürst und die meisten seiner Berater bevorzugten eine vorsichtige und gemäßigte Politik, aber eine einflussreiche Gruppe um den trinkfesten ältesten Sohn des Kurfürsten, Johann Sigismund (reg. 1608–1619), sprach sich für ein energischeres Vorgehen aus. Zu dieser Gruppe zählten der calvinistische Geheimrat Ottheinrich Bylandt zu Rheydt, der aus Jülich stammte, sowie die Trägerin des jülich-klevischen Anspruchs, Anna von Preußen, die Gemahlin Johann Sigismunds. Mit Unterstützung – oder unter dem Druck – dieser Gruppe drängte Johann Sigismund auf engere Beziehungen zur Pfalz. Er sprach sich sogar für die Invasion und Besetzung von Jülich-Kleve aus, um so einer möglichen Auseinandersetzung um das Erbe zuvorzukommen.18 Es sollte nicht das letzte Mal in der Geschichte des Staates der Hohenzollern sein, dass gegensätzliche außenpolitische Optionen zu einer Polarisierung innerhalb der politischen Eliten führten.
Im Jahr 1609 war es dann so weit: Der geisteskranke alte Herzog von Jülich-Kleve starb, und der brandenburgische Anspruch wurde virulent. Der Zeitpunkt war allerdings äußerst ungünstig: Der Konflikt zwischen den spanischen Habsburgern und der niederländischen Republik schwelte nach wie vor, und das Erbe lag genau im strategisch wichtigen Korridor, der den Zugang zu den Niederlanden bildete. Die Situation wurde noch dadurch verschärft, dass die konfessionellen Spannungen überall im Reich dramatisch eskaliert waren. Nach einer Reihe erbitterter religiöser Dispute bildeten sich zwei konfessionelle Lager heraus: die protestantische Union von 1608, angeführt von der calvinistischen Pfalz, und die katholische Liga unter der Führung von Herzog Maximilian von Bayern und unter dem Schutz des Kaisers. In ruhigeren Zeiten hätten sich der Kurfürst von Brandenburg und der Herzog von Pfalz-Neuburg zweifellos an den Kaiser gewandt, um den Streit um Jülich-Kleve beizulegen. Aber im aufgeheizten Klima von 1609 war auf die Neutralität des Kaisers kein Verlass. Der Kurfürst entschloss sich deshalb, die Maschinerie der kaiserlichen Vermittlung zu umgehen, und unterzeichnete mit seinem Rivalen eine separate Vereinbarung: Die beiden Fürsten würden das Land gemeinsam besetzen und die Regelung ihrer jeweiligen Ansprüche auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Ihr Vorgehen beschwor eine ernste Krise herauf. Aus den spanischen Niederlanden wurden kaiserliche Truppen abkommandiert, um die Verteidigung Jülichs zu überwachen. Johann Sigismund trat der protestantischen Union bei, die prompt den beiden Anwärtern ihre Unterstützung zusagte und eine Armee von 5000 Mann mobilisierte. König Heinrich IV. von Frankreich ergriff Partei und intervenierte auf Seiten der Protestanten. Allein das Attentat auf den französischen König vom Mai 1610 verhinderte, dass es zu einem Krieg kam. Eine Streitmacht, die sich aus Truppen der Niederlande, Frankreichs, Englands und der protestantischen Union zusammensetzte, rückte nach Jülich vor und belagerte die dortige katholische Garnison. Währenddessen schlossen sich immer mehr Staaten der katholischen Liga und dem Kaiser an, der in seiner Wut über die beiden Anwärter das gesamte jülich-klevische Gebiet dem Kurfürsten von Sachsen übertrug und damit Befürchtungen auslöste, eine kaiserlichsächsische Invasion Brandenburgs stehe unmittelbar bevor. Schließlich, im Jahr 1614, konnte der Streit beigelegt werden, und das jülich-klevische Erbe wurde – unter dem Vorbehalt einer endgültigen Klärung – zwischen den beiden Anwärtern aufgeteilt: während der Herzog von Pfalz-Neuburg Jülich und Berg erhielt, konnte Brandenburg sich Kleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein sichern.
Für den Kurfürsten waren das bedeutende Erwerbungen. Das Herzogtum Kleve lag beiderseits des Rheins und ragte in das Gebiet der Republik der Vereinigten Niederlande hinein. Im ausgehenden Mittelalter war durch den Bau von Deichen der fruchtbare Boden der Schwemmebene des Rheins urbar gemacht worden, wodurch das Land zur Kornkammer der Niederlande geworden war. Die Grafschaft Mark war weniger fruchtbar und weniger dicht besiedelt, dafür gab es hier bedeutende Erzvorkommen und Metallverarbeitung. Von der kleinen Grafschaft Ravensberg aus konnte man den strategisch wichtigen Transportweg vom Rheinland nach Nordostdeutschland kontrollieren. Außerdem besaß sie rings um die Hauptstadt Bielefeld blühende Leinenmanufakturen. Der kleine Adelssitz Ravenstein an der Maas war eine Enklave in der Republik der Vereinigten Niederlande.
Irgendwann muss dem Kurfürsten klar geworden sein, dass er sich übernommen hatte. Angesichts des mageren Steueraufkommens in seinem Land konnte er in dem Konflikt um seine Erbansprüche nur eine Nebenrolle spielen.19 Jetzt war sein Territorium verwundbarer denn je. Und es gab eine weitere Komplikation: Im Jahr 1613 verkündete Johann Sigismund seine Konversion zum Calvinismus und stellte damit sich und seine Dynastie außerhalb des Augsburger Religionsfriedens von 1555. Den gewaltigen langfristigen Auswirkungen dieses Schrittes werden wir uns im fünften Kapitel zuwenden. Kurzfristig brachte der Kurfürst mit seiner Konversion die lutherische Bevölkerung gegen sich auf, ohne dadurch greifbare außenpolitische Vorteile für sein Land zu erreichen. Die protestantische Union, die sich von Anfang an nur zögerlich für die brandenburgische Sache eingesetzt hatte, zog 1617 ihre zunächst zugesicherte Unterstützung des brandenburgischen Anspruchs zurück.20 Als Antwort kehrte Johann Sigismund der Union den Rücken. Wie einer seiner Berater darlegte, war er ihr einzig in der Hoffnung beigetreten, Unterstützung für seine Erbansprüche zu erhalten. Sein eigenes Territorium lag so weit entfernt, »das solche [die Protestantische Union] ihme zu nichts anderm fürtreglich sein könnte«.21 Brandenburg stand allein.
Vielleicht wurde der persönliche Verfall des Kurfürsten nach 1609 dadurch beschleunigt, dass ihm dieses Dilemma immer deutlicher vor Augen stand. Der Mann, der als Kurprinz so voller Energie und hoch fliegender Pläne gewesen war, schien verbraucht zu sein. Er war immer ein starker Trinker gewesen, aber jetzt war diese Leidenschaft außer Kontrolle geraten. Die von Friedrich Schiller überlieferte Geschichte, wonach Johann Sigismund die Chance auf eine Heiratsverbindung seiner Tochter mit dem Sohn des Pfalzgrafen von Pfalz-Neuburg zunichte machte, indem er seinem zukünftigen Schwiegersohn in einem Trunksuchtsanfall eine Ohrfeige verabreichte, entbehrt vermutlich jeder Wahrheit.22 Aber es gibt andere, durchaus glaubwürdige Berichte von unkontrollierten Gewaltausbrüchen in trunkenem Zustand. Johann Sigismund wurde immer fettleibiger und lethargischer. Zwischenzeitlich war er unfähig, seine Regierungsgeschäfte auszuüben. Nach einem Schlaganfall 1616 hatte er einen schweren Sprachfehler. Als im Sommer 1618 in Königsberg der Herzog von Preußen starb und damit ein weiterer hohenzollerischer Anspruch auf ein entlegenes Gebiet relevant wurde, beschrieb ein Besucher Johann Sigismund als »lebendigtot«.23
Durch ihren beharrlichen Einsatz hatten die Kurfürsten aus dem Hause Hohenzollern im Laufe von drei Generationen die Aussichten Brandenburgs deutlich verbessert. Zum ersten Mal konnte man die embryogleichen Ansätze eines weit ausgreifenden Territoriums mit abgelegenen Dependancen im Westen und Osten erahnen, das, was einmal als »Preußen« in die Geschichte eingehen würde. Doch was vorerst blieb, war eine eklatante Diskrepanz zwischen Möglichkeiten und Ressourcen. Wie sollte das Haus Brandenburg seine Ansprüche gegen die zahlreichen Konkurrenten verteidigen? Wie sollte es dafür sorgen, dass die neu erworbenen Gebiete sich politisch unterordneten und Steuern zahlten? Das waren schwierige Aufgaben, selbst in Friedenszeiten. Doch die Friedenszeiten waren fürs Erste vorbei, denn alle Bemühungen, einen Ausgleich zwischen den verfeindeten konfessionellen Lagern zu finden, scheiterten. Im Jahr 1618 steuerte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation auf einen erbittert geführten Krieg um Religion und Macht zu.
2
Verwüstung
Während des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) wurden die deutschen Lande zum Schauplatz einer europäischen Katastrophe. Eine Auseinandersetzung zwischen dem habsburgischen Kaiser Ferdinand II. (reg. 1619–37) und protestantischen Mächten innerhalb des Heiligen Römischen Reiches weitete sich derart aus, dass am Ende Dänemark, Schweden, Spanien, die Republik der Vereinigten Niederlande und Frankreich in den Krieg verwickelt waren. Auf dem Gebiet der deutschen Staaten spielten sich Konflikte europäischen Ausmaßes ab: der Kampf Spaniens gegen die abtrünnige niederländische Republik, das Wetteifern der Nordmächte um die Kontrolle der Ostsee und die traditionelle Rivalität zwischen dem bourbonischen Frankreich und den Habsburgern.1
Zwar kam es auch anderswo zu Schlachten, Belagerungen und Besetzungen, aber der Großteil der Kämpfe wurde auf deutschem Boden ausgetragen. Für den ungeschützten Binnenstaat Brandenburg wurde der Krieg zum Desaster, das die Schwächen des Kurfürstentums schonungslos aufzeigte. An entscheidenden Wendepunkten des Konflikts blieb Brandenburg nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Das Schicksal des Landes lag voll und ganz in fremden Händen. Der Kurfürst war außerstande, seine Grenzen zu sichern, seine Untertanen zu befehligen bzw. zu verteidigen, oder auch nur seinen Titel zu sichern. Solange sich die Armeen durch die Provinzen der Mark wälzten, waren Recht und Gesetz außer Kraft gesetzt. Das Wirtschaftsleben kam zum Erliegen, und jegliche Kontinuität von Arbeit, Wohnsitz und Erinnerung gehörte unwiderruflich der Vergangenheit an. Das Land des Kurfürsten, schrieb Friedrich der Große über eineinhalb Jahrhunderte später, wurde »im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges verwüstet, und die Spuren, die davon zurückblieben, waren so tief, dass man ihre Merkmale noch jetzt wahrnimmt, wo ich diese Geschichte schreibe«.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!