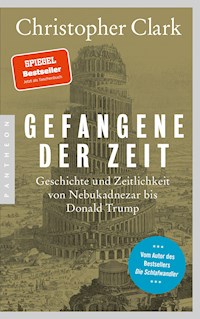4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Worauf gründen sich Macht und Herrschaft?
Wie entsteht Macht? Wie wird sie begründet und erhalten? Und in welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Dies sind die großen Fragen, denen sich Christopher Clark hier widmet.
Wer Macht hat, verortet sich in der Zeit. Er begreift sich als Teil der Geschichte und schafft damit das Geschichtsbild seiner Epoche. Vier solcher Geschichtsbilder betrachtet dieses Buch: das des Großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs II. von Preußen, Bismarcks und der Nationalsozialisten.
Geschrieben während der Brexit-Ereignisse, Trumps Präsidentschaft und Putins vierter Amtszeit ist dieses Buch nicht nur ein großes Geschichtswerk, sondern lehrt uns auch viel über unsere eigene Epoche und deren Strukturen von Selbstlegitimation, Machtverständnis und Machterhalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
Wie entsteht Macht? Wie wird sie begründet und erhalten? Und in welchem Verhältnis stehen Macht und Zeit? Dies sind die großen Fragen, denen sich Christopher Clark hier widmet.
Wer Macht hat, verortet sich in der Zeit. Er begreift sich als Teil der Geschichte und schafft damit das Geschichtsbild seiner Epoche. Vier solcher Geschichtsbilder betrachtet dieses Buch: das des Großen Kurfürsten von Brandenburg, Friedrichs II. von Preußen, Bismarcks und der Nationalsozialisten.
Geschrieben während der Brexit-Ereignisse, Trumps Präsidentschaft und Putins vierter Amtszeit ist dieses Buch nicht nur ein großes Geschichtswerk, sondern lehrt uns auch viel über unsere eigene Epoche und deren Strukturen von Selbstlegitimation, Machtverständnis und Machterhalt.
Über den Autor
Christopher Clark, geboren 1960, lehrt als Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catharine’s College in Cambridge. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte Preußens. Er ist Autor einer Biographie Wilhelms II., des letzten deutschen Kaisers. Für sein Buch Preußen erhielt er 2007 den renommierten Wolfson History Prize sowie 2010 als erster nicht-deutschsprachiger Historiker den Preis des Historischen Kollegs. Sein epochales Buch über den Ersten Weltkrieg, Die Schlafwandler (2013), führte wochenlang die deutsche Sachbuch-Bestseller-Liste an und war ein internationaler Bucherfolg.
Christopher Clark
VON ZEIT UND MACHT
Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München Umschlagmotive: © bpk (NS Adler oben),© AKG (Preußischer Adler unten) Satz und E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23163-7V004www.dva.de
Für Kate und Justin Clark,Geschwister für alle Jahreszeiten
INHALT
EINLEITUNG
EINS
Die Geschichtsmaschine
ZWEI
Der Historiker-König
DREI
Steuermann im Strom der Zeit
VIER
Die Zeit der Nationalsozialisten
EPILOG
DANK
ANMERKUNGEN
REGISTER
EINLEITUNG
Wie die Schwerkraft das Licht, so beugt die Macht die Zeit. Dieses Buch zeigt, was geschieht, wenn zeitliches Bewusstsein durch die Linse der Macht betrachtet wird. Es befasst sich mit den Formen der Geschichtlichkeit, welche die Machthaber sich aneigneten und ihrerseits artikulierten. Mit Geschichtlichkeit oder »Historizität« meine ich keineswegs eine Lehre oder Theorie über den Sinn der Geschichtsschreibung, geschweige denn eine bestimmte Schule der historiographischen Praxis. Vielmehr benutze ich den Begriff in der von François Hartog beschriebenen Bedeutung, um eine Reihe von Annahmen zum Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft untereinander zu bezeichnen.1 Diese Annahmen können explizit in sprachlicher Form zum Ausdruck kommen, sie können sich aber auch über kulturelle Entscheidungen, öffentliche Rituale oder über die Verwendung von bestimmten Argumenten oder Metaphern und anderen bildlichen Sprachmitteln äußern, die eine »zeitbezogene Wahrnehmungsstruktur« implizieren, ohne sich offen temporaler Kategorien zu bedienen.2 Sie können implizit in den Argumenten enthalten sein, die vorgebracht werden, um politisches Handeln zu rechtfertigen oder zu kritisieren.3 Welche Formen sie auch annehmen, die für Kulturen oder Herrschaftsformen charakteristischen Geschichtlichkeiten werden durch »die Konstitution temporaler Modalitäten und die Selektion dessen [bestimmt], was in ihnen relevant ist«.4 Daraus folgt, dass die Konfiguration dieser Beziehung wiederum ein bestimmtes Zeitgefühl vermittelt, das eine intuitiv erfasste Form oder Beschaffenheit der Zeit, eine »Zeitlandschaft« besitzt. Wie diese aussieht, hängt davon ab, welche Teile der Vergangenheit als nahe und eng mit der Gegenwart verbunden empfunden und welche als fremd und fern wahrgenommen werden.5
Die vorliegende Studie nimmt vier Momente in den Blick. Sie beginnt mit dem Streit zwischen Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Preußen (1620–1688), dem Großen Kurfürsten, und seinen Landständen nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Dabei wird gefragt, inwiefern diese Zwistigkeiten mit absolut entgegengesetzten Zeitlichkeiten zu tun hatten; ferner wird deren Einfluss auf die im Entstehen begriffene Geschichtsschreibung Brandenburg-Preußens zurückverfolgt. Die Herrschaft des Kurfürsten war, so meine These, davon gekennzeichnet, dass die Gegenwart als prekäre Schwelle zwischen einer durch katastrophale Gewalt verheerten Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft empfunden wurde. Ein Hauptanliegen des Souveräns galt dabei der Befreiung des Staates aus der vielfachen Verstrickung mit der Tradition, um frei unter den verschiedenen Optionen für die Zukunft wählen zu können.
Das zweite Kapitel widmet sich den historischen Schriften Friedrichs II., des einzigen preußischen Monarchen, der eine Geschichte seiner eigenen Ländereien schrieb. Demnach nahm dieser König ganz bewusst Abstand von der konfliktbeladenen Sichtweise des Staates, die am Hof seines Urgroßvaters, des Großen Kurfürsten, gepflegt worden war. Und in eben dieser Distanzierung zeigten sich sowohl die veränderte Konstellation der gesellschaftlichen Macht, auf die sich der preußische Thron stützte, als auch das idiosynkratische Verständnis Friedrichs von seinem eigenen Platz in der Geschichte. Anstelle der nach vorne orientierten Geschichtlichkeit des Großen Kurfürsten erkannte Friedrich, so meine These, nach dem Westfälischen Frieden einen Stillstand oder eine Stasis. Damit machte er sich eine neoklassische Zeitlichkeit des Status quo zu eigen, in der Motive der Zeitlosigkeit und der zyklischen Wiederholung vorherrschten und der Staat nicht mehr Motor des historischen Wandels, sondern eine historisch unspezifische Tatsache und logische Notwendigkeit war.
Das dritte Kapitel untersucht die Geschichtlichkeit Bismarcks, wie sie sich in seinen politischen Argumenten, seiner Rhetorik und seinen Methoden äußerte. Für Bismarck war der Staatsmann ein vom Strom der Geschichte getriebener Entscheidungsträger, dessen Aufgabe darin bestand, das Wechselspiel der von der Revolution von 1848 entfesselten Kräfte zu steuern, während er gleichzeitig die privilegierten Strukturen und die Prärogative des monarchischen Staates bewahrte und schützte, weil ohne diese seiner Meinung nach der Gang der Ereignisse im nackten Chaos zu versinken drohte. Demnach war Bismarcks Geschichtlichkeit zerrissen von einem Spannungsverhältnis zwischen seinem Engagement für den zeitlosen Fortbestand des Staates und den Wechselfällen der Politik und des öffentlichen Lebens. Der Zusammenbruch des von Bismarck geschaffenen Systems im Jahr 1918 zog eine Krise im historischen Bewusstsein nach sich, weil damit eine Form der Staatsmacht zerstört wurde, die zum Brennpunkt und Garanten des historischen Denkens und Bewusstseins geworden war.
Zu den Erben dieser Krise zählten, wie im vierten Kapitel ausgeführt wird, die Nationalsozialisten, die einen radikalen Bruch mit der Vorstellung, Geschichte sei eine endlose »Wiederholung des Neuen«, in die Wege leiteten. Hatte Bismarcks Historizität auf der Annahme gegründet, dass Geschichte eine komplex strukturierte, vorwärtsdrängende Abfolge ständig neuer und nicht vorherbestimmter Situationen sei, stützten die Nazis die radikalsten Ansprüche ihres Regimes auf eine tiefe Identität zwischen der Gegenwart, einer fernen Vergangenheit und einer fernen Zukunft. Das Ergebnis war ein Geschichtlichkeitsregime, das es in Preußen bzw. Deutschland noch nie gegeben hatte, das sich aber zugleich deutlich von den damaligen totalitären Experimenten der italienisch-faschistischen und sowjetisch-kommunistischen Systeme unterschied.
Ziel dieser Studie ist es somit, das in François Hartogs Régimes d’historicité verfolgte Unterfangen umzukehren und stattdessen die Geschichtlichkeit von (einer kleinen Auswahl an) Regimen auszuloten. Zu diesem Zweck könnte man die Art und Weise untersuchen, wie offizielle staatliche Strukturen – Ministerien, militärische Oberkommandos, kurfürstliche und königliche Höfe und Bürokratien – die Zeit strukturierten, wie sie sich selbst in der Geschichte verorteten und wie sie sich die Zukunft vorstellten, doch damit würde man der Frage ausweichen, ob sich der Begriff »Staat« überhaupt eignet, um etwas zu bezeichnen, das über den gesamten Zeitraum, den dieses Buch abdeckt, in der gleichen Bedeutung vorhanden war. Ich habe einen anderen Ansatz gewählt. Mich interessiert in erster Linie, wie diejenigen, die Macht ausübten, ihr Auftreten mit Argumenten und Verhaltensmustern rechtfertigten, die eine ganz spezifische temporale Signatur trugen. In welchem Verhältnis diese Träger der Macht zu den formalen Regierungsstrukturen standen, war von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Große Kurfürst übte seine Macht aus dem Innern einer Exekutivstruktur aus, die er nach und nach und weitgehend improvisiert während seiner langen Herrschaft um sich herum aufbaute. Die Herrschaft Friedrichs II. hingegen war von einer drastischen Personalisierung der Macht und von der Semi-Distanzierung des Monarchen von vielen Strukturen geprägt, in denen staatliche Autorität formal angesiedelt war. Bismarck verortete sich in dem unruhigen Raum zwischen der preußisch-deutschen, monarchischen Exekutive und den unberechenbaren Kräften, die in einer postrevolutionären öffentlichen Sphäre am Werk waren. Und die Führungsriege der Nationalsozialisten war geradezu die Nemesis des bürokratischen Staatsaufbaus – eine vehemente Verleugnung des Staates als Vehikel und Ziel des historischen Strebens stand im Zentrum der NS-Geschichtlichkeit.
Die zeitliche Wende in der Geschichtswissenschaft
Zeit – oder genauer die Vielfalt zeitlicher Ordnungen – ist keineswegs ein neues Thema in der historischen Forschung. Heutzutage ist allgemein bekannt, dass Zeit keine neutrale, universelle Substanz ist, in deren Leere sich etwas, das »Geschichte« genannt wird, abspielt, sondern ein bedingtes, kulturelles Konstrukt, dessen Form, Struktur und Konsistenz vielfach variierten. Diese Erkenntnis hat im Laufe der vergangenen 15 Jahre ein so lebendiges und vielfältiges Forschungsfeld entstehen lassen, dass man von einer »zeitlichen Wende« (temporal turn) in der Geschichtswissenschaft sprechen kann, einer Verschiebung der Sensibilitäten, die durchaus vergleichbar mit den Wenden der 1980er und 1990er Jahre ist – eine jener Neustrukturierungen der Aufmerksamkeit, durch die sich die Disziplin der Geschichtswissenschaft immer wieder selbst erneuert.6
Die zeitliche Wende in heutigen historischen Studien kann auf renommierte philosophische und theoretische Vorläufer verweisen. Der französische Philosoph Henri Bergson vertrat schon in seiner Dissertation von 1889 die Auffassung, dass Zeit als Dimension des menschlichen Bewusstseins nicht homogen, sondern »qualitativ vielfältig« sei; Émile Durkheims Elementare Formen des religiösen Lebens (orig. 1912) legte das Fundament einer Soziologie der Zeit als etwas, das kollektiv erfahren und gesellschaftlich konstruiert wird; in Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen (orig. 1925) wandte Maurice Halbwachs Durkheims Erkenntnisse auf die gesellschaftliche Erzeugung von Erinnerung an; zwei Jahre später stellte Martin Heidegger in Sein und Zeit die These auf, dass sich die »Seinsverfassung des Daseins auf dem Grunde der Zeitlichkeit« nachweisen lasse; und seit dem Zweiten Weltkrieg haben Literaturtheoretiker und insbesondere Narratologen die temporalen Strukturen von Texten eingehend analysiert.7
Zu den ersten Historikern, die über die Implikationen dieser theoretischen Strömungen für die Geschichtsschreibung nachdachten, zählt Marc Bloch, der ein kurzes Unterkapitel seines Standardwerks aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (deutsch Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers) dem Problem der »historischen Zeit« widmete. Im Gegensatz zur »künstlich homogenen« und abstrakten Zeit der Naturwissenschaften sei, so Bloch, »die Zeit der Geschichtswissenschaft« als »konkrete und lebendige Realität, in der Unumkehrbarkeit ihrer Dynamik rekonstruierte Realität […] das Plasma, in dem die Phänomene verschwimmen, der Ort ihrer Verstehbarkeit«. In ihrem Kern herrsche eine unauflösliche Spannung zwischen Kontinuität und »ständiger Veränderung«.8 Blochs Überlegungen zur Zeitlichkeit der Geschichte blieben fragmentarisch, aber die Arbeiten von Fernand Braudel, Jacques Le Goff und anderen Historikern in der Tradition der Annales-Schule vertieften und erweiterten diese Annahmen und entwickelten ein klares Bewusstsein für die Vielfalt der zeitlichen Dimensionen und Strukturen. Für Braudel wurde das Verhältnis zwischen den kurzfristigen Störungen, den sogenannten »Ereignissen«, und den langfristigen Kontinuitäten, die Epochen definieren, zu einem zentralen Problem für das Handwerk des Historikers. Le Goff erforschte die unterschiedlichen zeitlichen Strukturen beruflicher, liturgischer und devotionaler Praktiken.9
Wie aus diesen Überlegungen deutlich wird, sind Geschichtlichkeit (Historizität) und Zeitlichkeit (Temporalität) miteinander verknüpfte, aber nicht identische Kategorien. Im vorliegenden Buch bezeichnet letzterer Begriff das intuitive Gespür eines politischen Akteurs für die Struktur der erlebten Zeit. Wenn Geschichtlichkeit auf einer Reihe von Annahmen zum Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fußt, so erfasst Zeitlichkeit etwas, das weniger reflektiert und spontaner ist: ein Empfinden des Fortgangs der Zeit. Bewegt sich die Zukunft auf die Gegenwart zu oder entfernt sie sich von ihr? Droht die Vergangenheit, auf die Gegenwart Einfluss zu nehmen, oder fällt sie zurück an den Rand des Bewusstseins? Wie ist der zeitliche Rahmen des politischen Handelns strukturiert, und wie verhält sich der gedachte Zeitfluss zur Neigung der Entscheidungsträger, sie als in »Momente« unterteilt wahrzunehmen? Wird die Gegenwart als Bewegung oder Stillstand empfunden? Was gilt als dauerhaft in den Köpfen derjenigen, die Macht ausüben, und was nicht?
Die Modernisierung der Zeit
Wenn die Annales-Schule die Geschichte verzeitlichte, so hat vor allem ein deutscher Historiker, Reinhart Koselleck, die Zeitlichkeit historisiert. In Vergangene Zukunft, einer Sammlung brillanter Aufsätze zur »Semantik geschichtlicher Zeiten«, untersuchte Koselleck die Geschichte des Zeitbewusstseins und schuf damit eine subtile Palette analytischer Werkzeuge. Im Zentrum seines Projekts stand der Übergang von vormodernen zu modernen Formen des Erlebens und der Wahrnehmung von Zeit. Er erörterte die Veränderungen im Zeitbewusstsein seit der Renaissance, insbesondere Prozesse der kulturellen Säkularisierung, die den Einfluss der biblischen Prophezeiung auf christliche Zukunftsvisionen untergruben. Seine zentrale These war jedoch, dass in der Zeitspanne, die er die »Sattelzeit« nannte – ungefähr die Jahre von 1750 bis 1850 –, eine tiefgreifende Veränderung im westeuropäischen Zeitbewusstsein stattgefunden hat. Dieser Wandel setzte sich aus mehreren Strängen zusammen: In dem Maß, wie sich der Fluss der Zeit, der sich in Ereignissen äußerte, zu beschleunigen schien, vergrößerte sich die gefühlte Distanz gegenüber der Vergangenheit; allgemein gültige Prinzipien machten der Kontingenz Platz; die Autorität der Vergangenheit als Hort der Weisheit und Lehre für die Gegenwart schwand; Schlüsselbegriffe wie »Revolution«, »Klasse«, »Fortschritt«, »Staat« wurden durchdrungen vom Momentum des historischen Wandels; Geschichten, Chroniken und Anekdoten über die Vergangenheit verschmolzen zu etwas Prozesshaftem, Singulärem und Allumfassendem, zu einer einzigen Totalität, zur »Geschichte«, die Hegel theoretisch zu erfassen suchte und die in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten heutiger Universitäten gelehrt wird. Die Folge war eine tiefgreifende Veränderung in der empfundenen Struktur und Gestalt der Zeit: Die rekursiven Zeitstrukturen der vormodernen Gesellschaften wichen einem Konstrukt namens Geschichte, das bislang als eine Abfolge transformativer und unumkehrbarer Ereignisse aufgefasst worden war und künftig als »die unablässige Wiederholung des Neuen« verstanden werden sollte. Die Disruption, Gewalt und Diskontinuität des Revolutionszeitalters und der napoleonischen Zeit hatten Dissonanzen zwischen dem »Erfahrungsraum« und dem »Erwartungshorizont« geschaffen, die zum Sinnbild für die Neuzeit werden sollten.10
In dem einleitenden Aufsatz zu Vergangene Zukunft hinterfragt Koselleck Albrecht Altdorfers Gemälde Alexanderschlacht (Schlacht bei Issus), ein Bild aus dem Jahr 1529, das den Sieg Alexanders des Großen über die Perser in der Schlacht von Issus 333 v. Chr. zeigt.11 Wie kam es, fragt Koselleck, dass Altdorfer die Griechen als zeitgenössische Deutsche und die Perser als zeitgenössische Türken darstellte? Warum zeigte das Gemälde Scharen von Männern und Pferden über eine deutsche Gebirgslandschaft verstreut, die mit sichtlich europäischen Gebäuden geschmückt war, obwohl das ursprüngliche Aufeinandertreffen in Kleinasien stattgefunden hatte? Wieso ähnelten die Details in diesem Gemälde so stark zeitgenössischen Darstellungen der Belagerung Wiens durch die Osmanen, die im Jahr 1529, als Altdorfer sein Bild malte, noch im Gange war? Die Antwort war, so Koselleck, dass für Altdorfer die Beziehung zwischen der Schlacht von Issus und der osmanischen Belagerung prophetisch und allegorisch zugleich war. Die erste Schlacht hatte das Ende des Persischen Reiches eingeläutet, wie es in dem prophetischen Traum aus dem biblischen Buch Daniel vorhergesagt worden war. Die zweite schien das Ende des Römischen Reiches (d. h. des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation) anzukündigen, das als der nächste Schritt in dem von Daniels Prophezeiung angedeuteten Zeitplan angesehen wurde. Erst dadurch wurde es möglich, die Zeit so wie Altdorfer zu falten und damit Türken aus dem 16. Jahrhundert über antike Perser zu legen.
Um den Gegensatz zum modernen Zeitbewusstsein zu verdeutlichen, führt Koselleck als Zeugen den Dichter, Kritiker und Gelehrten Friedrich Schlegel an, der, wie der Zufall es will, in den 1820er Jahren das Gemälde Alexanderschlacht betrachtete und einen begeisterten Aufsatz darüber schrieb. Schlegel rühmte Altdorfers Gemälde als »das höchste Abenteuer alten Rittertums«. Koselleck konzentriert sich ganz auf diese Beobachtung: Für Schlegel bestand, allem Anschein nach, eine distanzierende Zeitspanne zwischen sich und dem Gemälde. Damit nicht genug, spürte Schlegel, dass das Gemälde einem anderen Zeitalter angehörte, dem Zeitalter des Rittertums, nicht seinem eigenen. Folglich handelte es sich nicht nur um eine Frage der Menge an verstrichener Zeit, sondern es ging um einen Bruch im Gefüge der Zeit, um eine tektonische Verwerfung zwischen dieser Zeit und einer früheren. Zwischen der Zeit Altdorfers und der Zeit Schlegels, so Koselleck, habe sich etwas ereignet, mit dem paradoxen Ergebnis, dass augenscheinlich eine größere Zeitspanne Schlegel von Altdorfer trennte als Altdorfer von den Taten Alexanders. Die Schlacht von Issus stand mit anderen Worten exemplarisch für ein vormodernes, nicht verzeitlichtes Zeitempfinden und damit für den Mangel an historischem Bewusstsein, wie wir sagen würden. Schlegel hingegen stand stellvertretend für ein modernes Zeitbewusstsein, das die Vergangenheit als fern, überholt und ontologisch losgelöst wahrnahm.12
Der Einfluss von Kosellecks Werk auf die historische Erforschung der Zeitlichkeit kann nicht hoch genug veranschlagt werden. Er stellte kühne und originelle Fragen und legte ihre Implikationen mit beeindruckendem Scharfsinn, großer Klarheit und profunder Argumentation dar. Sein Rückgriff auf semantische Veränderungen, um damit epochale Mutationen des Bewusstseins aufzuspüren, war grundlegend. Koselleck entlieh analytische Kategorien aus der Philosophie und Literaturtheorie und entwickelte sie zu Instrumenten weiter, um Prozesse des Wandels zu justieren: Der »Erwartungshorizont« stammte aus der Rezeptionstheorie von Gadamer und Jauß; »Zeitlichkeit«, ein Begriff, der sowohl die Eigenschaft der Zeit (ihre unaufhörliche Bewegung, ihre Beschaffenheit) als auch den Daseinszustand in der Zeit bezeichnet, wurde bei Heidegger entliehen; »Verzeitlichung«, also die Historisierung der Vergangenheit und Gegenwart in der Neuzeit, stammte aus Arthur O. Lovejoys Die große Kette der Wesen; das Konzept der Beschleunigung als Kennzeichen der modernen Empfindsamkeit wurde schon mit Nietzsche in Verbindung gebracht. Doch auch wenn Koselleck diese Kategorien nicht erfand, so »besetzte, füllte und popularisierte« er sie und stellte sie als Instrumente für eine schematische Darstellung der Mutation der zeitlichen Ordnungen im Lauf der Zeit zusammen. Sie alle sind in das Repertoire der zeitlichen Wende eingeflossen.13
Noch größeren Einfluss hatte Kosellecks Beschäftigung mit dem Übergang von vormodernen zu modernen zeitlichen Ordnungen.14 Die Literatur des temporal turn hat sich in erster Linie mit der Vermessung dieser Schwelle beschäftigt. Es gibt Studien zur Beschleunigung der Reisen im Zeitalter der Eisenbahn; zur wachsenden Bedeutung von Pünktlichkeit und Verspätung; zum Skandal der »verschwendeten« Zeit als Symptom moderner Zeitregime; zur Kommerzialisierung von immer kleineren Zeitspannen in der Ära des Telegrafen; zum Schrumpfen des Raums durch das Einsetzen des Hochgeschwindigkeitsmassenverkehrs; zum Aufkommen der Nostalgie als charakteristischem Leiden der Moderne.15 In diesen Studien standen die Heraufkunft der Moderne und die dazugehörige Modernisierung des Zeitbewusstseins im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Dennoch bleibt eine Ungewissheit bezüglich des qualitativen Charakters des Übergangs von der »traditionellen« zur »modernen« Zeitlichkeit. Statt einen festen Satz allgemein gebräuchlicher hermeneutischer Kategorien hervorzubringen, hat die jüngste Literatur zu modernen Temporalitäten ein Dickicht heterogener Metaphern geschaffen. Der Übergang von traditioneller zu moderner Zeitlichkeit wird begrifflich unterschiedlich gefasst: als Prozess der Beschleunigung, der Ausdehnung, Verengung, Erneuerung, Kompression, Distanzierung, Spaltung, Zersplitterung, Entleerung, Vernichtung, Intensivierung und Verflüssigung.16 Und die Kategorie der »Zeitlichkeit« selbst wurde in verschiedenen Bedeutungen verwendet. In manchen Studien bezeichnet der Begriff einen Erfahrungsbereich, eine Tendenz seitens einzelner Personen oder Gemeinschaften, sich an zyklischen Wegmarken wie Jahreszeiten oder liturgischen Feierlichkeiten zu orientieren, die wahrgenommene Beschaffenheit der Zeit in ihrem Verlauf, Schwankungen bei der erlebten Dauer spezifischer Ereignisse, das Verhältnis zwischen Erfahrung und Erwartung, eine Abweichung in den Rhythmen des privaten und öffentlichen Lebens oder Muster des Zeitmanagements, die mit bestimmten Beschäftigungskulturen assoziiert werden.17 Andere Studien konzentrieren sich auf »chronosophische« Fragen oder philosophische Reflexionen über die Zeit und ihr Verhältnis zur Geschichte oder allgemein zur menschlichen Existenz.18
Macht und Zeit
Tendenziell dominierten Veränderungsprozesse ohne Akteur die Literatur zur Zeitlichkeit, deren Narrative häufig in den systemischen und prozesshaften Argumenten der Modernisierungstheorie verankert waren.19 Aber es gibt auch ausgezeichnete Studien zu der Frage, wie Machtregime in die zeitliche Ordnung eingriffen. So wurde beispielsweise die Verwendung eines Kalenders als Instrument politischer Macht untersucht. Der Übergang vom julianischen zum gregorianischen Kalender in Westeuropa, ein Prozess, der drei Jahrhunderte in Anspruch nahm, war stets eng mit Machtkämpfen verknüpft.20 Im Habsburger Reich setzte die Thronbesteigung des aufgeklärten, jansenistischen Reformers Joseph II. der traditionellen Dominanz des liturgischen Kreises bei Hofe ein Ende, während die drastische Reduzierung der Feiertage Teile der Bevölkerung entfremdete, die an ihrer traditionellen Frömmigkeit und den geselligen Rhythmen des alten katholischen Kirchenjahres hingen.21 Am 24. Oktober 1793 nahm der von den Jakobinern kontrollierte Nationalkonvent einen neuen »republikanischen Kalender« an, um auf diese Weise einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit und den Beginn einer neuen Ära zu markieren. Hätte der Kalender sich langfristig durchgesetzt, dann hätte die Zehn-Tage-Woche (décade) den Lebens- und Arbeitsrhythmus der Franzosen verändert. Gleichzeitig hätte sie dieser Schritt von den Zyklen des christlichen Kirchenjahrs entfremdet und vom Rest des europäischen Kontinents getrennt.22
Historiker der Kolonialreiche haben ebenfalls den »engen Zusammenhang« zwischen Zeit und imperialer Macht untersucht – vor allem wie er sich in der Einführung standardisierter Regime der Zeitdisziplin für Arbeits- und Produktionsprozesse manifestierte.23 Dabei wurde vor allem der teilweise erzwungene Übergang von vor- oder nicht-modernen (ursprünglichen) zu modernen (imperialen oder westlichen) Temporalitäten betont, auch wenn etliche Studien darauf hingewiesen haben, dass trotz des Drucks seitens der Kolonialbehörden indigene Temporalitäten weiter Bestand hatten.24 Vanessa Ogles meisterhafte Studie zur weltweiten Standardisierung der Uhrzeit offenbarte einen »additiven und unbeabsichtigten Prozess«, in dem die unkoordinierten Bemühungen etlicher Akteure mit einer globalen Verwerfung (dem Zweiten Weltkrieg) und den durch eine neue Infrastruktur (militärische und zivile Luftfahrt) bedingten Anforderungen zusammenfielen, was dann die Einführung einheitlicher Zeitzonen zur Folge hatte.25 Sebastian Conrad hat deutlich gemacht, wie die Ausweitung und Verstärkung imperialer Macht und die semantischen und kulturellen Veränderungen des 19. Jahrhunderts in einem Wechselspiel »weltweite Veränderungen des Zeitregimes« hervorbrachten.26
Die Disruption von Machtsystemen von unten kann ebenfalls Veränderungen im Zeitempfinden bewirken, wie Studien zum China der späten Qing-Dynastie gezeigt haben.27 Die Phase gewaltsamer Unruhen, welche die Taiping-, Nian-, Gelao- und Hui-Rebellionen der 1850er bis 1870er Jahre und die darauffolgenden Vorstöße westlicher Mächte umfasste, habe so tiefgreifende Brüche mit der erinnerten Vergangenheit entstehen lassen, so argumentiert Luke S. K. Kwong, dass sie das historische Bewusstsein veränderten, zumindest innerhalb der kulturellen Elite. Im traditionellen China wurde Geschichte als ein Schatz positiver Beispiele bewahrt, die einen Zustand kosmischer Verbundenheit und harmonischer Regelung der menschlichen Angelegenheiten widerspiegelten. Ereignisse in der Gegenwart wurden im Licht von Analogien aus der Vergangenheit interpretiert. Das hieß keineswegs, dass chinesische Gelehrte und Verwaltungsbeamte außerstande gewesen wären, »spezifische Arten eines linearen Fortschritts« zu konstruieren, aber diese waren, so Kwong, in eine zyklische, extrem rekursive und nicht-lineare Zeitstruktur eingebettet.
Der Einfluss dieser traditionellen Zeitlichkeit wurde erst gebrochen, als gewaltige Wellen sozialer Unruhen und politischer Gewalt die Autorität der kaiserlichen Regierung untergruben. Denn sie durchtrennten den Strang der Kontinuität mit der Vergangenheit und stellten damit das Überleben des Landes und damit auch die Autorität einer Geschichte infrage, die in Herrscherdynastien erzählt worden war. Die altbewährte Praxis, in der historischen Überlieferung nach Lehren zu suchen, fiel in den Augen Kosellecks in dem Moment in sich zusammen, als der Topos der Geschichte als Lehrerin des Lebens in Westeuropa verschwunden war. Die Auffassung, die aktuelle Ära der Zerstörung werde wie in der Vergangenheit irgendwann einem Zeitalter der Restauration und Erlösung Platz machen, schien nicht länger glaubwürdig. Angesichts der in ihren Augen radikalen Neuartigkeit der zeitgenössischen Verhältnisse suchten Intellektuelle der späten Qing-Dynastie nach linearen und entwicklungsorientierten, vom Westen und von den Meiji inspirierten Narrativen, um ein Gefühl der Häufung und Beschleunigung der Ereignisse zu erfassen, die »in einem Vorwärtsdrang in Richtung Zukunft an Dynamik gewannen«.28
Zu den ambitioniertesten modernen Eingriffen in die zeitlichen Ordnungen zählten jene der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts. Im Januar 1918 gab die Sowjetunion den julianischen Kalender auf, den Peter der Große im Jahr 1699 übernommen hatte, und ersetzte ihn durch den gregorianischen Kalender, der im Westen allgemein gebräuchlich war. Das Land wurde dadurch um 13 Tage nach vorn katapultiert. Der Aufstieg Stalins zu unumstrittener Herrschaft brachte weitere Initiativen mit sich. Im Jahr 1930 rief Stalin eine neue Fünf-Tage-Woche aus. Es sollte weder einen Samstag noch einen Sonntag geben, lediglich eine Abfolge von fünf Tagen, die mit Zahlen und Farben gekennzeichnet waren: gelb, orange, rot, violett und grün.29 Dieses Projekt wurde zwar irgendwann als undurchführbar aufgegeben, doch die Sowjetunion startete ein revolutionäres Experiment, welches das Verhältnis der Menschen zur Zeit neu ordnen sollte; sie trachtete danach, eine Zeitlichkeit einzuführen, durch die die Avantgarde der Partei die Beschränkungen der konventionellen »bourgeoisen«, linearen Zeit durch die endlose Intensivierung der Arbeit überwand.30 Aktuelle Studien zum italienischen Faschismus haben sich auf die Bemühungen faschistischer Intellektueller und deren Propaganda konzentriert, eine neue Zeitlichkeit zu etablieren, in deren Zentrum die Partei selbst als eigentliche historische Kraft stand.31 Und der Historiker Roger Griffin, der sich mit dem Faschismus in transnationaler Perspektive beschäftigt hat, bezeichnete die Machtübernahme der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland als »Zeitrevolution«.32 Eric Michaud richtete sein Augenmerk bei der Erforschung des »Nazi-Mythos« auf die paradoxe Beziehung zwischen »Bewegung« und »Bewegungslosigkeit« in der Bildsprache der Nationalsozialisten und stellte dies in Bezug zur Logik der christlichen Eschatologie, nach der sich das Subjekt zwischen der Erinnerung an eine frühere Erlösung (in Form der Auferstehung Christi) und der Erwartung einer künftigen, kollektiven Errettung in einem Schwebezustand befindet.33 Emilio Gentile hat von einer faschistischen »Sakralisierung der Politik« gesprochen, durch welche die Riten und Bräuche der christlichen Tradition an die Ziele des Mussolini-Regimes angepasst wurden, sodass ein inneres »mythisches und symbolisches Universum« entstand, in dem die zeitlose Universalität einer liturgischen Darbietung auf die kollektive Erfahrung der Politik übertragen wurde.34 Alle drei totalitären Diktaturen, so gaben Charles Maier und Martin Sabrow zu verstehen, standen für weitreichende Eingriffe, nicht nur in die soziale und politische, sondern auch in die temporale Ordnung.35
Indem man die Zeitlichkeit als Folge oder Begleiterscheinung von Machtveränderungen darstellt, verlagert sich der Fokus von Veränderungsprozessen ohne Akteur hin zur »Chronopolitik«, zur Untersuchung, wie »bestimmte Ansichten über die Zeit und über die Natur des Wandels« in Prozesse der Entscheidungsfindung eingebunden werden.36 Und das bedeutet wiederum, nach »der Vorstellung von Zeit und Geschichte« zu fragen, die in verschiedenen Ländern und Epochen den Aktionen und Argumenten der souveränen Macht »Sinn und Legitimität« verliehen hat.37 Es geht, um mit Charles Maier zu sprechen, um die Frage, »wie die Politik mit der Zeit umgeht« und welche Form der Zeit »von der Politik vorausgesetzt« wird.38
Kein einziges der im Folgenden erörterten Regime trachtete offiziell danach, die kollektive Erfahrung der Zeit nach Art des französischen Nationalkonvents durch die Einführung eines neuen Kalenders neu zu strukturieren. Aber sie alle fingen bestehende Temporalitäten ein und verstärkten sie selektiv, verwoben sie mit den Argumenten und Darstellungen, mit denen sie sich und ihre Handlungen rechtfertigten.
Zu den vielleicht ungewöhnlichen Merkmalen dieses Buches zählt, dass es eine langfristige Betrachtung bietet, indem es der gleichen angestammten territorialen Einheit (Brandenburg-Preußen) über mehrere aufeinanderfolgende politische Inkarnationen folgt. Dieser Ansatz hat nicht zuletzt den Vorteil, dass er es gestattet, die reflexive, selbst-historisierende Dimension des chronopolitischen Wandels zu erfassen. Staaten haben tiefe Gedächtnisse, und ihre Selbstwahrnehmung hat eine kumulative Logik, selbst wenn ein Regime den Ansprüchen oder Praktiken seines Vorläufers feierlich entsagt. Indem wir die Punkte diachron miteinander verbinden, sind wir somit eventuell imstande, die Umrisse einer »Zeit-Geschichte« zu skizzieren, zumindest innerhalb eines recht engen Bereichs menschlichen Handelns.39 Der Umstand, dass diese Studie ausgerechnet Deutschland (Preußen) in den Blick nimmt, geht in erster Linie auf die pragmatische Entscheidung zurück, mich auf das Gebiet zu konzentrieren, das ich am besten kenne. Aber Deutschland ist zudem ein besonders interessanter Fall für eine Untersuchung zum Verhältnis zwischen Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit und Macht. Die Häufigkeit und Tiefe der politischen Brüche im deutschen Europa in den vergangenen vier Jahrhunderten gestatten es uns, immer wieder den Einfluss politischer Veränderungen auf das zeitliche und historische Bewusstsein zu beobachten. Im Schlussteil kehre ich zu der Frage zurück, ob an dem Entwicklungsverlauf, der aus diesem Ansatz hervorgeht, etwas spezifisch Preußisches oder Deutsches ist.
Ein weiterer Vorteil des langfristigen Ansatzes besteht darin, dass er es uns ermöglicht, die Beziehung zwischen »Modernisierung« und Zeitlichkeit zu untersuchen. Mehrere aktuelle Studien haben behauptet, dass die von Koselleck mit der sogenannten »Sattelzeit« assoziierten Umbrüche in Wirklichkeit schon in früheren Regimen auszumachen sind: etwa an den Höfen der Stadtstaaten im Italien der Renaissance und im frühneuzeitlichen Deutschland oder sogar im Europa und im Nahen Osten des Mittelalters.40 Indem man die Schwelle zeitlich nach hinten verschiebt, wird die Teleologie des Paradigmas selbstverständlich nicht grundsätzlich infrage gestellt, falls man dabei einfach im Nachhinein die analytischen Kategorien der Modernisierung auf eine frühere Epoche anwendet. Aber es lohnt sich auch zu fragen, ob wir Kosellecks Typologie der Temporalitäten unbedingt in chronologischer Reihenfolge lesen müssen; eine alternative Sichtweise würde ihn als Theoretiker vielfältiger, paralleler Formen von Zeitlichkeit auffassen.41
Im vorliegenden Buch versuche ich mich intensiv mit den spezifischen zeitlichen Gefügen und Texturen eines jeden Regimes auseinanderzusetzen. Die daraus resultierende Abfolge pendelt stärker hin und her, ist rekursiver und nicht so linear, wie eine streng sequenzielle und auf Modernisierung basierende Theorie es gestatten würde. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es überhaupt keine Modernisierung gab; es könnte schlicht die Schieflage und Kontingenz der Beziehungen zwischen den Machthabern und jenen Prozessen widerspiegeln, für die sich Modernisierungstheoretiker in erster Linie interessieren. Der Große Kurfürst richtete sich an einem aktivistischen Geschichtsverständnis aus, das ihn zum Gegenspieler der zeitgenössischen Verteidiger von Privilegien und Tradition machte. Friedrich II. versuchte, den Prozessen des gesellschaftlichen Wandels entgegenzuwirken, die sein Königreich von innen heraus veränderten, und formulierte eine hochgradig ästhetisierte politische Vision, die von Stillstand und Gleichgewicht geprägt war. Otto von Bismarck passte seine Politik an die politischen und gesellschaftlichen Kräfte an, welche die turbulente Bewegung der Geschichte vorantrieben, hielt aber weiterhin an der Vorstellung des monarchischen Staates als konstanter und alles überragender Staatsform fest, die er, wie er glaubte, aus der Ära Friedrichs geerbt hatte. Und das NS-Regime brach mit all diesen Vorläufern, es verwarf allein schon die Vorstellung einer Geschichte, die aus disruptiven Entwicklungen und Zufälligkeiten besteht, und bettete seine politische Vision in eine tausendjährige Zeitlandschaft ein, in der die ferne Zukunft lediglich das erfüllte Versprechen der fernen Vergangenheit war.
In keiner einzigen der vier Epochen verdrängten die hier untersuchten Temporalitäten der Macht andere Formen des Zeitbewusstseins, auch wenn sie sich in manchen Fällen gegen sie richteten. Während der gesamten Zeitspanne, die in diesem Buch behandelt wird, wurde das politische Leben von einer Pluralität nebeneinander existierender zeitlicher Ordnungen strukturiert.42 Doch die Zeitlichkeit der politischen Macht, wie sie von den einflussreichsten Akteuren ausgeübt wurde, behielt und behält eine besondere Bedeutung. Sie war der Ort, wo die politischen Begründungen der Macht als Ansprüche an die Vergangenheit und Erwartungen an die Zukunft Ausdruck fanden.
Auch die politischen Bewegungen und Organisationen der Gegenwart beteiligen sich an der Chronopolitik; die Berufung auf imaginäre Zeitlandschaften bleibt eines der wichtigsten Instrumente politischer Kommunikation. Das vorliegende Buch wurde unter dem Getöse und Triumph der Brexit-Kampagne in Großbritannien geschrieben, einer Kampagne, die von dem Anspruch getrieben war, »wieder die Kontrolle zu übernehmen«. Der Brexit-Befürworter Boris Johnson war der Hauptpropagandist dieses Schlagworts, ist aber auch der Autor einer Biographie Winston Churchills (deren Untertitel im Original lautet: »Wie ein Mann Geschichte machte«), in der der ikonenhafte Staatsmann eine frappierende Ähnlichkeit mit Johnson selbst zeitigte. Und die Brexit-Kampagne war beseelt von der Beschwörung einer idealisierten Vergangenheit, in der die »Englisch sprechenden Völker« mühelos die Welt beherrscht hatten. Die Häufigkeit solcher Motive in den Argumenten der Brexit-Befürworter belege, so Duncan Bell, »die mesmerisierende Faszination, die das Empire immer noch auf große Teile der herrschenden Klasse in Großbritannien ausübt«.43
Der Schock des Brexit-Referendums wirkte im Vereinigten Königreich noch nach, als Donald Trump die amerikanische Präsidentschaftswahl gewann. Trump, dessen urheberrechtlich geschützter Wahlkampfslogan »Make America Great Again« lautete, brachte in das mächtigste gewählte Amt auf dieser Welt eine politische Vision mit, die auf einer scharfen Ablehnung sowohl der neoliberalen Zukunft der Globalisierung als auch der wissenschaftlich begründeten Erwartung des Klimawandels beruht, den Trump als Schwindel bezeichnet, den die Chinesen angeblich dem Rest der Menschheit vorgaukeln.44 Der einflussreichste Ideologe in seinem Stab, Steve Bannon, hat sich, seit er von seinem Posten entlassen wurde, der esoterisch-historischen Theorie verschrieben, die William Strauss und Neil Howe in einem Buch mit dem Titel The Fourth Turning:What Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny (New York 1997) skizzierten. Die Autoren behaupten darin, die Geschichte der Nationen verlaufe in 80- bis 100-jährigen Zyklen, unterbrochen von gewaltsamen Phasen der »Umwälzung«, die eine Generation lang anhalten könnten. Ob Präsident Trump selbst sich jemals mit diesen Ideen beschäftigt hat, ist nicht bekannt, aber auch er hat zumindest das herkömmliche amerikanische Geschichtsbild infrage gestellt, indem er als erster Präsident der Neuzeit ganz offen die Vorstellung zurückwies, die Vereinigten Staaten würden einen besonderen und paradigmatischen Platz an der Spitze des geschichtlichen Fortschritts einnehmen. Im Gegenteil sei Amerika, so ließ Trump durchblicken, heute ein rückständiges Land mit einer gespaltenen Gesellschaft und einer kaputten Infrastruktur, dessen Aufgabe es sei, auf eine Vergangenheit zurückzugreifen, wo amerikanische Werte noch unverfälscht und die amerikanische Gesellschaft noch intakt gewesen seien.45 »Wenn wir gewinnen«, sagte Trump 2016 vor Arbeitern in Moon Township, Pennsylvania, »bringen wir den Stahl zurück, wir werden den Stahl zurück nach Pennsylvania bringen, wie es früher war. Wir geben unseren Stahlarbeitern und unseren Bergleuten die Arbeit zurück. Das tun wir. Wir werden unsere einst großen Stahlunternehmen zurückbringen.«46 Gleichzeitig hat sein fieberhafter Kommunikationsstil eine Kluft zwischen der hyperschnellen Gegenwart von Twitter und den langsamen, abwägenden Prozessen aufgerissen, die das tägliche Brot der traditionellen, auf verfassungsmäßige Normen geeichten Demokratien und Verwaltungen sind.
In Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, Ungarn und anderen Ländern, die eine Wiedergeburt populistischer Strömungen erleben, werden neue Vergangenheiten konstruiert, um alte Zukunftsvorstellungen zu verdrängen. In ihrem Jubel über den Sieg Donald Trumps glaubte Marine Le Pen, die Anführerin des damaligen Front National (der heute Rassemblement National heißt), zu erkennen, dass sich die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten »ihre Zukunft zurückholt«; die Franzosen würden es ihnen nachmachen, prophezeite sie.47 Überlegungen zu der Frage, wie die Träger und Gestalter politischer Macht in einer kleinen Provinz der Vergangenheit ihre Politik verzeitlicht haben, werden kaum dazu beitragen, den zeitgenössischen Reiz solcher Manipulationen zu mindern, aber sie können uns zumindest helfen, sie aufmerksamer zu lesen.
EINS
–
DIE GESCHICHTSMASCHINE
Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm. Kupferstich von Pieter de Jode nach einem Porträt von Anselmus van Hulle.
© Martin Meyer, Theatri Europaei Achter Theil […] (Frankfurt/Main, 1693), S. 591. Im Besitz des Autors.
Friedrich Wilhelm, der als der Große Kurfürst bekannt ist, ist der erste Brandenburger Herrscher, von dem zahlreiche Porträts erhalten sind. Die meisten wurden vom Dargestellten selbst in Auftrag gegeben. Sie dokumentieren das sich verändernde Äußere eines Mannes, der 48 Jahre lang das Amt des Regenten innehatte – länger als jedes andere Mitglied seiner Dynastie. Abbildungen aus den frühen Jahren seiner Regierungszeit zeigen eine Ehrfurcht gebietende, aufrechte Gestalt mit einem langen, von dunklem, wallendem Haar umrahmten Gesicht; auf späteren Porträts ist der Körper aufgedunsen, das Gesicht geschwollen und die Haarpracht durch künstliche Locken ersetzt worden. Eines haben jedoch alle Porträts gemeinsam, die zu Lebzeiten entstanden sind: kluge, dunkle Augen, die den Betrachter mit scharfem Blick fixieren.1 Das hier abgedruckte Bild entstammt einem zeitgenössischen Album mit Bildnissen all jener Fürsten und Gesandten, die an den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden 1648 beteiligt waren.2
Friedrich Wilhelm setzte die Restauration – genaugenommen die Transformation – der zusammengesetzten Brandenburger Monarchie im Nachspiel des Dreißigjährigen Krieges ins Werk. Unter seiner Herrschaft, die von 1640 bis 1688 währte, erwarb Brandenburg eine kleine, aber ansehnliche Armee, eine Landbrücke durch Ostpommern bis an die Ostseeküste, eine bescheidene Ostseeflotte und sogar eine Kolonie an der Westküste Afrikas. Brandenburg stieg zu einer Regionalmacht auf, wurde zu einem begehrten Bündnispartner und hatte bei Friedensregelungen ein gewichtiges Wort mitzureden.3
Im Jahr 1667 verfasste Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, eine »Väterliche Ermahnung« für seinen Erben. Das Dokument begann nach Art eines traditionellen fürstlichen Testaments mit Ermahnungen, ein frommes und gottesfürchtiges Leben zu führen, weitete sich aber schon bald zu einem politisch-historischen Traktat aus, wie es in der Geschichte der Hohenzollern noch keinen gegeben hatte. Zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart wurden klare Gegensätze aufgezeigt. Das Herzogtum Preußen, erinnerte der Fürst seinen Erben, habe einst in dem »vnertraglichen zustande« der Vasallenpflicht der Krone Polens geschmachtet; erst der Erwerb der Souveränität über das Herzogtum habe diesem beklemmenden Zustand ein Ende bereitet. »… solches kan nicht alles beschriben werden. Das Archiwum vndt die Rechnungen werden etwas [davon] zeugen.«4 Der künftige Kurfürst wurde eindringlich aufgefordert, eine, wie man heute sagen würde, historische Perspektive auf die Probleme zu entwickeln, die ihn damals plagten. Ein eifriges Studium des Archivmaterials würde nicht nur zeigen, wie wichtig es war, gute Beziehungen zu Frankreich zu pflegen, sondern auch wie diese mit dem Respekt, »welchen Ihr, als ein Churfurst auf das Reich vndt den kayser haben musset«, in der Balance gehalten werden müssten. Ferner war ein starkes Eintreten für die neue Ordnung zu spüren, die durch den Westfälischen Frieden eingeführt worden war, und dafür, wie wichtig es war, sie notfalls gegen jede Macht oder alle Mächte zu verteidigen, die sich anschicken sollten, sie zu stürzen.5 Kurzum, es handelte sich um ein Dokument, dessen Schreiber sich seines eigenen Platzes in der Geschichte nur allzu bewusst war. Darüber hinaus war es vom Wissen um die Spannung zwischen kultureller und institutioneller Kontinuität und den Kräften des Wandels aufgeladen.
Um eben diese Spannung geht es im Folgenden. Es ist fraglich, ob der Kurfürst jemals eine kohärente Sichtweise der »Geschichte« entwickelte, im Sinne eines philosophischen Standpunkts zu ihrer Bedeutung oder ihrem Wesen. Er war ein Mann, der sich an Fragen der Macht und Sicherheit orientierte, der nicht zu spekulativen Überlegungen oder zur Erörterung von Grundsatzfragen neigte.6 Und »Geschichte« im heutigen Sinn, ein Abstraktum im Kollektivsingular, das einen allumfassenden, vielschichtigen Transformationsprozess bezeichnet, kannte man damals noch gar nicht. Das Wort hatte noch nicht den Prozess der Erweiterung und »Verzeitlichung« durchgemacht, der es zu einem der prägenden Begriffe der Moderne machen sollte.7 Doch der Kurfürst und sein Regime besaßen, wie dieses Kapitel ausführt, etwas Intuitiveres, eine höchst eigenständige und dynamische Form der Geschichtlichkeit, die in dem Gespür dafür wurzelte, dass sich der monarchische Staat an einem exponierten Ort an der Schwelle zwischen einer katastrophalen Vergangenheit und einer Zukunft voller Gefahren befand. Um diese These zu untermauern und ihre Implikationen zu erläutern, werden zunächst die Argumente untersucht, die im Konflikt zwischen der kurfürstlichen Regierung und den vom Adel dominierten Ständen vorgetragen wurden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Geschichtlichkeit8 gelenkt, die in den von beiden Seiten vorgebrachten Argumenten latent vorhanden ist. Indem der Fürst die Vorstellung der »Notwendigkeit« oder »Dringlichkeit« gegen die etablierten Ansprüche der traditionellen Machthaber auf Provinzebene ins Feld führte, spielte er nämlich im Grunde die Zukunft gegen die Vergangenheit aus. Anschließend gehe ich der Frage nach, ob die Historizität des Kurfürsten und seiner Regierung womöglich calvinistische Elemente enthält – immerhin waren konfessionelle Spannungen von Anfang an mit den Auseinandersetzungen zwischen der weitgehend calvinistischen Verwaltung des Kurfürsten und seinen lutherischen Ständen verwoben. Die Reformierte Kirche war das komplexeste geistige System, zu dem sich der Kurfürst bewusst bekannte. Ein letzter Abschnitt erörtert die Bemühungen der kurfürstlichen Regierung, sich die Dienste eines offiziellen Geschichtsschreibers zu sichern, wobei insbesondere die Schriften Samuel Pufendorfs untersucht werden, der wenige Monate vor dem Tod des Kurfürsten nach Berlin kam, um im Januar 1688 seine Stelle als offizieller Geschichtsschreiber anzutreten. In diesem Fall stelle ich die These auf, dass Pufendorf zunächst als Theoretiker überzeugende, philosophische Rechtfertigungen für die Konsolidierung der kurfürstlichen Macht lieferte und dann als Historiker ein ambitioniertes, in den Archiven recherchiertes Narrativ schuf, das die dynamische Geschichtlichkeit des Kurfürsten und seiner Beamten einfing. Das Kapitel schließt mit einem kurzen Exkurs zu der Frage, inwiefern die Ablehnung traditioneller Privilegien, die zu einem hervorstechenden Motiv der Herrschaft des Kurfürsten wurde, in der prunkvollen Zeremonie, welche die Krönung des ersten preußischen Königs im Jahr 1701 begleitete, ihren Ausdruck fand.
Zusammengesetzte Monarchie in einer Zeit des Krieges
Das Gemeinwesen, dessen Thron Friedrich Wilhelm im Jahr 1640 bestieg, war kein einheitlicher Staat. Es handelte sich um eine »zusammengesetzte Monarchie«, die auf unterschiedliche Weise erworbene Gebiete umfasste, welche wiederum unterschiedlichen Gesetzen und Herrschaftsverhältnissen unterlagen. Das Kernland war das Kurfürstentum Brandenburg, das die Hohenzollern im Jahr 1415 für 400 000 ungarische Goldgulden in ihren Besitz gebracht hatten. Mithilfe strategischer Heiratsbündnisse hatten aufeinanderfolgende Generationen der Hohenzollern Gebietsansprüche auf eine Reihe nicht zusammenhängender Gebiete in Ost und West erworben: das Herzogtum Preußen an der Ostsee und das Herzogtum Jülich-Kleve, einen Komplex rheinländischer Gebiete, dem Jülich, Kleve (Cleve), Berg und die Grafschaften Mark und Ravensberg angehörten. Dank einer bis ins Jahr 1530 zurückreichenden familiären Verbindung erhoben die Hohenzollern auch Anspruch auf die Nachfolge in Pommern, ein strategisch wichtiges Gebiet zwischen Brandenburg und der Ostsee.
Innerhalb ihrer diversen Besitzungen teilten die Kurfürsten von Brandenburg die Macht mit den regionalen Eliten, die in repräsentativen Gremien, den sogenannten Ständen, organisiert waren. In Brandenburg billigten die Stände vom Kurfürsten erhobene Steuern (oder auch nicht) und übernahmen (seit 1549) deren Einziehung. Im Gegenzug besaßen sie weitreichende Vollmachten und Zugeständnisse. Dem Kurfürsten war es beispielsweise untersagt, Bündnisse zu schließen, ohne zuvor die Zustimmung der Stände einzuholen.9 In einer 1540 veröffentlichten und bis 1653 bei verschiedenen Anlässen wiederholten Erklärung versprach der Kurfürst sogar, dass er »keine wichtige sache, doran der lande gedei und vorterb [Verderb] gelegen, ohn unserer gemeiner landstende vorwissen und raht schliessen oder furnehmen« werde.10 Der Landadel besaß den Löwenanteil des Grundbesitzes im Kurfürstentum; die Adligen waren außerdem die wichtigsten Geldgeber des Kurfürsten. Doch ihr Horizont war extrem beschränkt; sie hatten kein Interesse daran, dem Kurfürsten bei der Aneignung ferner Gebiete zu helfen, von denen sie kaum etwas wussten.
Die Stände wohnten in einer Vorstellungswelt gemischter und sich überschneidender Souveränitäten. Die Stände von Kleve unterhielten eine diplomatische Vertretung in Den Haag und wandten sich an die Republik der Niederlande, an den Reichstag (die Versammlung des Heiligen Römischen Reiches) und in manchen Fällen sogar an die Habsburger in Wien und baten sie um Unterstützung gegen rechtswidrige Eingriffe seitens Berlins.11 Sie träumten davon, ihr eigenes Steuersystem einzuführen und zusammen mit den Nachbargebieten Mark, Jülich und Berg eine ständische »erbliche Union« zu bilden, und korrespondierten häufig mit den Ständen dieser Gebiete darüber, wie man am besten auf Forderungen aus Berlin antworten (und ihnen Widerstand leisten) sollte.12 Die Stände im Herzogtum Preußen waren ihrerseits immer noch Untertanen der polnischen Krone; sie betrachteten das benachbarte Polen als Garantiemacht für ihre langjährigen Privilegien. Ein hoher kurfürstlicher Beamter etwa meinte einmal gereizt, die Führer der preußischen Stände seien treue Nachbarn der Polen und die Verteidigung des eigenen Landes sei ihnen gleichgültig.13
Im Zuge der Unruhen und Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) gerieten diese fein ausbalancierten Vereinbarungen unter Druck. In Brandenburg blieben die Stände weiterhin überaus skeptisch gegenüber Militärausgaben und jeglichen ausländischen Bündnissen. Sogar nach wiederholten Einfällen durch protestantische und kaiserliche Truppen in brandenburgisches Territorium stießen die Bitten um finanzielle Unterstützung seitens ihres Lehnsherrn auf taube Ohren.14 In ihren Augen war es ihre Aufgabe, unerwünschten Abenteuern vorzubeugen und das Geflecht provinzieller Privilegien gegen Vorstöße der Zentralregierung zu bewahren.15 Als sich der Krieg in die Länge zog, schienen jedoch die steuerlichen Privilegien des Brandenburgers Adels bedroht.16 Ausländische Fürsten und Generäle hatten nicht die geringsten Hemmungen, von den Provinzen Brandenburgs Kontributionen zu fordern; warum sollte Kurfürst Georg Wilhelm da nicht seinen Anteil verlangen? Das würde die Aufhebung der traditionellen »Freiheiten« der Stände bedeuten. Für diese Aufgabe wandte sich der Kurfürst an Graf Adam Schwarzenberg, einen Katholiken und Ausländer ohne Bindungen zum Landadel. Schwarzenberg verlor keine Zeit und führte kurzerhand ohne Rücksprache mit den üblichen Provinzorganen eine neue Steuer ein. Er schränkte die Befugnis der Stände, die Staatsausgaben zu überwachen, ein und entmachtete den Geheimen Rat, indem er dessen Zuständigkeitsbereiche dem Kriegsrat übertrug, dessen Mitglieder nach ihrer völligen Unabhängigkeit von den Ständen ausgewählt wurden. Kurzum, Schwarzenberg führte eine steuerliche Autokratie ein, die einen klaren Bruch zur ständischen Tradition vollzog.17 Der Adel hasste ihn am Ende regelrecht wegen seines Angriffs auf ihre ständischen Rechte. In den Jahren 1638/39, als Schwarzenberg auf dem Zenit seiner Macht war, kursierten in Berlin Flugblätter, welche die »hispanische Dienstbarkeit« seiner Herrschaft verunglimpften.18
Die Auswirkungen des Krieges auf das Herzogtum Kleve waren nicht ganz so dramatisch. Hier wurden wie in ganz Deutschland hohe Abgaben und Schutzgelder erhoben, als verschiedene Heere um die Kontrolle der strategisch wichtigen Region am Niederrhein kämpften. Doch die Besetzung der Gebiete am rechten Rheinufer durch niederländische Truppen brachte Geld ins Land, belebte den Handel und stärkte die politische Verbindung zu Den Haag. Während die Eingriffe des Grafen Schwarzenberg, im Verein mit den verbreiteten Verwüstungen, die Stände in Brandenburg geschwächt hatten, blieben die Stände von Kleve so mächtig wie eh und je und vertrauten weiterhin auf die politische Unterstützung der nahe gelegenen Vereinigten Provinzen, deren Garnisonen selbst nach Kriegsende noch in vielen Städten blieben.19
Das Herzogtum Preußen lag während des Dreißigjährigen Krieges außerhalb der am heftigsten umkämpften Regionen und entging so den massiven Zerstörungen, die Brandenburg erlebte. Hier hatten die Stände traditionell das Sagen, traten regelmäßig vollzählig zusammen und hatten die zentrale und lokale Regierung, die Miliz und die territorialen Finanzen fest im Griff. Das traditionelle preußische Recht, sich an die polnische Krone zu wenden, die formal auf dem Territorium immer noch die souveräne Macht war, bedeutete, dass die Stände nicht so ohne Weiteres zur Kooperation gezwungen werden konnten.20
Fürst gegen Stände
Im Dezember 1640, als Friedrich Wilhelm den Thron bestieg, befand sich Brandenburg noch unter fremder Besatzung. Im Juli 1641 wurde mit den Schweden ein zweijähriger Waffenstillstand ausgehandelt, doch die Plünderungen, Brandstiftungen und allgemeinen Übergriffe gingen weiter.21 Erst im März 1643 kehrte Friedrich Wilhelm aus dem relativ sicheren Königsberg im Herzogtum Preußen in das in Trümmern liegende Berlin zurück, in eine Stadt, die er kaum wiedererkannte. Er fand hier eine mittellose und unterernährte Bevölkerung und Gebäude vor, die von Bränden zerstört oder in einem desolaten Zustand waren.22 Das Dilemma, das die Herrschaft seines Vaters geplagt hatte, war noch nicht behoben. Brandenburg verfügte über keine Streitmacht, um seine Unabhängigkeit zu behaupten. Die kleine Truppe, die Schwarzenberg aufgestellt hatte, fiel bereits wieder auseinander, und es war kein Geld da, um einen Ersatz zu bezahlen. Im Herzogtum Kleve und in der Grafschaft Mark war der neue Kurfürst nur dem Namen nach der Souverän; die Gebiete waren immer noch von kaiserlichen, spanischen, niederländischen, hessischen und französischen Truppen besetzt.23 Was Pommern betraf, so blieb es aller Wahrscheinlichkeit nach auf absehbare Zeit unter schwedischer Besatzung. Johann Friedrich von Leuchtmar, ein Geheimer Rat und ehemaliger Hauslehrer des Kurfürsten, fasste die missliche Lage Brandenburgs in einem Bericht aus dem Jahr 1644 zusammen: Polen werde, sagte er voraus, Preußen einnehmen, sobald es stark genug sei; Kleve im Westen stehe unter der Kontrolle der niederländischen Republik. Kurzum, Brandenburg befand sich »in praecipitio«, sprich: am Rande des Abgrunds.24
Um die Unabhängigkeit seiner Monarchie wiederherzustellen und seine Gebietsansprüche durchzusetzen, brauchte der Kurfürst eine mobile und disziplinierte territoriale Streitmacht. Die Schaffung eines solchen Instruments wurde zu einem der alles beherrschenden Themen seiner Herrschaft.25 Außerdem brachte dieses Projekt den Kurfürsten auf Kollisionskurs mit den Ständen. In einem Brief vom Oktober 1645 an die Stände von Kleve erklärte er, dass er das gesamte Gebiet des Herzogtums mit eigenen Truppen besetzen müsse, um zu verhindern, dass er von Rivalen in der Region aus seinem Besitz vertrieben werde. Und »weil ja der Soldat vom Winde nicht leben kann«, bedeute dies die Fortsetzung besonderer Kontributionen. Sie seien notwendig, erklärte der Kurfürst, weil sich die Städte ohne eine Besatzungsarmee nicht halten ließen.
Und wollen Wir demnach nicht hoffen, dass ihr dasjenige, was bei diesen irregulären Kriegszeiten und ganz zerrüttetem Zustande, ja in casu extremae necessitas ubi privilegii ratio haberi semper non potest [in diesem Falle extremer Not, wo man nicht immer auf Privilegien bestehen kann], von Uns aus treuer guter landesväterlicher Intention zu Unserer Lande Rettung und Conservation, ja euerer und der eurigen selbst Wohlfahrt fürgenommen, auch nunmehr glücklich ins Werk gerichtet, für eine vorsätzliche wissentliche Infraction euerer dieserhalber angezogenen Privilegien (davon Wir gleichwohl der Zeit keinen gründlichen Bericht gehabt, auch noch jetzo nicht haben) [getroffen wurde], achten und halten, oder auch auf die Wiederabdankung dieser mit so trefflichen und schweren Kosten auf die Beine gebrachten Völker [=Truppen] und Demolirung der Fortificationen (als deren keines ohne Schwächung […] ja Unserer Lande äußerste Gefahr und Ruin nicht geschehen kann) beharren werdet.26
Das war ein recht loses Bündel von Argumenten. Unter anderem geschehe dies alles ja zur eigenen »Wohlfahrt« der Stände, doch das dürfte diese nicht überzeugt haben. In einer späteren Erklärung vor den Delegierten der »Clevischen Stände« in Königsberg untermauerte der Kurfürst diesen Anspruch noch und wies darauf hin, dass es zu Leid und Elend führen werde, sollten die Stände die Versorgung erfolgreich blockieren. Denn der Zusammenbruch der kleinen Heere des Kurfürsten würde das Herzogtum weiteren »feindlichen Attaquen und Belagerungen« aussetzen und somit »in äußersten Ruin und Gefahr« bringen.27 Noch eindringlicher war der Verweis auf die allgemeine Notlage, die seine Geldforderungen überhaupt erst hatte aufkommen lassen – allerdings ist die Sanftheit des Einschubs auf Latein bemerkenswert, die davon absieht, eine generelle Unterdrückung der Privilegien, selbst unter extremen Bedingungen, vorzuschlagen. Die Feststellung, dass der Kurfürst noch nicht in vollem Umfang davon in Kenntnis gesetzt worden sei, worin die fraglichen Privilegien tatsächlich bestünden, lässt auf eine gewisse Skepsis bezüglich des genauen Umfangs und der gesetzlichen Grundlage der ständischen Ansprüche schließen. Abschließend wurden sie ermahnt, dass eine Verweigerung der Kooperation verheerende Konsequenzen für den Fürst selbst und für seine Ländereien haben werde.
Mit diesen Argumenten rechtfertigte der Kurfürst die Kontributionen, die er von seinen Untertanen in Kleve einfordern wollte. Im Mittelpunkt stand die Behauptung, dass der Kurfürst keine andere Wahl habe, als so zu handeln. »Wir haben das gnädigste Vertrauen zu ihnen [den Ständen]«, erklärte er in einem Brief an seine Beamten in dem Herzogtum im November 1645, »sie werden es als eine unvermeidliche Nothwendigkeit gebührlich beherzigen«; in anderen Briefen war von einer »unumgänglichen Noth« oder von »äusserster Noth« die Rede.28
Das Patt zwischen dem Souverän und den Ständen von Kleve spitzte sich im Nordischen Krieg von 1655 bis 1660 zu.29 Im Jahr 1657 forderte Friedrich Wilhelm die Aushebung von über 4000 bewaffneten Männern und die Zahlung von 80 000 Reichstalern, um die neuen Truppen zu entlohnen und die Kosten für den Unterhalt von Garnisonen und Festungen zu decken. Als der Statthalter des Kurfürsten im Herzogtum, Moritz von Nassau-Siegen, den Ständen diese Bitte vortrug, stellte er fest, dass der Kurfürst sich so weit wie möglich bemüht habe, die Stände nicht mit weiteren Forderungen zu belasten. Nunmehr befinde er sich jedoch in einer Lage, wo er »den vorhabenden Friedenszweck« nur mit der Unterstützung von »dero getrewen Staenden und Unterthanen« verfolgen könne. Sollten sie ihn »verlassen«, warnte der Statthalter, so werde die »Noth« des Kurfürsten immer dringender werden und der ersehnte Frieden immer schwerer zu erreichen sein. »Und da nun ein getrewer freund in der noth erkant wuerde«, argumentierte er mit Bedingungen, die an die Logik einer Schutzgeldforderung erinnern, zweifle der Kurfürst nicht daran, dass die Stände sich als seine »Freunde« erwiesen und ihm zu Hilfe kämen.30
Als Antwort auf diese Belästigung schalteten die Stände von Kleve genau wie jene in anderen Ländereien des Kurfürsten auf stur und beharrten auf ihren ererbten Rechten und Privilegien. Im Jahr 1649 weigerten sich auch die Stände von Brandenburg, Mittel für einen Feldzug gegen die Schweden in Pommern zu genehmigen, ungeachtet der ernsten Ermahnung des Kurfürsten, dass alle seine Territorien nunmehr »Glieder eines Hauptes« (membra unius capitis) seien und dass Pommern deshalb unterstützt werden müsse, als sei es Teil der »Churf[ürstlichen] Lande«.31 In Kleve, wo das reiche, städtische Patriziat den Kurfürsten immer noch als einen ausländischen Eindringling betrachtete, ließen die Stände die traditionelle »Erbvereinigung« mit Mark, Jülich und Berg wiederaufleben; Wortführer zogen sogar Parallelen zu den zeitgenössischen Aufständen in England und drohten implizit, mit dem Kurfürsten genauso zu verfahren wie die parlamentarische Partei mit dem englischen König Karl. Friedrich Wilhelms Drohungen, militärische Strafaktionen durchzuführen, waren im Grunde wirkungslos, da die Stände von den niederländischen Garnisonen, die das Herzogtum immer noch besetzt hielten, unterstützt wurden.32 Als der Kurfürst im Nordischen Krieg den Druck erhöhte, wiesen die Stände darauf hin, dass es ihre grundlegende Pflicht sei, dafür zu sorgen, dass »folgende Generationen« (posteritet) nicht ihrer Privilegien beraubt würden. In einem klassischen Beispiel für ihre beschränkte Sichtweise erklärten die Stände, dass sich die Untertanen außerstande sähen, dem Kurfürsten bei diesem Krieg, der sie nicht betreffe, beizustehen. Sie versicherten dem Kurfürsten, dass es nicht ihre Absicht sei, mangelnden Respekt zu zeigen; es sei einfach Tatsache, dass die ihnen obliegende Pflicht »pro conservatione Privilegiorum et boni publici« sie daran hindere, der Bitte des Kurfürsten nachzukommen, selbst wenn sie es wollten. In den Augen der Stände schienen die »Bewahrung der Privilegien« und »das allgemeine Wohl« ein und dasselbe zu sein. Wie in anderen deutschen Ländereien antworteten hier lokale Eliten auf die Forderungen und einseitigen Maßnahmen des Fürsten, indem sie sich auf die Rechte eines »Vaterlands« beriefen, dessen »altbewährte Verfassung« zu verteidigen die Pflicht jedes edlen »Patrioten« sei.33
Im Herzogtum Preußen gestalteten sich die Verhandlungen mit den Ständen durch die weiterhin bestehende Autorität der polnischen Krone noch komplizierter. Hier besaßen die Stände das Recht, sich an eine Justiz zu wenden, auf die der Kurfürst keinerlei Einfluss hatte. Ihre Duldung des Anspruchs der Hohenzollern auf das Herzogtum war nur unter der Bedingung gewährt worden, dass die Übertragung der Lehnsherrschaft über das Herzogtum an das Kurfürstenhaus von Brandenburg keinerlei Einschränkung ihrer ständischen Privilegien nach sich zog. Die Jahrhunderthälfte vor der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms war von ambivalenten Strömungen geprägt gewesen: einerseits einer Ausdehnung der ständischen Rechte, welche die Vorrangstellung des Adels stärkte, andererseits in den 1620er und 1630er Jahren Anzeichen für eine Annäherung zwischen den preußischen Ständen und der Brandenburger Verwaltung.34 Aber auch in Preußen, wie in jedem anderen Land der Hohenzollern, sträubten sich die Stände gegen die Bitten des Kurfürsten um Geld und protestierten gegen jede Initiative seitens der kurfürstlichen Verwaltung, die das Geflecht ihrer traditionellen Befreiungen und Rechte antastete.
In den Ländereien der Hohenzollern betraf der Konflikt zwischen der zentralen Exekutive und den Inhabern der Provinzgewalt, wie überall in Deutschland und Europa, viele Themen: etwa das Recht, in wichtigen Fragen der Außenpolitik um Rat gefragt zu werden, das Recht, die Einführung neuer Steuern abzulehnen, die Vollmacht, das sogenannte »Indigenatsrecht«, lokale Beamte zu ernennen, und die überlieferten Mechanismen der ständischen Kontrolle über die Streitkräfte auf Provinzebene. Man kann nicht von einer generellen Auseinandersetzung sprechen: Es ging nicht um die völlige Abschaffung der Privilegien, und der Kurfürst lehnte nie grundsätzlich das Argument einer altehrwürdigen Abstammung ab, auch wenn seine Berater hier und da auf den ideologischen und manipulativen Charakter solcher Argumente hinwiesen.35 Das »Normgefüge«, das den Fürsten mit dem Landadel verband, wurde strapaziert, aber nicht zerschlagen.36 Friedrich Wilhelm hatte nicht die Absicht, seinen Staat in der Art und Weise, die ihm von manchen Historikern Anfang des 20. Jahrhunderts unterstellt wurde, in ein einheitliches, zentralisiertes Gemeinwesen umzuwandeln. Immer wieder musste er jedoch dafür plädieren, dass sich die Stände und die Regionen, die sie repräsentierten, als Teile eines einzigen Ganzen sehen sollten und damit auch als verpflichtet, sich am Erhalt und der Verteidigung aller Ländereien des Souveräns und an der Durchsetzung seiner legitimen Gebietsansprüche zu beteiligen.37 Diese Sichtweise war den Ständen fremd, sie betrachteten die jeweiligen Gebiete als gesonderte, verfassungsmäßige Parzellen, die auf vertikaler Ebene mit der Person des Kurfürsten verbunden waren, aber nicht auf horizontaler Ebene untereinander. Den Ständen der Mark Brandenburg galten Kleve und das Herzogtum Preußen als »ausländische Provinzen« ohne jeglichen Anspruch auf die Ressourcen Brandenburgs. Die langen Kriege Friedrich Wilhelms um Pommern waren ebenso lediglich private, fürstliche »Fehden«, für die er – in ihren Augen – nicht das Recht hatte, das hartverdiente Vermögen seiner Untertanen in Beschlag zu nehmen.38 Und diese Streitigkeiten spielten sich vor dem Hintergrund einer Polarisierung in der politischen und juristischen Theorie ab: Während manche Gelehrte in den deutschen Territorien die Ambitionen der Fürsten billigten, bestanden andere auf den alten Rechten der Stände und der Unrechtmäßigkeit jeder Steuer, die ohne ihre Konsultation und Zustimmung erhoben wurde.39
Formen der Geschichtlichkeit
Die Stände vertraten ihre Sache mit dem Verweis auf die Kontinuität mit der Vergangenheit. Vom Kurfürsten und seinen Beamten mit Forderungen nach Geld oder anderen Ressourcen konfrontiert, beharrten die Stände auf Beibehaltung und feierlicher Respektierung ihrer »speziellen und besonderen Privilegien, Freiheiten, Verträge, fürstlichen Befreiungen, Heiratsvereinbarungen, Gebietsverträge, alten Traditionen, Gesetz und Gerechtigkeit«. Die Interventionen des Fürsten waren eben deshalb unrechtmäßig, weil sie Neuerungen waren. Sie stellten einen Bruch mit der früheren Praxis dar. Die »traditionellen« Privilegien, Rechte, Freiheiten und so weiter waren genau deshalb legitim, weil sie alt waren. Der Diskurs der Stände trug den Stempel einer grundlegenden Wertschätzung für alles, was alt war: Es war eine Welt, in der Rechte und das Gesetz allgemein ihren Wert und ihre Achtbarkeit aus dem Umstand ableiteten, dass es sie schon seit langem gab.40 Für die Stände gab der Rückgriff auf Dokumente, welche die Privilegien und Freiheiten ihrer Väter und ihrer Vorväter garantierten, den Ausschlag – auf Dokumente, die dem Vernehmen nach Generationen von Fürsten gewährt und immer wieder neu bestätigt hatten. Das mag wie ein Verweis auf einen ererbten Rechtsanspruch aussehen, doch es war zugleich größer und diffuser: Es war ein konstruiertes, ständisches Gedächtnis des alten Rechts und Brauchs. So gesehen waren die Stände Beispiele für eine »erinnernde Rechtskultur«, wie sie für die regionalen Eliten der deutschen Länder charakteristisch war.41 In einem Entwurf für eine kurfürstliche Versicherung, den Repräsentanten der Stände des herzoglichen Preußen der Verwaltung in Königsberg vorlegten, fanden diese ausschweifende Worte für ihre eigenen, überlieferten Freiheiten:
[…] als geloben und versprechen Wir als dero natürlicher Erb- und Oberherr vor Uns, Unsere Erben und nachkommende Herrschaft bei kurfürstlicher Würde, Treu und Glauben in beständiger Form, als solches immer geschehen kann, dass Wir E. E. Landschaft von allen Ständen und einen Jeglichen insonderheit bei allen und jeden dieses Landes erlangeten und einverleibten Privilegien, Pacten, Recessen, Decreten und Responsen […] sie auch bei allen löblichen Ordnungen, Gebräuchen, Herkommen und Gewohnheiten, Pfand- und anderen Verschreibungen, Contracten, Hab und Güttern, Handvesten, Brief und Siegeln, Immunitäten, Gerichtsbarkeiten, Possessionen, Leibgedingen und Begnadigungen, so E. E. Landschaft in genere und in specie von Ordenszeiten hero bis zu dieser Stunden vom Orden, von Königlicher Majestät und der Krone Polen oder auch von Unseren hochlöblichen Vorfahren, Marggrafen und Kurfürsten zu Brandenburg seligster Gedächtnüss und von Uns selbsten oder in Unserem Namen von Unseren preussischen Oberräthen erlanget, gebrauchet und besessen, in allen ihren Punkten und Clausuln unverbrüchlich und unverändert ohne einige Exception schützen und erhalten wollen, dergestalt, dass auf keinerlei Art oder Weise zu Krieges- oder Friedenszeiten darwider gehandelt, noch Jemandem darwider zu handeln gestattet, sondern sobald über Verhoffen etwas denselben zuwider eingebrochen, solches unverzüglich auf Unserer getreuen Stände oder auch eines jeden Privati unterthänigstes Erinnern abgestellet und nach den Landesverfassungen und Gewohnheiten eingerichtet und, der dawider gehandelt, abgestraft werden solle.42
Im Gegensatz dazu begründete Kurfürst Friedrich Wilhelm seinen Anspruch, zu intervenieren und diese Regelungen zu ändern, mit der Notlage des Staates und seiner Bewohner. Der libertas der Stände setzt er die necessitas der Zentralgewalt entgegen, eine Notwendigkeit, die unter bestimmten Umständen die Aufhebung oder Aussetzung langjähriger, traditioneller Vereinbarungen rechtfertigen konnte.
Dieses Argument ließ sich auf zwei Arten vorbringen: Es konnte schlicht heißen, dass die zentrale Exekutive in Zeiten großer Not das Recht hatte, bestimmte Gewohnheitsrechte vorübergehend außer Kraft zu setzen. So ist die eher zurückhaltende lateinische Formulierung zu deuten, die der Kurfürst in seinem Brief aus dem Jahr 1645 an die Stände von Kleve verwendete: Er gab zu verstehen, dass man in einem Notfall »nicht immer auf Achtung der Privilegien« pochen könne (privilegii ratio haberi semper non potest).43 Mit einer merkwürdigen Umformulierung des gleichen Arguments berichtete Daniel Weimann, ein Beamter des Kurfürsten in Kleve, über eine Versammlung vom März 1657, auf der er die widerspenstigen Ständevertreter mit folgender lapidaren Feststellung konfrontierte: »Die Privilegien praesupponirten Unnoth«, soll heißen: die Privilegien konnten nur unter der Bedingung gewährt werden, dass keine Not herrschte.44 Nach der radikaleren zweiten Auslegung konnte das Argument von der Dringlichkeit oder Notlage jedoch auch bekräftigen, dass die zentrale Gewalt und ihre »Nothwendigkeiten« grundsätzlich und zu allen Zeiten Vorrang vor den historischen »Freiheiten« der Landstände hatten. An einer bemerkenswerten Stelle in seinem Tagebuch vom 22. März 1657 schilderte Weimann eine Unterhaltung mit einer Gruppe kurfürstlicher Beamter, in der er bemerkte, dass es besser wäre, die Versammlungen und Proteste der Stände zu ignorieren und einfach weiterhin unbegrenzt ohne lokale Billigung Truppen zu rekrutieren und Steuern zu erheben, denn »die nodt lidte kein Gesetz und entbinde von allen Banden«.45
Die provinziellen Verteidiger der Freiheit blickten auf die Vergangenheit und auf die vielfältigen Kontinuitäten mit der Gegenwart. Für sie hieß »Posteritet«, also Nachkommenschaft, lediglich die Bewahrung der in der Vergangenheit verbrieften Rechte zum Wohl künftiger Generationen.46