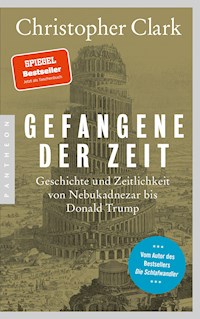Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Vorwort
Kapitel 1 - Kindheit und Jugend
Macht in der Familie
Wilhelm wird zum Rivalen
Die Persönlichkeit des Kaisers
Copyright
Für meinen Vater, Peter Dennis Clark
Vorwort zur deutschen Ausgabe
In den neunziger Jahren, als ich an der englischen Ausgabe des vorliegenden Buches arbeitete, war die Geschichtswissenschaft, die sich mit Wilhelm II. auseinandersetzte, noch stark gespalten in der Frage, über wie viel Macht der letzte Kaiser denn nun eigentlich verfügt hatte. An dem einen Pol der Debatte stand John Röhl, der Autor zahlreicher Monographien und Artikel, die den Kaiser in den Mittelpunkt des politischen Lebens des späten deutschen Kaiserreiches stellen. Am anderen Pol stand Hans-Ulrich Wehler; bei seinem gesellschaftsgeschichtlich orientierten Ansatz wird der Monarch an den Rand des politischen Geschehens gedrängt.
Die scharfen Konturen zwischen den beiden Lagern haben sich im Laufe der letzten zehn Jahre ein wenig verwischt. In einer wichtigen, 2002 veröffentlichten Studie stellte Wolfgang J. Mommsen eine vermittelnde These auf: Er erkannte die zentrale Stellung Wilhelms II. innerhalb der politischen Struktur an, vertrat aber die Ansicht, dass der Kaiser - mit verhängnisvollen Konsequenzen - von den preußisch-deutschen Machteliten instrumentalisiert worden sei. Im Zuge des kulturhistorischen Ansatzes ist der Brennpunkt der Debatte noch stärker verlagert worden, indem die Aufmerksamkeit von der reinen Berechnung politischer Machtverhältnisse auf die allgemeineren diskursiven und kulturellen Stützen der kaiserlichen Autorität gerichtet wird. Eine ganze Reihe von Studien von Martin Kohlrausch, Jost Rebentisch und Lothar Reinermann konzentrierte sich auf die außerordentlich starke Resonanz des Kaisers in der turbulenten Medienlandschaft des deutschen Kaiserreichs. In diesen Werken erscheint der Kaiser weniger als der Entscheidungsträger und Herr im Hause, sondern als ein zusammengesetztes und überaus dynamisches Image, das von den kritischen Kräften einer vielfältigen, kulturellen Elite projiziert wurde. Wolfgang Königs »technische Biographie« des Kaisers wiederum erweitert den Rahmen der Diskussion, indem sich der Autor auf die Rolle konzentriert, die der Kaiser in der Technikgeschichte der Wilhelminischen Ära einnahm.
Dennoch scheiden sich an der Persönlichkeit Wilhelm II. noch heute die Geister. Für John Röhl ist er immer noch die »Nemesis der Weltgeschichte«, das »Bindeglied« zwischen dem Wilhelminischen Kaiserreich und Auschwitz, gar der »Vorbote Adolf Hitlers«. Für Nicolaus Sombart hingegen ist Wilhelm II. der wohlwollende und charismatische Praktiker einer universalen Monarchie; von der anthropologischen Theorie durchdrungen, feiert Sombart in seiner ein wenig sonderlichen, aber aufschlussreichen Ehrenrettung den Kaiser als »Herrn der Mitte«, den man lieben muss, wenn man ihn wirklich verstehen will. Nicht zuletzt dieses Spannungsfeld der Interpretationen - ein ebenso ausgeprägtes Kennzeichen der zeitgenössischen wie auch der historischen Debatte - lenkte meine Aufmerksamkeit auf den deutschen Kaiser als Forschungsgegenstand. Die komplexe Persönlichkeit dieses Monarchen, seine Fähigkeit, mal schwülstig, dann wieder nachdenklich, brutal, naiv, eloquent, berechnend oder auch taktlos aufzutreten, trug zweifellos dazu bei, dass seine Herrschaft Raum für die unterschiedlichsten Bewertungen lässt. Das faszinierendste Merkmal der Kontroverse um diesen Mann und sein Auftreten im Amt ist mit Sicherheit die Tendenz, den Kaiser als die Symbolfigur größerer, historischer Zwänge zu betrachten. Für zeitgenössische Anhänger personifizierte Wilhelm II. die Macht und die schillernde Energie des deutschen Kaiserreiches in einem Zeitalter der Großmachtpolitik. In dem ernüchterten Umfeld Nachkriegsdeutschlands wurde »Wilhelm II.« - genau wie »Preußen« - zu einem Synonym für die Irrungen Deutschlands auf dem Weg in die Moderne.
Das vorliegende Buch, das muss betont werden, macht es sich keineswegs zur Aufgabe, den letzten deutschen Kaiser zu rehabilitieren. Aber es möchte Verunglimpfung und Verständnis wieder in die richtige Balance bringen. Es fragt nach der sich allmählich herauskristallisierenden Auffassung des Kaisers von seiner eigenen Rolle, nach seinem Platz innerhalb des komplexen Verfassungsgerüsts des kaiserlichen Deutschlands, seiner Fähigkeit, die Innen- und Außenpolitik zu prägen, der Beziehung zu den Medien und der Auswirkung des Kriegsausbruchs auf die Ausübung seiner Prärogative als Souverän.
Die deutsche Ausgabe ist leicht überarbeitet worden, so dass die wichtigsten Veröffentlichungen seit dem Erscheinen der englischen Ausgabe im Jahr 2000 berücksichtigt werden. Ich möchte an dieser Stelle Frau Dr. Heike Specht von der Deutschen Verlags-Anstalt für ihre sorgfältige Betreuung der deutschen Ausgabe, Herrn Norbert Juraschitz für die Übertragung aus dem Englischen und dem St. Catharine’s College in Cambridge für die Gesellschaft der liebenswürdigen Kollegen und einen friedlichen Ort zum Nachdenken und Arbeiten danken.
Christopher Clark
Cambridge 2008
Vorwort
Die Frage, wie viel Macht der letzte deutsche Kaiser wirklich ausübte, wird unter Historikern seit langem lebhaft diskutiert. Wurde das wilhelminische Reich in den letzten Jahrzehnten durch ein System des »persönlichen Regiments« regiert? War es eine Monarchie aus echtem Fleisch und Blut, in der die Persönlichkeit und die Vorlieben des Souveräns maßgeblich die politischen Ergebnisse prägten? Oder wurde die Macht auf »traditionelle Oligarchien« und »anonyme Kräfte« übertragen, die einen inkonsequenten »Schattenkaiser« an den Rand des politischen Geschehens abdrängten?1
Ein großer Teil der interessantesten Studien zu diesen Themen konzentrierte sich auf die Frage, ob der Begriff »persönliches Regiment« zu Recht auf die gesamte Herrschaft Wilhelms oder zumindest einen Teil angewandt werden kann. Die Diskussion um persönliche Herrschaft entflammte Anfang der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts und flackerte bis in die achtziger Jahre hinein immer wieder auf, geschürt von analogen Debatten über das Wesen und die Verteilung der Macht innerhalb des nationalsozialistischen Regimes. Mittlerweile ist aus ihr eine eigene hochintellektuelle Metaliteratur hervorgegangen, in der entgegengesetzte Standpunkte zur Macht und zum politischen Einfluss Wilhelms II. klassifiziert, miteinander verglichen und bewertet werden.2
Dieses Buch möchte die Diskussion um das »persönliche Regiment« keineswegs wiedereröffnen. So hilfreich die Diskussion auch war, indem sie die historische Forschung über Formen der Herrschaft mit allgemeineren Fragen zum Staatswesen des Reichs verknüpfte, so litt sie doch unter einer inhärenten Unsicherheit in puncto Definitionen. Das Schlagwort »persönliches Regiment«, das aus der wilhelminischen, politischen Polemik stammte, hatte damals für die jeweiligen Redner einen ganz anderen Sinn und hat eigentlich nie eine allgemein anerkannte oder konkrete Bedeutung erhalten - eine Tatsache, die den gelehrten Streit um die Anwendbarkeit des Begriffs auf die Herrschaft Wilhelms II. erheblich getrübt hat. Während sich die meisten Historiker, die den Begriff verwendeten, einig waren, dass er auf manche Teile der Herrschaft besser zutraf als auf andere, wurde kein Konsens in der Frage erzielt, wann denn das »persönliche Regiment« begann und wann es endete.3 Bemerkenswerterweise verzichtet selbst John Röhl, einst der wohl eifrigste Verfechter des »persönlichen Regiments«, inzwischen auf den Begriff zugunsten verschwommenerer Konzepte wie »Königsmechanismus« und »persönliche Monarchie«.4
Die vorliegende Studie konzentriert sich hingegen auf den Charakter und das Ausmaß der Macht des Kaisers, auf seine politischen Ziele und die Frage, was er wirklich erreichte, auf die Mechanismen, durch die er Autorität ausstrahlte und Macht ausübte, sowie auf die Schwankungen seiner Autorität im Verlauf der Herrschaft. Sie möchte die verschiedenen Formen von Macht, die Wilhelm auf mehreren Feldern ausüben konnte, ausloten, und zugleich die unzähligen Beschränkungen, auf die er dabei stieß. Das kaiserliche Amt war, wie wir sehen werden, kein Monolith, sondern eher eine lose Ansammlung von Funktionen (politische, diplomatische, religiöse, militärische, kulturelle, symbolische), deren wechselseitige Beziehung dynamisch und zu der Zeit, als Wilhelm II. den Thron bestieg, noch weitgehend ungeklärt war. Darüber hinaus sah sich der Kaiser gezwungen, sein Amt innerhalb eines überaus komplexen, politischen Systems auszuüben, in dem sich die Machtverhältnisse ständig veränderten. Das Amt des Kaisers war mit wichtigen Prärogativen der Exekutive ausgestattet, aber ob und auf welche Weise und mit welchem Erfolg er diese Vollmachten ausüben konnte, hing von Variablen ab, auf die er nur teilweise oder überhaupt keinen Einfluss hatte. Zudem stand sein Einfluss als politischer Akteur in einer komplexen und häufig nachteiligen Wechselwirkung mit seiner Autorität als öffentliche Persönlichkeit. Wichtige aktuelle Studien der Herrschaft Wilhelms II. haben bezeichnenderweise die Aufmerksamkeit von der Sphäre der hohen Politik weg und hin zu Wilhelms Präsenz in der pulsierenden Kultur des späten Kaiserreichs gelenkt.5 Das Buch erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit einer Biografie; es ist eine Studie über die Macht des Kaisers. Das Buch bietet dem Leser eine Synthese und Interpretation. Vor allen Dingen geht es der Frage nach: Welchen Einfluss hatte es auf die Geschicke Deutschlands und der Welt, dass gerade Wilhelm II. in den turbulenten Jahren zwischen 1888 und 1918 auf dem deutschen Kaiserthron saß?
1
Kindheit und Jugend
Macht in der Familie
Als Wilhelm II. im Januar 1859 geboren wurde, hatte sein Großvater den preußischen Thron noch nicht bestiegen. Unmittelbar vor Wilhelms zweitem Geburtstag, im Januar 1861, war es dann soweit und fast drei Jahrzehnte sollten vergehen, ehe der Großvater im hohen Alter von 90 Jahren im März 1888 starb. Vom frühen Kindesalter an erlebte Wilhelm seinen Vater, Friedrich Wilhelm, den preußischen Kronprinz, nicht als die einzige Respektperson in seinem Umfeld. Über dem leiblichen Vater stand ein weiterer, größerer Vater, eine Gestalt von beinahe mystischem Ansehen mit der Würde und dem Rauschebart eines biblischen Patriarchen. Der Großvater war nicht nur Herr über ein Königreich und von 1871 an der Gründer eines Kaiserreichs, sondern auch das Oberhaupt seines Haushalts - ein Umstand mit weitreichenden Implikationen für das Familienleben seiner Nachkommen.1 Im Oktober 1886 erklärte Wilhelm (im Alter von 27 Jahren) das Problem dem einstigen Freund und Vertrauten Herbert von Bismarck, dem Sohn des Kanzlers:
Der Prinz sprach dann noch mit Milde von seinem Vater und sagte, der noch nie dagewesene Fall der drei erwachsenen Generationen der Regentenfamilie mache es seinem Vater schwer: überall sonst, bei regierenden und anderen Familien, habe der Vater die Autorität und der Sohn hinge pekuniär von ihm ab. Ihm [Prinz Wilhelm] aber habe der Kronprinz gar nichts zu sagen, er bekäme nicht einen Groschen von seinem Vater, sondern stände ihm, da alles vom Familienoberhaupt ressortiere, ebenso unabhängig gegenüber wie etwa Prinz Albrecht: das sei für S. Ks. H. [Seine Kaiserliche Hoheit, der Kronprinz] natürlich nicht angenehm.
Diese seltsame Aufteilung der Macht zwischen Eltern und Großeltern war das wohl prägendste Merkmal der frühen Kindheit Wilhelms. Die Ferien der Prinzen, ihre Kleidung, militärischen Pflichten und repräsentativen Aufgaben unterstanden der letzten Entscheidungsgewalt ihres Großvaters König Wilhelms I. Der Hauslehrer wurde vom König berufen und beschäftigt, und dessen Einmischung in den Haushalt minderte erheblich den Einfluss der Eltern.2 Wie die Kronprinzessin im Sommer 1864 ihrer Mutter anvertraute, waren ihre Kinder so gesehen »öffentlicher Besitz«.3 Nachdem der König dem jungen Wilhelm und seinen Geschwistern im August 1865 die Erlaubnis verweigert hatte, ihre Eltern bei einer Reise nach England zu begleiten, beklagte sich die Kronprinzessin erstmals über die verstärkte Einmischung des Königs und der Königin in das Leben der Kinder.4
Vermutlich ließ es sich nicht vermeiden, dass zwischen zwei Generationen, die sich gleichermaßen verantwortlich für die Erziehung einer dritten fühlten, Spannungen auftraten, doch das Konfliktpotenzial wurde durch die Auseinandersetzungen zwischen Fraktionen und politischen Richtungen noch erheblich geschürt, die den Hof der Hohenzollern damals polarisierten. Seit den revolutionären Unruhen von 1848/49 war der Hof Friedrich Wilhelms IV. von zwei entgegengesetzten, politischen Lagern dominiert worden: von der westlich orientierten, konservativ-liberalen Partei und von den prorussischen Erzkonservativen. Die beiden Interessengruppen hatten in den fünfziger Jahren eifrig gegeneinander intrigiert - insbesondere während des Krimkriegs, als sie diametral entgegengesetzte, außenpolitische Linien befürwortet hatten -, und der Streit schwelte immer noch, als Wilhelms Mutter England im Jahr 1858 verließ, um mit ihrem Ehemann in Berlin einen neuen Haushalt zu gründen. Die Kronprinzessin stand der »Russenfraktion« absolut feindlich gegenüber. In ihren Augen zeichneten sich deren Vertreter durch »Boshaftigkeit«, »Eifersucht«, »Antipathie« und nicht zuletzt durch eine »Abneigung gegen die Engländer und alles, was Englisch ist«, aus. »Das Wohlwollen der russischen, reaktionären, pietistischen Fraktion ist mir völlig gleichgültig, und ich verachte ihre Denkweise von ganzem Herzen und hoffe auf Gott, dass ihre Zeit vorüber ist.«5
Die »Russenfraktion« war in der Religion streng dogmatisch oder evangelisch, in der Innenpolitik reaktionär und in der Außenpolitik nach Osten orientiert - damit bildete sie den kulturellen und politischen Antipoden zum Kronprinzenpaar und seinem Umfeld. Friedrich Wilhelm und Victoria waren in theologischer Hinsicht liberal, politisch fortschrittlich gesinnt, in der Außenpolitik orientierten sie sich nach Großbritannien und hegten gegen Russland ein tiefes Misstrauen. Allein diese Konstellation sorgte natürlich für immense Spannungen. Hinzu kam, dass Victoria, die liberalere der beiden und die dominante Persönlichkeit in der Partnerschaft, eine intelligente, redegewandte, rechthaberische und emotionale Frau war, die sich der eigenen Überlegenheit über ihr Umfeld durchaus bewusst war. Dank ihrer scharfsinnigen Beobachtungsgabe, ihres Außenseiterstatus und ihres starken Interesses an politischer Macht zählt Victorias Briefwechsel mit ihrer Mutter Königin Victoria von England zu den besten Quellen über das Leben am preußischen Hof. Mit diesen Eigenschaften wiederum aber machte sie sich bei den Konservativen am Hof nicht gerade beliebt. Sie hielten ihr forsches Auftreten für unziemlich und warfen der Kronprinzessin später gar vor, sie hätte ihren Mann dem eigenen politischen Willen unterworfen.
Anfangs war die dominierende Stellung der »Russen« bei Hof und in der Berliner Gesellschaft nicht mehr als ein lästiges Reizthema für den Kronprinzen und seine Frau. Doch die Dinge nahmen 1862 eine dramatische Wendung, als ein längerer Konflikt zwischen der Krone und der liberalen Mehrheit im preußischen Landtag in der Ernennung des bekanntlich illiberalen Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten und der Schließung des Landtags ohne die Ausschreibung von Neuwahlen kulminierte. Die »reaktionäre Partei« kontrollierte von jetzt an allein die Regierungsorgane und schickte sich an, ihre »russische« Agenda in der Außenpolitik umzusetzen.6 Viel schlimmer war aber, dass der Hof selbst nach rechts tendierte. Der König schwankte nicht länger zwischen den Fraktionen hin und her, wie Friedrich Wilhelm IV. es in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts noch getan hatte, sondern verbündete sich eindeutig mit den reaktionären Interessengruppen. »Die reaktionäre Partei wird von Tag zu Tag stärker«, schrieb Victoria im Juli 1862, »und hat den König jetzt ganz auf ihrer Seite und in ihrer Gewalt.« Im Sommer diesen Jahres lagen Kronprinz Friedrich Wilhelm und sein Vater auf politischer Ebene bereits so weit auseinander, dass eine rationale Unterhaltung so gut wie unmöglich war. Die leiseste Anspielung auf politische Angelegenheiten, berichtete Victoria, »bringen ihn [Friedrich Wilhelm] zur Raserei und regen die ganze Abwehrkraft in seiner Natur an, so dass es unmöglich ist, mit ihm zu diskutieren oder zu argumentieren«.7 Dem Kronprinzen und seiner Frau machte der Umschwung der politischen Stimmung bei Hofe ihre Isolation und Machtlosigkeit schmerzlich bewusst. »Das Gefühl der Demütigung ist am schwersten zu ertragen«, schrieb Victoria im Januar 1863. »Es bleibt uns nichts anderes übrig, wie als passive Augenzeugen der beklagenswerten Fehler zu schweigen, die von jenen begangen werden, die wir lieben und verehren.«8
Natürlich gab es auch eine Alternative zum Schweigen, und der Kronprinz und seine Frau waren in Wirklichkeit nicht völlig allein. In ganz Preußen stellte eine einflussreiche, liberale Bewegung weiterhin die Legitimität einer Regierung in Frage, die inzwischen ohne Parlament und im Widerspruch zur Verfassung herrschte. Am 5. Juni 1863 stellte sich der Kronprinz nach der Veröffentlichung neuer Dekrete, welche die Pressefreiheit einschränkten, zum ersten Mal öffentlich gegen die neue Regierung. Bei einem Empfang, der ihm zu Ehren von der Stadt Danzig gegeben wurde, distanzierte er sich von der Regierung Bismarck und äußerte sein Bedauern über die jüngsten, provokativen Maßnahmen. Das Ereignis war allerdings längst nicht von so großer Tragweite, wie man in diesem Moment zunächst glaubte. Friedrich Wilhelm hatte nicht den Mut, sich dauerhaft an die Spitze der fortschrittlichen Bewegung zu stellen. Er versicherte sogar seinem Vater, dass er künftig von derartigen Protesten Abstand nehmen werde.9 Für das Privatleben des Kronprinzen und seiner Frau, und somit auch für ihren noch kleinen Sohn Wilhelm, hatten die Ereignisse vom Juni 1863 jedoch langfristige Folgen. Mit diesem Auftritt zog das junge Paar den Zorn des Kanzlers auf sich, der sie fortan aus tiefstem Herzen hasste und dabei einen außergewöhnlichen Einfallsreichtum an den Tag legte. Mehrfach sollte er, der in den kommenden 30 Jahren die dominierende Kraft in der preußischen und deutschen Politik blieb, von nun an gegen sie intrigieren. Kurzfristig verschärften Friedrich Wilhelms öffentlicher Widerstand und Victorias ausdrückliche, persönliche Unterstützung für die Ansichten ihres Gatten die politische und gesellschaftliche Isolation des Paares am Hof: »Du kannst Dir nicht vorstellen, wie schmerzlich es ist«, schrieb Victoria im Juli 1863, »fortwährend von Menschen umgeben zu sein, die schon die eigene Existenz als ein Missgeschick und die eigenen Gefühle als Beweis für die eigene Verrücktheit ansehen!«10
Nur vor diesem Hintergrund kann man die feindseligen Reaktionen nachvollziehen, die von scheinbar nichtigen Streitigkeiten über das Training, die Schulbildung und die repräsentativen Pflichten des jungen Wilhelm und seiner Brüder ausgelöst wurden. Die Erziehung eines absolutistischen oder neo-absolutistischen Monarchen ist, wie John Röhl richtig bemerkt hat, »ipso facto immer ein Politikum ersten Grades«, weil sie die künftige Ausübung souveräner Macht betrifft.11 Im Fall des Hofs der Hohenzollern wurden diese Bedenken überlagert und noch erschwert durch die Parteienbündnisse, die den Kronprinzen und seine Umgebung vom herrschenden Monarchen und seinem Ministerpräsidenten entfremdeten. Die daraus folgende Polarisierung spiegelte sich in zwei entgegengesetzten pädagogischen Idealen wieder: ein anglophiles, liberal-bürgerliches, gestützt auf die Kultivierung staatsbürgerlicher Tugenden und sozialer Verantwortung, und ein altpreußisches, aristokratisches, gestützt auf die Kultivierung militärischer Fertigkeiten und Disziplin. Das wurde deutlich, als »zivile« und »militärische« Hauslehrer für Prinz Wilhelm gesucht werden mussten. Der erste von seinen Eltern zum zivilen Hauslehrer ausgewählte Kandidat musste wegen seiner progressiven, politischen Verbindungen fallen gelassen werden; am Ende fiel die Wahl auf Georg Ernst Hinzpeter, einen Mann mit engen, wenn auch indirekten Verbindungen zur »Partei des Kronprinzen«, der die ausschließliche Verantwortung für die Erziehung des Prinzen beanspruchte und auch bekam. Er blieb bis zu Wilhelms 18. Lebensjahr sein ziviler Hauslehrer. Hinzpeter legte die Ausrichtung der frühen Erziehung Wilhelms fest und verordnete ihm einen anspruchsvollen Stundenplan mit Unterricht in Latein, Geschichte, Religion, Mathematik und modernen Sprachen, der um sechs Uhr morgens begann und sechs Uhr abends endete (im Winter eine Stunde später). Ein wenig Abwechslung zur Routine boten allerdings erbauliche Besuche in Bergwerken, Werkstätten, Fabriken und Häusern der armen Arbeiter an Mittwoch- und Samstagnachmittagen.
Es kam auch zu Konflikten um die jeweiligen Befugnisse und Zuständigkeiten der beiden Hauslehrer. Der erste »Militär-Gouverneur« des Prinzen kündigte seine Anstellung, als er erkannte, dass Wilhelms Eltern Hinzpeter den Löwenanteil an der Verantwortung für die Erziehung des Kindes zugedacht hatten. Nach seinem Rücktritt im Jahr 1867 kam es zu einem Streit um seinen Nachfolger, in den sogar das Gefolge des Königs unmittelbar hineingezogen wurde. »Wir haben unsere Ansicht glücklich durchgesetzt […]«, schrieb Victoria an ihre Mutter, »aber ich halte diese Einmischung in unsere Angelegenheiten für zu ärgerlich. Du machst Dir keine Vorstellung davon, welche Mühe die herrschende Partei sich gibt, ihre Spione in unseren ganzen Hof zu schleusen, noch davon, wie sehr sie uns hassen.«12
Die repräsentativen Pflichten der Prinzen waren ein weiterer Anlass zur Sorge für die Kronprinzessin und ihren Mann. Im August 1872 gestand sie ihr »Entsetzen«, als sie hörte, dass Wilhelm zu Ehren eines Besuchs des russischen Zaren eine russische Uniform werde tragen müssen. »Ich werde natürlich nicht gefragt, und alle diese Dinge werden arrangiert, ohne dass ich in der Angelegenheit etwas zu sagen hätte.«13 Nicht zuletzt zu dem Zweck, die Jungen aus der zwanghaften Umgebung des Hofes zu entfernen, baten Victoria und Friedrich Wilhelm den Kaiser eindringlich um die Erlaubnis, sie auf eine allgemeine Schule zu schicken, damit sie mit gleichaltrigen Kindern aufwuchsen. Wie John Röhl treffend bemerkte, war die Entscheidung, Wilhelm auf das Lyceum Fredericianum in Kassel zu schicken, »ein Experiment ohne Vorgang«. Kein einziger Prinz der Hohenzollern war bislang auf diese »bürgerliche« Art erzogen worden. Es war ein Schritt, der die sich wandelnden Konzeptionen der fürstlichen Erziehung wiedergab, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus: Georg V. wurde ebenfalls zur Ausbildung in die Kompanie aus Gleichaltrigen am Naval College geschickt, und selbst der jugendliche Kaiser Hirohito besuchte eine weiterführende Schule in Tokio.14 Wilhelm hätte natürlich auch auf ein Gymnasium in Berlin gehen können, aber seine Mutter sprach sich dagegen aus, mit der Begründung, die einzige geeignete Schule in der Hauptstadt sei politisch zu »reaktionär«.15
Wie nicht anders zu erwarten, stieß der Plan auf massiven Widerstand des Kaisers; erst nach einer längeren »Belagerung von allen Seiten mit mehreren Geschützen« konnte er zur Einwilligung überredet werden. Wie Victoria in einem Brief an ihre Mutter feststellte, konnte der Kaiser den jungen Wilhelm »jetzt nicht mehr zwingen, bei allen möglichen Gelegenheiten in Berlin aufzutreten und sich in der Welt zu zeigen - es war der einzige Weg, den Kaiser an diesem grotesken Vorhaben zu hindern«.16 Der Umzug nach Kassel war ein Sieg für die pädagogischen Ideale des Kronprinzen und seiner Frau. Wilhelms Einschreibung in das Kasseler Gymnasium im Jahr 1874 war mit längeren Abwesenheiten aus Berlin und, noch wichtiger, mit einer Befreiung von militärischen Pflichten bis zu seinem 18. Lebensjahr verbunden. (Wilhelm war seit seinem zehnten Geburtstag dem 1. Garderegiment zu Fuß zugeteilt.) Die Unterordnung unter ein hartes und meritokratisches, pädagogisches Regime sollte ebenfalls dazu dienen, Wilhelm die Arroganz und die fürstlichen Allüren auszutreiben, die von der Speichelleckerei und Selbstdarstellung des Hoflebens gefördert wurden.
Die Kronprinzessin verfolgte stets misstrauisch die Rolle, die das Militär bei der Sozialisierung ihres ältesten Sohnes spielte, und reagierte überempfindlich auf alle Anzeichen, die auf eine Assimilierung Wilhelms an das militärisch-reaktionäre Ethos hindeuteten. Bereits im Februar 1871, als der Prinz zwölf Jahre alt war, behauptete sie, an Wilhelm »eine gewisse Empfänglichkeit für die platten, bornierten Auffassungen des Militärs« entdeckt zu haben.17 Vor allem ihrem Einfluss war es zu verdanken, dass ihr Sohn in den Genuss einer - gemessen am Standard der Erziehung eines Hohenzollern-Prinzen - bemerkenswert unmilitärischen Erziehung kam. Bis zum Abschluss seiner Hochschulbildung an der Universität Bonn wurde Wilhelms militärisches Pflichtprogramm entschieden den Anforderungen seiner »zivilen« Bildung untergeordnet. Das erklärt auch die Tatsache, dass Wilhelm trotz seiner unbestrittenen Neigung zu Kultur und Ambiente des Soldatenlebens - er hegte eine besondere Vorliebe für Uniformen - offenbar nie die Haltung der Selbstunterordnung und Disziplin verinnerlichte, die eine voll ausgeprägte, militärische Erziehung in Preußen eigentlich erreichen sollte. Er tat sich mit Zurechtweisungen oder sogar Ratschlägen von vorgesetzten Offizieren schwer. Selbst sein militärischer Adjutant Hauptmann Adolf von Bülow, der immerhin fünf Jahre, von 1879 bis 1884, an der Seite Wilhelms zugebracht hatte, räumte ein, dass es ihm nicht gelungen sei, die Auswirkungen der Erziehung des Prinzen zu korrigieren; Wilhelm hatte zwar das äußere Brimborium übernommen, aber nicht die Wertvorstellungen und Geisteshaltung eines preußischen Offiziers.18 Wilhelm war keineswegs das Geschöpf Potsdams und der Kasernenhöfe, das manche populäre Biografien von ihm gezeichnet haben, sondern ein militärischer Dilettant. Bei allen, oft geäußerten Bedenken muss der Plan seiner Mutter, den Zugriff des Militärs auf ihren Sohn zu untergraben, als Erfolg gewertet werden. Ob die seltsame Mischung aus Hinzpeter, Potsdam, Kassel und Bonn, die Wilhelms Erziehung schließlich ausmachte, nun wirklich eine Verbesserung gegenüber dem traditionellen Modell war, ist eine ganz andere Frage. Es spricht manches für die Vermutung, dass die merkwürdige Unschlüssigkeit der Erziehung Wilhelms, das Schwanken zwischen gegensätzlichen Lebenswelten sowie das Fehlen eines einheitlichen Themas die Herausbildung einer kohärenten Anschauung oder eines stabilen Verhaltenskodexes zumindest hemmte.
Wilhelm wird zum Rivalen
An den periodisch ausbrechenden Streitigkeiten hinsichtlich Wilhelms Erziehung lässt sich der Einfluss der Generationskonflikte, persönlichen Animositäten und Polarisierung der Fraktionen auf das frühe Leben des Prinzen ablesen. In diesen Reibereien spielte Wilhelm noch eine passive Rolle; er war ein Bauer auf dem politisch-strategisch Schachbrett anderer Personen. An einem bestimmten Punkt muss ihm jedoch bewusst geworden sein, dass er durch die langjährige Fehde zwischen seinen Eltern und der regierenden Partei einen gewissen Spielraum für sich gewinnen konnte. Ein eindeutiger Schritt in dieser Richtung war im Jahr 1883 zu beobachten, als der 24-jährige Wilhelm von seinem Vater gebeten wurde, ihn bei einem offiziellen Besuch in Spanien zu begleiten. Er hatte nicht die geringste Lust mitzufahren, aber statt sich dem Vater direkt zu widersetzen, bat er insgeheim seinen Großvater - dieser hatte schon zuvor aus seiner Skepsis gegenüber der kostspieligen Exkursion kein Hehl gemacht -, die Reise mit der Begründung zu verbieten, es sei nicht wünschenswert, wenn Wilhelm zum jetzigen Zeitpunkt sein Bataillon verlasse. Dieser erfolgreiche, taktische Schritt dürfte mit ziemlicher Sicherheit nicht der erste dieser Art gewesen sein. Als Friedrich Wilhelm nämlich herausfand, was im November 1883 wirklich geschehen war, warf er seinem Sohn in einer hitzigen Auseinandersetzung vor, »schon lange […] direkt mit dem Kaiser mit Umgehung der Eltern zu verkehren«.19
In dieser Zusammenarbeit zwischen Kaiser Wilhelm I. und seinem Enkel spiegelte sich ein langer Prozess einer emotionalen Neuorientierung innerhalb der Familie wieder. Bereits seitdem er etwa 15 Jahre alt war, pflegte Wilhelm eine zunehmend innige und vertrauliche Beziehung zu seinem Großvater. Anfang der achtziger Jahre begann die Intimität zwischen den beiden mehreren Zeitgenossen aufzufallen.20 Und um 1880 gab es auch Anzeichen für eine wachsende Distanzierung von seinen Eltern. Das war vor allem seit der Verlobung Wilhelms im April 1879 mit Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg auch eine Folge des Wunsches nach größerer privater Autonomie. Wilhelms Eltern, insbesondere seine Mutter, waren maßgeblich an der Anbahnung dieser Ehe beteiligt, gegen die Proteste derjenigen, die den relativ niederen Stand der Braut ablehnten (einschließlich des Kaisers). Aber wenn Wilhelms Mutter geglaubt hatte, durch die Heirat würde sie ihrem Sohn näher kommen, so hatte sie sich getäuscht. Die anglophobe, engstirnige und durch und durch fromme »Dona«, wie Auguste Victoria von Freunden genannt wurde, entpuppte sich schon bald als »treue Stütze gerade jener Kräfte, die das Kronprinzenpaar bis aufs Messer bekämpften«.21 Zu der wachsenden Entfremdung zwischen den beiden Haushalten kam Wilhelms immer ausgeprägtere Ablehnung der liberalen, politischen Anschauungen, die den Kronprinzen und seine Frau am Berliner Hof in die Defensive gezwungen hatten. Im Verlauf mehrerer unerfreulicher Auseinandersetzungen mit seinem Vater Anfang der achtziger Jahre machte Wilhelm deutlich, dass seine Sympathien dem herrschenden Regime galten. In diesem Vater-Sohn-Konflikt lag eine geradezu unheimliche Unvermeidlichkeit: Friedrich Wilhelm hatte seit 1862 die Politik seines Vaters abgelehnt, und Wilhelm I. hatte sich, weil sein Vater nicht mehr lebte, in den vierziger Jahren dem herrschenden Monarchen Friedrich Wilhelm IV. widersetzt. Im Ersten Weltkrieg wurde Wilhelm II. Opfer desselben Automatismus, als sein eigener Sohn, Kronprinz Friedrich Wilhelm, offen die Autorität seines Vaters in Frage stellte. Das Besondere an den achtziger Jahren war das gleichzeitige Nebeneinander dreier erwachsener Generationen, das es ermöglichte, dass die älteste und die jüngste gemeinsame Sache gegen die mittlere machten.
Der enge Kontakt Wilhelms zum Monarchen zahlte sich 1884 zum ersten Mal in politischer Hinsicht aus, als er zum Leiter einer wichtigen, zeremoniellen Mission nach Russland auserwählt wurde. Es gab gute Gründe dafür, Wilhelm an der Stelle seines Vaters zu schicken, insbesondere die »lächerlich antirussische Haltung« des Letzteren (Holstein),22 aber Friedrich Wilhelm hatte zu Recht das Gefühl, dass er bewusst übergangen worden war. Immerhin wurde er erst informiert, als die Entscheidung bereits getroffen war. Wilhelm erwartete zurück in Berlin seitens der Eltern ein kühler Empfang. »Prinz Wilhelm wurde bei seiner Rückkehr hierher von allen Seiten auf das herzlichste empfangen außer von seinen Eltern. Sie hatten zuviel Gutes über ihn hören müssen […]«, beobachtete Graf Waldersee, der den Prinzen auf der Reise begleitet hatte. »Wer sich bei ihnen insinuieren will, muss vom Sohne schlecht sprechen [...]«23
Wilhelms zwölftägige Russlandreise war ein Erfolg. Er verstand sich gut mit Zar Alexander III. und machte allem Anschein nach großen Eindruck bei seinen russischen Gesprächspartnern.24 Überdies nahm er die seltsame Gewohnheit an, seinem Großvater direkt schriftlich Bericht zu erstatten, und provozierte damit einen Protest seitens des deutschen Botschafters in St. Petersburg, der den Eindruck hatte, die »Geheimdiplomatie« des Prinzen untergrabe seine Stellung. Noch bevor Wilhelm russisches Territorium verlassen hatte, begann er sogar, mit Bismarcks stillschweigendem Einverständnis, eine »Geheimkorrespondenz« mit dem Zaren, in der er sich selbst dem russischen Herrscher als standhafter Gegner der Russland-feindlichen Haltung seines Vaters präsentierte. In einem charakteristischen Brief, den Wilhelm kurz nach der Rückkehr schrieb, drängte er den Zaren, die Ausbrüche seines Vaters nicht allzu ernst zu nehmen: »Du kennst ihn, er liebt die Opposition, steht unter dem Einfluss meiner Mutter, die, ihrerseits von der Königin von England dirigiert, ihn alles durch die englische Brille sehen lässt. Ich versichere Dir, dass der Kaiser, Fürst Bismarck und ich völlig miteinander übereinstimmen und dass ich nicht aufhören werde, die Festigung und die Aufrechterhaltung des Dreikaiserbundes als meine höchste Pflicht anzusehen.« Ein Brief vom Juni 1884 informierte den Zaren über die extreme Feindseligkeit von Wilhelms Vater gegenüber der Politik des russischen Monarchen und seiner Regierung: »Er (Papa) beschuldigte die Regierung der Lüge, des Verrats, usw., es gab schließlich kein hasserfülltes Adjektiv, dessen er sich nicht bediente, um Euch anzuschwärzen.«25
Im folgenden Jahr hielt Wilhelm mit Bismarcks Unterstützung weiterhin den »heißen Draht« zum Zaren aufrecht. An dieser verblüffenden Verletzung der familiären Privatsphäre gegenüber einem ausländischen Monarchen lässt sich ablesen, wie entschlossen Wilhelm an der Schärfung seines eigenen Profils arbeitete, indem er sich die Animositäten und politischen Spaltungen am Hof der Hohenzollern zunutze machte. Die Russlandreise von 1884 schuf ferner wichtige Präzedenzfälle für das spätere Verhalten Wilhelms als Monarch. Es war nicht das letzte Mal, dass Wilhelm kurzerhand eine diplomatische Rolle usurpierte, für die er weder geschult noch instruiert worden war. Während seiner ganzen Herrschaft neigte er, wie der berühmte »Willy-Nicky«-Briefwechsel schließen lässt, dazu, Diplomatie im eng dynastischen Sinn zu interpretieren und den Einfluss des persönlichen Verkehrs zwischen Monarchen auf die internationalen Beziehungen zu überschätzen.
Eine langwierige Auseinandersetzung wegen der geplanten Heirat von Wilhelms Schwester Viktoria, »Moretta« genannt, mit Prinz Alexander von Battenberg, Fürst von Bulgarien, vertiefte den Graben am Hof und bot Wilhelm weitere Gelegenheit zur Selbsterhöhung. Das Projekt entwickelte sich zu einem komplexen und weitverzweigten politischen Konflikt, der hier nur in groben Zügen wiedergegeben werden soll.26 Die Kronprinzessin hatte sich schon 1882 für eine Verbindung zwischen ihrer Tochter und »Sandro« Battenberg ausgesprochen, und nach einer Begegnung ein Jahr später betrachtete sich das Paar selbst offenbar als verlobt. Doch der Plan wurde von Kanzler Bismarck energisch abgelehnt, der in erster Linie wegen der Auswirkung der geplanten Heirat auf die deutschen Beziehungen zu Russland Einspruch erhob. Battenberg war ursprünglich von den Russen 1878 als Marionettenherrscher in Bulgarien eingesetzt worden, da er sich in der Folge jedoch mit der nationalen Bewegung für die Vereinigung und Unabhängigkeit Bulgariens identifiziert hatte, war er in direkten Gegensatz zur russischen Politik auf dem Balkan geraten. Mittlerweile war er in St. Petersburg eine persona non grata. Bismarck war der Ansicht, dass die Heirat einer Hohenzollern-Prinzessin in die Familie der Battenbergs die guten Beziehungen zu Russland untergraben würde, die der Dreh- und Angelpunkt seiner Außenpolitik waren. Für die Kronprinzessin hingegen war gerade die »antirussische« Tendenz der Heirat der Hauptanreiz. Mit der Unterstützung ihrer Mutter Königin Victoria hoffte sie durch ein stärkeres deutsches Engagement in Bulgarien, die Grundlage für eine Koalition zu schaffen, die den russischen Einfluss auf dem Balkan eindämmen sollte. Das Beste wäre es, schrieb sie im Juni 1883 an ihre Mutter, »wenn England, Österreich, Italien und Deutschland sich zusammentun könnten, zum Beispiel Bulgarien unterstützten, damit dieses Land eine wirkliche Barriere gegen russisches Vorgehen nach Konstantinopel bilde«.27 Hier lebte der alte Streit zwischen »Westlern« und »Russen« erneut auf, der traditionell die außenpolitischen Debatten in Preußen erhitzte.
Im Sommer 1884 hatte sich eine mächtige, von Bismarck und dem Kaiser angeführte Koalition gebildet, welche die Heirat aus politischen wie auch aus dynastischen Gründen ablehnte.28 Der Streit um Battenberg zog sich durch die ganzen achtziger Jahre hindurch und säte immer wieder von neuem Zwietracht. Selbst nachdem der Prinz abgedankt hatte und durch einen von Russland unterstützten Staatsstreich im August 1886 aus dem Land vertrieben worden war, fanden Victoria und - mit gelegentlichen Bedenken - der Kronprinz noch Gefallen an der Idee der Heirat und erwogen sogar, für den Prinzen einen hohen Posten in der deutschen Verwaltung zu suchen. Ende 1887 gewann die Angelegenheit noch an Brisanz, als das antirussische Auftreten des gewählten Nachfolgers Alexander von Battenbergs, Prinz Ferdinands von Sachsen-Coburg-Kohary, internationale Spannungen um Bulgarien förderte und Angst vor einem Balkankrieg auslöste. Wie zu erwarten, schloss sich Wilhelm der Anti-Battenberg-Fraktion an. Seinem Großvater überbrachte er Berichte über geheime Treffen zwischen seiner Schwester und dem Prinzen. In einer Diskussion mit Bismarcks Sohn Herbert - zweifellos für die Ohren des Kanzlers bestimmt - dachte Wilhelm sogar laut darüber nach, ob er Battenberg nicht »[zum Duell] provozieren und ihm meine Kugel vor den Kopf schießen« solle.29
Wilhelms vehementer Widerstand gegen die Battenberg-Heirat und sein offensichtliches Engagement für Bismarcks »russische« Außenpolitik wurden mit einem weiteren, herausragenden Auftrag belohnt: Im August 1886 wurde beschlossen, Wilhelm zu einem Treffen mit dem Zaren nach Russland zu schicken, diesmal allerdings nicht zur Repräsentation, sondern zu politischen Gesprächen auf höchster Ebene über die russischen Interessen auf dem Balkan. Man hoffte, dass die Mission von dem guten Eindruck profitierten werde, den Wilhelm bei seinem ersten Besuch im Jahr 1884 hinterlassen hatte. Einmal mehr hatte Kronprinz Friedrich Wilhelm, mit Recht, das Gefühl, dass man ihn übergangen hatte. In einer schriftlichen Beschwerde an Bismarck protestierte er gegen die Entscheidung und fügte gekränkt hinzu, dass er nicht persönlich über die Entscheidung informiert worden sei, sondern sie »durch Zeitungen wie durch Gerüchte« erfahren habe.30 Als der Kanzler erwiderte, die Vorbereitungen für Wilhelms Reise seien bereits bekannt gegeben worden und könnten nicht mehr geändert werden, wies der Kronprinz auf die gesundheitliche Konstitution seines Sohnes hin (Wilhelm erholte sich gerade von einer Erkältung.) Er bot sogar an, selbst »die Reise nach Russland zu machen, da ich es überdies für nützlich halte, auch meinerseits zur Betonung des Wunsches nach Erhaltung korrekter Beziehungen zu Russland mit beizutragen«.31 Die einflussreichsten Persönlichkeiten am Hof sprachen sich jedoch rasch einmütig gegen eine solche Änderung des Planes aus. »Die Courtoisie«, also Höflichkeit, werde zwar durch einen Besuch des Kronprinzen »formell noch größer«, teilte Bismarck am 17. August dem Kaiser mit, »andererseits aber sei die Gefahr vorhanden, dass Kaiser Alexander und der Kronprinz wegen des Battenbergers, den der eine hasst und der andere liebt, aneinander geraten würden«. Dieses Argument leuchtete dem Kaiser ein, der zustimmte, dass sein Sohn »kein geeigneter Verkehr für den Kaiser Alexander« sei.32 Auf seine charakteristisch extravagante Weise verinnerlichte auch Wilhelm selbst das Argument. In einem Brief an Herbert von Bismarck vom 20. August warnte Wilhelm, falls sein Vater entsandt werde, so werde dieser »dem Kaiser v. Russland Vortrag über England und die Tapferkeit des Bulgaren halten! Es wäre für uns alle das Verderben, ginge er hin!«33
Wenn Wilhelm zu einer besonderen Beförderung in einem Bereich der Verwaltung ausersehen worden wäre, sei es mit oder ohne Rücksprache der Eltern, dann wäre der Kronprinz mit Sicherheit nicht so pikiert gewesen. Aber in den absolutistischen und neo-absolutistischen Regimes des 19. Jahrhunderts in Europa wurde die Diplomatie als die Domäne der eigentlichen Politik angesehen, als die höchste Sphäre der Ausübung souveräner Gewalt und die höchste Tätigkeit des Staates. »Mir sind die auswärtigen Dinge an sich Zweck«, hatte Bismarck 1866 erklärt, »und stehen mir höher als die übrigen.«34 Dieses subjektive »Primat der Außenpolitik« als die herausragende Berufung der Monarchen und Staatsmänner erklärt nicht zuletzt, weshalb Wilhelms wachsende Beteiligung an der deutschen Politik einen neuralgischen Punkt beim Kronprinzen und seiner Frau berührte. Wilhelm erhob nunmehr Anspruch auf ein Feld, das für die Ambitionen Friedrich Wilhelms als künftigem Monarchen von zentraler Bedeutung war.
Dasselbe Thema sorgte im Herbst und Winter 1886 für weiteren Ärger, als sich abzeichnete, dass Wilhelm, auf Bismarcks Anregung hin, in die Funktionsweise des Auswärtigen Amtes eingeweiht werden sollte.35 Der Kronprinz erhob schriftlich beim Kanzler Einspruch gegen diesen Schritt und begründete ihn mit der »mangelnden Reife sowie der Unerfahrenheit meines ältesten Sohnes, verbunden mit seinem Hang zur Überhebung wie zur Überschätzung«. Er warnte gar, dass es »geradezu gefährlich« wäre, »ihn jetzt schon mit auswärtigen Fragen in Berührung zu bringen«. Bismarck war anderer Meinung und wies darauf hin, dass Wilhelm inzwischen 27 Jahre alt sei, also älter als Friedrich Wilhelm I. und Friedrich Wilhelm III. bei ihrer Thronbesteigung. Im Folgenden erinnerte er den Kronprinzen daran, dass die Autorität des Vaters in der königlichen Familie in der des Monarchen eingeschlossen sei.36 Die Neuigkeit von Wilhelms Berufung löste im Dezember 1886 eine Reihe von Diskussionen von bislang nicht gekannter Heftigkeit zwischen Vater und Sohn aus, und es lohnt sich, Wilhelms Version der Episode (in der Überlieferung Herbert von Bismarcks) ausführlich zu zitieren:
Hart, verächtlich und grob sei sein Vater ja immer mit ihm gewesen, sagte der Prinz, so erbittert habe er ihn aber noch kaum je gesehen, er sei ganz graubleich geworden und habe [ihm] mit geballter Faust gedroht, indem er sagte: »das ist ein Streich, der mir gespielt ist und den ich nie vergessen werde: man hat sich an meinen Widerspruch, den ich so scharf ausgesprochen habe, gar nicht gekehrt; man tut, als ob der Kronprinz gar nicht mehr da wäre. Aber ich werde es den Herren im Ausw. [ärtigen] schon eintränken, ich gebe mein Ehrenwort, dass ich dies tun werde, sobald ich auf den Thron komme, und dass es ihnen nicht vergessen sein soll.«37
Wilhelm verdankte seinen frühen politischen Aufstieg somit zum großen Teil der Eingebung und Unterstützung Bismarcks. Seit dem Jahr 1884 hatte Herbert von Bismarck, angespornt von seinem Vater, die Freundschaft zu Wilhelm mit großer Beharrlichkeit und Servilität gepflegt. Es verwundert deshalb nicht, dass die Kronprinzessin, die dem Kanzler immer schon ablehnend gegenübergestanden hatte, die politische Opposition Wilhelms als »die natürliche Folge von Bismarcks Allmacht« betrachtete.38 Aber Wilhelm war stets darauf bedacht, seine Unabhängigkeit zu wahren, und alles andere als dauerhaft oder ausschließlich den Bismarcks verpflichtet. Seit Anfang der achtziger Jahre trat eine weitere Persönlichkeit auf die Bühne, die den Bismarcks die politische Loyalität des Prinzen streitig machte.
Alfred Graf von Waldersee, Generalquartiermeister der preußischen Armee und stellvertretender Generalstabschef, hatte sich häufig mit dem Prinzen getroffen, um über militärische Fragen zu diskutieren und hatte ihn bei seiner ersten Russlandreise 1884 begleitet. Ihre Beziehung wurde von Januar 1885 an noch enger, als Wilhelm begann, dem General »delikate Familienverhältnisse« anzuvertrauen, und die verlockende Ankündigung machte, er »rechnete für später auf mich [Waldersee]«.39 In der Folge wurde er Wilhelms engster Vertrauter und regelte geschickt eine Reihe peinlicher Situationen, die aus den wenigen vor- und außerehelichen Verhältnissen des Prinzen entstanden waren. Ferner unterstützte er ihn bei dem umstrittenen Kreuzzug gegen das Glücksspiel im »Unionsklub« in Berlin.40
Der antisemitische, strenggläubige und reaktionäre Generalquartiermeister war die Personifizierung all dessen, was Wilhelms Eltern am stärksten verachteten. Damit war er zugleich ein willkommener Komplize in dessen Bestreben, sich vom Haushalt des Kronprinzen zu distanzieren. Gleichzeitig war Waldersee aber auch eine Gefahr für den Einfluss der Bismarcks auf den Prinzen. Er war außerordentlich ehrgeizig und hatte Gerüchten zufolge sogar das Kanzleramt im Blick. Waldersee bemühte sich nach Kräften, dem Einfluss Herbert von Bismarcks auf das Urteilsvermögen und die Einstellungen des Prinzen entgegenzuwirken, und registrierte aufmerksam die Schwankungen in der Beziehung zwischen Wilhelm und dem Kanzler.41 Auch Waldersees außenpolitische Ansichten wichen von denen des Kanzlers ab. Anfangs hatte er zwar Bismarcks Außenpolitik mitgetragen, Ende der achtziger Jahre verlor er jedoch das Vertrauen in die Führungsqualitäten des Kanzlers und wurde ein entschiedener Fürsprecher eines Präventivkriegs gegen Russland.42 Die beiden Männer gerieten in Streit, als Bismarck Waldersee rügte: Der Anlass war eine geringfügige Indiskretion, aber Waldersee nahm zweifellos zu Recht an, dass der eigentliche Streitpunkt das Ringen zwischen ihm und dem Sohn des Kanzlers um den Einfluss auf Wilhelm war.43
Zum Ende des Jahres 1887 hin war die Frage, wer Wilhelms Vertrauen genoss, bereits von äußerster Bedeutung. Im März des Jahres war im Kehlkopf des Kronprinzen ein Geschwür entdeckt worden. Die ärztlichen Meinungen zum weiteren Vorgehen waren gespalten: Einige deutsche Ärzte des Kronprinzen vertraten die Meinung, dass es ein Krebsgeschwür sei und so schnell wie möglich durch eine radikale und überaus gefährliche Operation entfernt werden müsse, durch die der Thronerbe mit Sicherheit für immer die Sprache verlieren würde - unter Umständen könnte er dabei sogar sterben. Der Hauptverfechter einer optimistischeren Diagnose war der britische Arzt Sir Morell Mackenzie, ein Vertrauter des Kronprinzen. Nach seiner Auffassung war das Geschwür nicht bösartig und würde von selbst heilen, sofern man Friedrich Wilhelm einen Klimawechsel und eine ausgiebige Ruhephase gewähre. Der Kronprinz entschied sich für die Prognose Mackenzies und verwarf den chirurgischen Eingriff; der Patient wurde zur Erholung in eine Villa in der norditalienischen Küstenstadt San Remo gebracht. Am Hof, unter Regierungsvertretern und in der öffentlichen Meinung fand jedoch die pessimistische Ansicht mehr Anhänger, sobald die Krankheit des Kronprinzen im Mai 1887 allgemein bekannt wurde. Der Kaiser war inzwischen 90 Jahre alt und wurde immer gebrechlicher. Die Aussicht auf Wilhelms Thronfolge, die bislang in weiter Ferne gelegen hatte und somit eher als theoretische Möglichkeit erschienen war, rückte nunmehr in greifbare Nähe. »Gottes Wege sind wunderbar«, schrieb Holstein in sein Tagebuch. »Der eiserne Weg der Weltgeschichte bekommt eine unerwartete Wendung. Prinz Wilhelm vielleicht mit 30 Jahren deutscher Kaiser. Was wird das werden?«44
Da alles darauf hindeutete, dass die Herrschaft Kronprinz Friedrich Wilhelms kurz sein würde, selbst wenn er den Tod seines Vaters überleben sollte, war Wilhelm jetzt der Mann der Zukunft und stand im Brennpunkt aller politischen Ambitionen. »Interessant ist es zu sehen«, schrieb Waldersee, »wie bei gewissen klugen Leuten sofort die Wertung des Prinzen Wilhelm sich ändert; schimpften sie gestern noch auf ihn, fanden ihn herzlos, unbedachtsam und ich weiß nicht was alles, so ist er heute ein fester Charakter und für die Zukunft vielversprechend.«45 Alle noch verbliebenen Zweifel zum Gesundheitszustand Friedrich Wilhelms wurden von einer öffentlichen Bekanntmachung vom 12. November 1887 ausgeräumt, dass der Kronprinz unheilbar an Krebs erkrankt sei. Diese Neuigkeit hatte auf das Umfeld des Hofes eine geradezu elektrisierende Wirkung. Herbert von Bismarck erinnerte sich, dass sich »alle Streber und Kriecher«, die sich bislang gefragt hatten, ob sie mit dem Sohn oder dem Enkel mehr Glück hätten, nunmehr definitiv dem Letzteren zuwandten und »mit unverhehltem Behagen aus vollen Backen pustend, die Segel der hochgradigen, prinzlichen Eitelkeit« blähten.46
Die Rivalität um den Einfluss auf Wilhelm hatte mit einem Mal eine ganz neue Qualität. Bismarck konnte unter Umständen alles verlieren; die Zukunft seiner Außenpolitik und sein eigenes Amt standen auf dem Spiel. In dem Versuch, seinen Einfluss auf den Prinzen zu konsolidieren, wählte der Kanzler eine charakteristische Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Er empfahl sich selbst weiterhin als der Mentor der politischen Karriere Wilhelms, indem er sich die Unterschrift des Kaisers unter ein Dokument verschaffte, das besagte, dass in dem Fall, dass das Staatsoberhaupt geschäftsunfähig werden sollte, der Status und die Vollmachten eines Stellvertreters bis zum Tod des Kaisers auf Wilhelm übergehen sollten - eine Entwicklung, die in San Remo verständlicherweise für einige Unruhe sorgte. Gleichzeitig ergriff Bismarck Maßnahmen, um Wilhelm davon abzubringen, mit seinem sichtbarsten Gegenspieler General Waldersee gemeinsame Sache zu machen. Zu diesem Zweck torpedierte er ganz gezielt die Beziehung zwischen Wilhelm, Waldersee und dem geistlichen Politiker Adolf Stoecker.
Der Gründer der Christlich-Sozialen Arbeiterpartei (später Christlich-Sozialen Partei) Adolf Stoecker, seit 1874 Hof- und Domprediger in Berlin, zählte zu den schillerndsten und innovativsten Figuren im deutschen Konservatismus Ende des 19. Jahrhunderts. Wie sein Zeitgenosse Karl Lueger in Wien mobilisierte auch Stoecker mit einer effektiven Mischung aus populistischem Antikapitalismus, opportunistischem Antisemitismus und einer missionierenden Erweckungsrhetorik die Massen für seine konservative Agenda. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die säkularisierte und entfremdete Arbeiterklasse mit dem Christentum und der monarchischen Ordnung zu versöhnen. Bismarck nahm gegenüber Stoecker eine ambivalente Haltung ein: Er schätzte die konservative, monarchische Stoßrichtung der Politik des Predigers, war aber skeptisch, ob es ihm gelingen würde, der Sozialdemokratie die Arbeiter abspenstig zu machen, und seine demagogischen Taktiken lehnte er ab. Wichtiger noch: Ende des Jahres 1887 betrachtete er Stoecker bereits als eine politische Gefahr. Im November des Jahres wurde in den Räumlichkeiten General Waldersees ein Festabend zur Sammlung von Spenden zugunsten der Stadtmission Stoeckers veranstaltet, einer Einrichtung, die eigens zu dem Zweck gegründet worden war, die wohltätige Arbeit mit der Missionierung unter den städtischen Armen zu kombinieren. Prinz Wilhelm war ebenfalls anwesend und hielt eine kurze Ansprache, in der er die Arbeit des Hofpredigers lobte und feststellte, dass der »christlich-soziale Gedanke« mit seiner »Anerkennung der gesetzlichen Autorität und der Liebe zur Monarchie« sowie die Erweckung der Massen der einzige Weg sei, die revolutionären Tendenzen einer anarchistischen und gottlosen Partei (ein Seitenhieb auf die Sozialdemokraten) zu neutralisieren. Bismarck sah in der Veranstaltung die Anfänge einer neuen und gefährlichen Koalition politischer Kräfte. Stoecker war potenziell ein Kanal zwischen Prinz Wilhelm und jenen konservativen, protestantisch-klerikalen »Ultras«, welche die Integrität der liberal-konservativen Reichstagsmehrheit des Kanzlers gefährdeten.47 Für Bismarck schien es klar, dass hier letztlich das Ziel verfolgt wurde, den Boden für eine Kanzlerschaft Waldersees nach Wilhelms Thronbesteigung zu bereiten.
Statt Wilhelm in der Angelegenheit direkt unter Druck zu setzen, machte sich Bismarck auf charakteristische Weise die überaus beachtlichen, publizistischen Ressourcen der Reichskanzlei zunutze. In der zweiten Dezemberwoche erschienen auf den Seiten der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, einer überregionalen Zeitung, die gemeinhin als halboffizielles Organ der Regierung galt, mehrere scharfe Angriffe auf Stoecker. Die nationalliberalen und gemäßigt konservativen Zeitungen, die mit Bismarcks Reichstagsmehrheit in Verbindung standen, schlossen sich rasch dem Treiben an und erhoben den Vorwurf, eine reaktionäre, geistliche Clique habe den empfänglichen Prinzen für ihre eigenen Interessen eingespannt. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal sah Wilhelm sich im Mittelpunkt einer landesweiten Pressekampagne.
Der unvermittelte Tritt ins Rampenlicht und in die öffentliche Kritik versetzte Wilhelm allem Anschein nach in Panik - erste Anzeichen einer Empfindlichkeit gegenüber der öffentlichen Meinung, die ihn während seiner ganzen Regierungszeit begleiten sollte. Noch vor Ende des Monats gab er eine öffentliche Erklärung ab, in der er sich von Stoeckers Antisemitismus distanzierte. In einem privaten Brief an Bismarck beteuerte Wilhelm, dass sein Engagement für die Mission nicht als eine parteiliche Verpflichtung gedacht gewesen sei. Er versicherte ihm, dass er sich lieber »stückweise ein Glied nach dem anderen für Sie abhauen« ließe, als dem Kanzler irgendwelche »Schwierigkeiten [zu] machen oder Unannehmlichkeiten [zu] bereiten«.48 In einer Rede vor dem Provinziallandtag von Brandenburg am 8. Februar stellte Wilhelm sich demonstrativ hinter Bismarcks Außenpolitik (der Text wurde sofort an die Presse weitergeleitet).49 Bismarck hatte diese Schlacht gewonnen, aber die Kraftprobe zwischen dem Kanzler und dem Prinzen schadete der Beziehung zwischen den beiden Männern erheblich. Wilhelm war empört über die Art und Weise, wie Bismarck ihn vor den Augen der Nation an den Pranger gestellt hatte. In seinen Äußerungen über die Zukunft schwang von nun an eine Drohung mit: »Er soll nicht vergessen, dass ich sein Herr sein werde«; »Im Anfang wird es ohne den Kanzler nicht gehen. Aber in Jahr und Tag wird hoffentlich das Deutsche Reich genügend konsolidiert sein, um seine [des Fürsten] Mitwirkung entbehrlich zu machen.«50
Am 9. März 1888 starb der alte Kaiser. Zu seinen letzten Worten zählte dem Vernehmen nach ein ausdrückliches Lob für seinen Enkel. Er sagte, er sei immer sehr zufrieden mit ihm gewesen, weil er immer alles richtig gemacht habe.51 Die erste Kommunikation des neuen Kaisers mit seinem Sohn nach dem Tod Wilhelms I. war ein kühl formuliertes Telegramm, das ihn ermahnte, sich der Autorität des Vaters zu unterwerfen. Ungeachtet des schlimmen Gesundheitszustands des neuen Kaisers räumte eine Stellvertreterordre vom 23. März dem neuen Kronprinzen nur minimale Rechte und Zuständigkeitsbereiche ein. In Wirklichkeit blieb Wilhelm jedoch im Zentrum der Aufmerksamkeit und im Brennpunkt der politischen Spekulationen. Kein Einziger in den höchsten Regierungskreisen, nicht einmal die militärische Umgebung des neuen Kaisers war bereit, die Legitimität des neuen Regimes anzuerkennen; es wurde lediglich als vorübergehende Unannehmlichkeit verstanden. »Ich glaube, wir werden im Allgemeinen nur als vorüberhuschende Schatten angesehen, die bald in der Wirklichkeit durch Wilhelms Gestalt ersetzt werden sollen«, schrieb die Kaiserin im März an ihre Mutter.52 Die Herrschaft Kaiser Friedrichs III., wie er sich nannte, war auf jeden Fall viel zu kurz (99 Tage), und der Herrscher selbst durch seine Krankheit viel zu geschwächt, um eine so massive Umbesetzung des Kabinetts und Neuorientierung der Politik zu ermöglichen, wie die Konservativen sie seit langem schon erwartet und gefürchtet hatten.
Es bestanden immer noch große Meinungsverschiedenheiten zwischen Wilhelm und dem Kanzler, vor allen Dingen in der Außenpolitik. Unter dem Eindruck der von Nervosität geprägten öffentlichen Meinung in Deutschland während der Phase anhaltender Angst vor einem Krieg gegen Russland im Frühjahr und Sommer 1888 schwankte Wilhelm zwischen der Treue zu Bismarck und einer Unterstützung der kriegerischen, antirussischen Ansichten des Grafen Waldersee.53 Mit dem unvermittelten Wiederaufleben des Battenbergschen Heiratsprojekts im April stand jedoch ein Thema auf der Tagesordnung, in dem sich Wilhelm und der Kanzler einig waren. Bismarck drohte mit Rücktritt, und Wilhelm verlor keine Zeit, dem »Bulgaren« mitzuteilen, falls die Verlobung vollzogen werde, so werde es seine erste Handlung als Kaiser sein, das Paar aus dem Territorium des Reiches zu verbannen.
Die Feindseligkeit zwischen Wilhelm und seiner Mutter Victoria blieb unvermindert bestehen. In den Augen der Kaiserin war sein unablässiger Widerstand gegen die Battenberg-Heirat ein weiterer Beweis - wenn überhaupt noch einer nötig war - für seinen »Hass, Rachsucht und Stolz« und für seinen Wunsch sie »zu vernichten«, indem er aus einer »privaten Familienangelegenheit« eine »cause célèbre« (große Sache) machte.54 Die Schwäche und die stoische Resignation, die sich nicht selten bei einer schweren Krankheit einstellt, hatten die Kampfeslust Friedrich Wilhelms gelindert. In dem Maße, wie seine Kraft und Neigung, sich mit seinem ältesten Sohn zu streiten, nachließen, wurde er selbst zum Streitgegenstand. Wilhelm hatte sich stets gegen seine Mutter und Sir Morell Mackenzie an die Seite der pessimistischen Mehrheit der behandelnden Ärzte gestellt, die unheilbaren Krebs diagnostiziert und eine Operation gefordert hatten. Da in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts die Aussichten, dass ein Patient eine Kehlkopfoperation überlebte, sehr gering waren, sah Victoria in dieser Parteinahme eine skrupellose Verschwörung, um Wilhelms eigene Thronbesteigung zu beschleunigen oder ihren Mann für regierungsunfähig erklären zu lassen. Als Wilhelm im November 1887 von seinem Besuch in San Remo zurückgekehrt war, berichtete er, dass seine Mutter, abgesehen davon, dass sie ihn »wie einen Hund« behandelt habe, auch versucht habe, ihn von seinem Vater fernzuhalten. Das tat sie auch in Friedrich Wilhelms letzten Tagen. Aber die Zeit, die Krankheit und die dynastischen Automatismen arbeiteten für Wilhelm. Der Tod Friedrich Wilhelms am 15. Juni 1888 entfesselte in der Öffentlichkeit heftige Diskussionen über die angeblich falsche Behandlung durch diejenigen, die sich geweigert hatten, die Krebs-Diagnose zu akzeptieren, nicht zuletzt die Kaiserin selbst. Gegen den ausdrücklichen Wunsch seines Vaters und seiner verwitweten Mutter ordnete Wilhelm an, den Leichnam zu obduzieren. Die Existenz eines Krebsgeschwürs wurde bestätigt und öffentlich bekannt gegeben und stärkte damit die Position, die Wilhelm seit Frühjahr 1887 in der Diskussion eingenommen hatte.
Die Menschen am Hof waren - und sind womöglich generell - dazu geneigt, die Manipulierbarkeit anderer Personen zu überschätzen, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst so bereitwillig glaubten, dass man mit Verschwörungen und Intrigen tatsächlich etwas erreichen kann. Der Kronprinz und seine Frau betrachteten Wilhelm als ein »Instrument« und eine »Spielkarte«, dessen »Urteil dadurch [die Palastintrigen] verkehrt« und dessen »Geist vergiftet« werde. Wie Victoria im April 1887 schrieb: »Er ist nicht klug oder erfahren genug, um das System und die Menschen zu durchschauen. Infolgedessen tun sie mit ihm, was sie wollen.«55 Waldersee machte sich wegen der Empfänglichkeit Wilhelms für die Schmeicheleien Herberts von Bismarcks ernstlich Sorgen. Der Kanzler wiederum fürchtete, dass Wilhelm ganz unter dem Einfluss Waldersees stände. In Wirklichkeit war Wilhelm, wie die Ereignisse von 1887/88 zeigten, das Geschöpf keiner einzelnen Partei. Waldersee hatte Recht, als er im Januar 1887 beobachtete, dass der Prinz »völlig auf eigenen Füßen« stand und »auch mit voller Überlegung sich nie eine eigentliche Partei bilden [werde], weil er nicht in deren Hand kommen will«.56 Um dieselbe Zeit äußerten sich gutinformierte Zeitgenossen (Holstein, H. Bismarck, Waldersee) anerkennend über die nüchterne Distanz und seine verblüffende Fähigkeit, sich zu verstellen - Charakterzüge, die er in den langen Jahren des Familienstreits entwickelt hatte. Seine gewandte politische Anpassungsfähigkeit - russophil in der Außenpolitik 1884-1886, im Dezember 1887 mit der »Kriegspartei« verbündet, im Februar 1888 auf Bismarcks Linie - lassen vermuten, dass er bereits damals dazu neigte, Männer und Parteien in wechselnden Kombinationen zu benutzen.
Folglich sagen die Posen, die er in diesen frühen Jahren einnahm, mehr über Wilhelms Hunger nach Macht und Anerkennung aus als über irgendwelche Verpflichtungen gegenüber bestimmten Männern beziehungsweise deren Politik. Wilhelm war in einer Atmosphäre aufgewachsen, die in regelmäßigen Abständen von Kämpfen um Macht und Einfluss aufgeheizt wurde. In deren Verlauf wurden persönliche Beziehungen infiltriert und manche Loyalitäten gefestigt, andere hingegen vergiftet. Wilhelms Eltern, insbesondere seine Mutter, wurden von diesen Kämpfen ebenso stark vereinnahmt wie ihr Gegenpart, Kanzler Bismarck. Von der bevorzugten Stellung Wilhelms aus, der von dem daraus folgenden Parteienstreit profitieren sollte, war ohne weiteres zu erkennen, wie die Themen und Diskussionen augenscheinlich dem Erwerb und Erhalt der Macht untergeordnet wurden, wie die Politik selbst nur nach einem personenbezogenen Freund- und Feindschema betrachtet wurde. Als Wilhelm den Thron bestieg, hatte er bereits ein ungewöhnlich zielstrebiges Interesse an der Macht und einen großen Appetit auf sie entwickelt. Das wurde schon an seiner Gewohnheit deutlich, Postkarten von sich selbst mit dem legendären »I bide my time« (Meine Stunde wird kommen) zu verschenken. Allerdings hatte er lediglich eine anfängliche Ahnung davon, was er mit der Macht anfangen würde, sobald er sie hatte. Das war das wohl verhängnisvollste Resultat der politischen Erziehung Wilhelms im zerstrittenen Haushalt der Hohenzollern.
Die Persönlichkeit des Kaisers
Schufen die Umstände der Geburt und Kindheit Wilhelms die Grundlagen für eine abnormale psychische Entwicklung? Seit der Novemberrevolution, durch die Wilhelm 1918 vom Thron vertrieben worden war, stellte die angebliche Instabilität oder gar Geisteskrankheit des letzten deutschen Kaisers ein zentrales Thema der historischen und populären Literatur über seine Herrschaft dar. Schon im ersten Jahr nach der Abdankung erschien eine ganze Reihe von Studien, die Wilhelms psychische Befähigung zu seiner Rolle als Souverän in Frage stellten: Die Geisteskrankheit Wilhelms II. (Franz Kleinschrod), Wilhelm II. periodisch geisteskrank! (Hermann Lutz), Wilhelm II. als Krüppel und Psychopath (H. Wilm). »Aber er war krank, krank wie sein Denken und Fühlen«, schrieb Paul Tesdorpf, der Autor der Studie Die Krankheit Wilhelms II. »Für einen erfahrenen Arzt und Psychiater besteht gar kein Zweifel, dass Wilhelm II. schon von Jugend auf ein Geisteskranker war.«57 Einige frühe Studien waren sich darin einig, dass Wilhelm unter einer angeborenen degenerativen Störung litt, die von der jahrelangen dynastischen »Überzüchtung« verursacht worden sei. Diese polemischen Schriften hatten selbstverständlich keinerlei diagnostischen Wert. Das Hauptanliegen ihrer Autoren war es, die deutsche Kriegsschuld dem »Psychopathen« Wilhelm aufzubürden, der ihrer Meinung nach die Verantwortung für die katastrophale Wende des deutschen Schicksals seit 1914 trug. (»Die Schuld, die ihn an dem Kriege trifft, entspringt seiner Krankheit«, schrieb Paul Tesdorpf im Jahr 1919.) Und das Argument der dynastischen »Entartung«
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel Kaiser Wilhelm II. bei Pearson Education Limited. Die deutschsprachige Ausgabe wurde von Christopher Clark ergänzt.
1. Auflage
Copyright © Christopher Clark 2000 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Gesetzt aus der Minion
eISBN : 978-3-641-03724-8
www.dva.de
Leseprobe
www.randomhouse.de