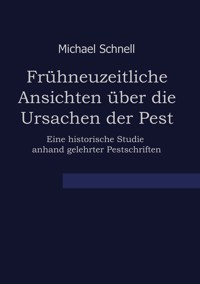
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer heute nach den Ursachen einer Krankheit fragt, bekommt in den meisten Fällen Krankheitserreger genannt: Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Diese wurden allerdings erst in den letzten ca. 150 Jahren entdeckt, zum Beispiel der Tuberkelbazillus, der Erreger der Cholera - und auch das Pestbakterium. In der Zeit davor konnten die Menschen über den Ursprung der Pest, die vom 15. bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts neben Hunger und Krieg zu den größten existentiellen Bedrohungen der Menschen zählte, nur spekulieren: Was ist die Ursache der Pest? Gibt es so etwas wie eine Ansteckung? Was kann präventiv gegen diese Krankheit getan werden? Wie sieht eine gute Therapie aus? Die vorliegende historische Studie hat 180 deutsche und lateinische Quellen der Frühen Neuzeit (ca. 16. bis 18. Jahrhundert) zum Thema "Ätiologien der Pest" untersucht und ausgewertet, von kurzen Pesttraktaten bis hin zu umfangreichen Schriften, die von gelehrten Autoren mit meist medizinischer oder theologischer Ausbildung stammten. Vor allem die religiösen sowie die auf einer gewissen Einbildung oder Imagination fußenden Ursachenbeschreibungen haben in der Medizingeschichte der letzten 100 Jahre kaum Beachtung gefunden - und werden hier ausführlich thematisiert. Reflexionen zu den Diskussionen über die Ansteckung (Kontagion) sowie zur Krankheitsbereitschaft (Disposition) einzelner Menschen und damit auch Fragen nach den Einflüssen der sozialen Lage, der wirtschaftlichen Tätigkeit, der Lebensführung, aber auch des Geschlechts und der ethnischen Zugehörigkeit schließen sich an. Eine systematische und kritische Darstellung früherer Ätiologien, die nicht als "Kuriositätenkabinett" daherkommt, sondern als ernstzunehmende Erklärungsversuche des vormodernen Denkens, Weltbilds und der Mentalität des frühneuzeitlichen Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 900
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Von 1990 bis 1996 studierte ich im Magister-Studiengang an der Universität – GH – Essen im Hauptfach die Neuere Geschichte, in den Nebenfächern die Geschichte des Mittelalters und Kommunikationswissenschaft. Anschließend bewarb ich mich erfolgreich um ein Stipendium, das es mir ermöglichte, eine Dissertation zu verfassen. Die Fertigstellung der Schrift (Titel: „De causis pestis – Frühneuzeitliche Ätiologien der Pest") erfolgte – nach der Vorstellung meiner Ergebnisse und Thesen in den medizinhistorischen Forschungskolloquien der Universitäten in Mainz (Prof. em. Prof. h.c. Dr.med. Dr.phil. Alfons Labisch) und in Düsseldorf (Prof. Dr. phil. Werner F. Kümmel) – zum Jahreswechsel 1999/2000, die Promotion inkl. Disputation wurde im November 2000 mit der Note „sehr gut" (magna cum laude) abgeschlossen. Einen Doktortitel führe ich nicht und darf ihn auch nicht führen, da ich aus privaten Gründen die Dissertation nicht veröffentlicht habe. Über 10 Jahre später habe ich mit dem Promotionsausschuss der Universität Duisburg-Essen die Frage abgeklärt, welche Schritte notwendig seien, den Abschluss nachzuholen – doch diese Schritte schienen mir in meinem jetzigen beruflichen Lebensweg kaum realisierbar. Mit dem Hinweis, dass die Arbeit nicht als Dissertation an der Universität Duisburg-Essen deklariert werden dürfe, stellte es mir der Promotionsausschuss allerdings frei, die Arbeit privat zu veröffentlichen – was ich hiermit tun möchte.
Danksagung
Für die sehr gute Betreuung, für viele gute inhaltliche Ratschläge möchte ich mich trotzdem herzlich bei meinem damaligen „Doktorvater“ bedanken:
Herrn Prof. em. Dr. Paul Münch
Änderungen
Ich habe meine Schrift an einigen Stellen geändert: Eingearbeitet wurden zum größten Teil die Anregungen aus dem Gutachten zur Dissertation von Prof. em. Dr. Paul Münch. Auch ein paar Hinweise zu aktuellen Publikationen habe ich nachgeliefert. Eine komplette wissenschaftliche Aktualisierung der Inhalte erbringe ich mit dieser Veröffentlichung nicht. Eine ähnliche Studie zu diesem Thema existiert m. E. bis heute nicht. Der Leser sehe es mir nach, wenn meine Ausführungen zur psychosomatischen Medizin, v. a. am Ende der Schrift, ggf. nicht mehr „auf dem neuesten Stand" sind.
Aktualisiert habe ich zudem die Rechtschreibung. Die untersuchten Quellen bis zum 19. Jahrhundert bleiben allerdings weiterhin in ihrer Originalschreibung erhalten. Korrigiert habe ich die Quellen, die in modernen Übersetzungen vorlagen, aber noch die alte Rechtschreibregeln vor 2006 verwendeten, sowie die Forschungsliteratur, die aus der Zeit vor der Rechtschreibreform stammt.
PS:
Besuchen Sie doch einmal die Website WebHistoriker.de, mein Portal zur Geschichte der Frühen Neuzeit!
Inhalt
1. EINLEITUNG
1.1 LITERATUR
1.2 QUELLEN
2. ÜBERNATÜRLICHE URSACHEN DER PEST
2.1 DIE PEST ALS STRAFE GOTTES
2.1.1 EINLEITUNG
2.1.2 QUELLEN
2.1.3 LITERATUR
2.1.4 DIE ERSTE SÜNDE, SÜNDEN UND IHRE FOLGEN
2.1.5 KONFESSIONELLE UNTERSCHIEDE IN DER BEURTEILUNG DER PEST
2.1.6 DIE BESTRAFUNG GUTER UND BÖSER MENSCHEN
2.1.7 ZUR UNTERSCHEIDUNG DER GÖTTLICHEN VON DER NATÜRLICHEN PEST, ODER: HAT GOTT BEI DER ERSCHAFFUNG DER WELT BÖSES GESCHAFFEN?
2.1.8 ATHEISMUS UND PEST
2.2 TEUFEL UND ZAUBEREI ALS PESTURSACHEN
2.2.1 EINLEITUNG
2.2.2 PSALM 91: „DER RECHTE GRIMMIGE JÄGER"
2.2.3 TEUFEL UND DÄMONEN
2.2.4 TEUFEL, ZAUBEREI, HEXEN UND BÖSE MENSCHEN
2.2.5 ERGEBNISSE
3. NATÜRLICHE URSACHEN DER PEST
3.1 QUID SIT PESTIS? ODER: DEFINITIONEN DER PEST
3.2 MIASMA, FÄULNIS UND GIFT
3.2.1 RÜCKBLICK: DIE ANTIKE HUMORALPATHOLOGIE UND DAS ELEMENT „LUFT"
3.2.2 „VON KRAFFT DER STERNEN / IN ERWECKUNG DER PEST"
3.2.3 IRDISCHE URSACHEN DER PEST
3.2.4 KRITIK AN DER THEORIE DER LUFTVERDERBNIS
3.3 DIE ANSTECKUNG ALS URSACHE DER PEST
3.3.1 ANTIKE THEORIEN DER ANSTECKUNG
3.3.2 MITTELALTERLICHE ANSICHTEN ZUR ANSTECKUNG
3.3.3 THEORIEN DER ANSTECKUNG IM 16. UND 17. JAHRHUNDERT
3.3.4 THEORIEN DER ANSTECKUNG IM 18. JAHRHUNDERT
3.3.5 ZUSAMMENFASSUNG
3.4 EINBILDUNG, FURCHT UND SCHRECKEN
3.4.1 EINLEITUNG
3.4.2 DIE GEMÜTSBEWEGUNGEN INNERHALB DER ANTIKEN UND MITTELALTERLICHEN HUMORALPATHOLOGIE
3.4.3 DIE PESTSCHRIFTEN DES PARACELSUS (UM 1530)
3.4.4 DIE PSEUDO-PARACELSISCHE SCHRIFT „DE PESTILITATE"
3.4.5 JOHANN BAPTISTA VAN HELMONT: „DAS GRAB DER PEST" (1643/1683)
3.4.6 AUGUSTUS QUIRINUS RIVINUS: „TRACTAT VON DER PEST" (1679/1714)
3.4.7 EINBILDUNG, FURCHT UND SCHRECKEN IN WEITEREN FRÜHNEUZEITLICHEN PESTSCHRIFTEN
3.4.8 ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG DER THEORIEN NACH PSYCHOSOMATISCHEN GESICHTSPUNKTEN
3.5 DIE DISPOSITION ODER KRANKHEITSBEREITSCHAFT
3.5.1 SEX RES NON NATURALES
3.5.2 PERSONEN MIT ERHÖHTER KRANKHEITSANFÄLLIGKEIT
4. SCHLUSSBEMERKUNGEN
5. LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS
5.1 BENUTZTE QUELLEN ÜBER DIE PEST:
5.1.1 MITTELALTER:
6.1.2 FRÜHE NEUZEIT:
6.2 SONSTIGE BENUTZTE QUELLEN
6.2.1 BIBELÜBERSETZUNGEN
6.3 GESAMMELTE QUELLEN ÜBER DIE PEST AUS DEM MITTELEUROPÄISCHEN RAUM
6.3.1 ALLGEMEINE PESTSCHRIFTEN UND NICHT ZUZUORDNENDE SCHRIFTEN
6.3.2 PESTORDNUNGEN/-REGIMENTER, CONSILIEN UND RATSCHLÄGE ZUR PRÄVENTION UND THERAPIE
6.3.3 BERICHTE ÜBER ,AKTUELLE' ODER VERGANGENE PESTEPIDEMIEN
6.3.4 KOMMENTARE ZU FRÜHEREN SCHRIFTEN
6.3.5 RELIGIÖSE PESTSCHRIFTEN UND SCHRIFTEN ÜBER DIE FLUCHT IN PESTZEITEN
6.3.6 PESTSCHRIFTEN ZU EINZELNEN THEMENBEREICHEN
6.4 WEITERE PESTQUELLEN AUS DEM ÜBRIGEN EUROPA BZW. UNBEKANNTER HERKUNFT (AUSWAHL)
6.5 BENUTZTE LITERATUR
1. Einleitung
„Aber in den folgenden Tagen verschlimmerte sich die Lage. Die Zahl der eingesammelten Nagetiere nahm ständig zu, und die Ernte war jeden Morgen reicher. Vom vierten Tag an kamen die Ratten in Gruppen heraus und starben. Aus den Verschlägen, den Untergeschossen, den Kellern, den Kloaken stiegen sie in langen, wankenden Reihen hervor, taumelten im Licht, drehten sich um sich selber und verendeten in der Nähe der Menschen. Nachts hörte man in den Gängen und den engen Gassen deutlich ihren leisen Todesschrei. Am Morgen fand man sie in den Straßengräben der Vorstädte ausgestreckt, ein bisschen Blut auf der spitzen Schnauze, die einen aufgedunsen und faulig, die andern steif, mit gesträubten Schnauzhaaren. In der Stadt selber traf man sie in kleinen Haufen auf dem Flur oder in den Höfen. Manchmal starben sie auch einzeln in den Vorräumen der Verwaltungsgebäude, in den Schulhöfen, manchmal auf der Terrasse der Cafés. Unsere entsetzten Mitbürger entdeckten sie an den belebtesten Orten der Stadt. Der Waffenplatz, die Boulevards, die Aussichtsstraße dem Meer entlang waren ab und zu verunziert. Bei Morgengrauen wurde die Stadt von den toten Tieren gesäubert, im Laufe des Tages kamen sie langsam wieder, zahlreicher und zahlreicher. Manch ein nächtlicher Spaziergänger spürte unter seinem Fuß plötzlich die weiche Masse einer eben verendeten Ratte."1
In dem 1947 erschienenen Roman „Die Pest" des aus Algerien stammenden Schriftstellers Albert Camus (1913-1960)2 steht die Seuche mit all' ihren politischen und sozialen Auswirkungen u. a. als Sinnbild für die Zeit des Autors im Exil während des Zweiten Weltkrieges.3 Mit der Pest, so heißt es in Camus' Tagebuch, versucht er „das Ersticken ausdrücken, an dem wir alle gelitten haben", das Leben in einem Klima der Bedrohung und der Verbannung: „Ich will zugleich diese Deutung auf das Dasein überhaupt ausdehnen. Die Pest wird das Bild derjenigen wiedergeben, denen in diesem Krieg das Nachdenken zufiel, das Schweigen – und auch das seelische Leiden."4 Bei der Lektüre des Romans wird allerdings auch deutlich, dass sich Camus mit den medizinischen und historischen Implikationen der Pest und der Pestausbrüche beschäftigt hat. Es sind die toten Ratten – zunächst einzelne, später eine Vielzahl –, die die Seuche ankündigen, die aus den Untergründen der algerischen Stadt Oran emporkommen und durch ihr Dahinsterben den Weg zur Ausbreitung der Pest unter den Menschen frei machen.
Dass diese Nagetiere an der Entstehung und Verbreitung einer Pestepidemie mitbeteiligt sind, war erst seit einigen Jahrzehnten bekannt: Etwa ein halbes Jahrhundert vor der Veröffentlichung des Romans wurde der Erreger, ein Bazillus, von Alexandre Yersin, einem schweizerischen Tropenarzt und Mitarbeiter am Institut Pasteur, entdeckt und nach diesem benannt: Yersinia pestis.5 Dieser Bazillus „lebt chronisch"6 in einigen wildlebenden Nagetieren – in den USA, in Südamerika, in Ägypten sowie West- und Südafrika und in Zentralasien, v. a. in Indien – und kann auf Nagetiere übertragen werden, die in der Nähe des Menschen leben oder diesem folgen: auf die Hausratte (lt. Rattus rattus) und die Wanderratte (lt. Rattus exuland).7 Der Mensch kann sich sowohl bei den Wildtieren als auch bei den genannten Rattenarten infizieren. Die zuerst angeführte Ansteckungsart kommt eher selten vor, weil viele Pestherde in von Menschen nahezu unbewohnten Gegenden liegen. „Krieg oder andere Katastrophen" (z. B. in Zusammenhang mit den Fluchtbewegungen) sowie in der Nähe dieser Pestreservoire lebende Nagerpopulationen, die als Bindeglied zu den „Hausnagern" und den Menschen fungieren, bergen allerdings bis heute die Gefahr der Infektion.8
Während die wilden Nagetiere vielfach resistent gegen den Pesterreger sind9, kann es unter den Wander- und Hausratten zu einem größeren Sterben kommen. Unter den Ratten und von den Ratten auf den Menschen wird der Erreger zumeist weitergetragen durch Flöhe, wobei zumeist der Rattenfloh (lt. Xenopsylla cheopis) genannt wird.10 Ein größeres Sterben der Ratten kann nun zur Folge haben, dass sich die Flöhe andere Überlebensmöglichkeiten suchen, so z. B. beim Menschen, aber auch bei Katzen, Hunden und sogar bei Vögeln.11 Unter den Menschen schließlich wird der Erreger auch von dem sogenannten Menschenfloh (lt. Pulex irritans) weitergetragen.12 Damit in Zusammenhang stehen auch mangelhafte hygienische Verhältnisse: „Kontakte mit den Kadavern an der Pest verendeter Ratten oder mit infiziertem Rattenkot, Genuss von Lebensmitteln, die beispielsweise durch Rattenfraß Erreger enthielten, oder die Übertragung durch Haus- und Nutztiere" dürften auch in Mittelalter und Früher Neuzeit bei der Ausbreitung der Pest behilflich gewesen sein.13
Zurück zum Roman Albert Camus': Der Beschreibung der verendenden Ratten folgt unmittelbar ein eindrucksvoller Satz: „Es war, als wolle die Erde, auf der unsere Häuser standen, sich selber von der Last ihrer Säfte befreien, so dass die Eiterbeulen, die sie bisher innerlich geplagt hatten, nun aufbrachen."14 Die Erde als pestverseuchter Menschenkörper, der durch den Auswurf verdorbener Säfte sein Überleben zu sichern versucht – dieser Vergleich beschreibt im Grunde einen sehr alten Gedanken über die Beschaffenheit des menschlichen Körpers und seines Verhaltens gegenüber einer Krankheit: Ärzte von der Antike bis weit in die Neuzeit hinein lehrten, dass die Gesundheit des Menschen hauptsächlich von dem rechten Maß und dem einwandfreien Zustand der Körpersäfte abhängt. Jegliche Beeinträchtigung dieser Faktoren sollte verhindert werden – sei es durch körpereigene Funktionen, wie dem Schwitzen oder anderer Versuche des Körpers, das Zuviel eines Saftes auszuscheiden oder eine bestimmte Krankheitsmaterie aus dem Inneren an die Peripherie zu treiben; sei es durch Eingriffe eines Arztes, der selbiges durch Aderlass und Schröpfen zu erreichen suchte.
Und noch ein Gedanke, der in diesem Satz zum Ausdruck kommt, ist bereits in antiken Schriften zu finden: Die Seuche oder das, wodurch sie entsteht, bildet sich im Erdreich und bahnt sich einen Weg aus dem Inneren hinaus an oder in die Luft. Aus diesem Grund warnen noch frühneuzeitliche Gelehrte vor den Folgen eines Erdbebens. Dass ein fauler oder, im buchstäblichen Sinne, verpesteter Dunst an die Erdoberfläche dringt, zeigt in ihren Augen das Verhalten verschiedener Tiere an, die in diesem Falle massenhaft aus ihren Schlupflöchern drängen: Genannt werden zumeist Schlangen, Kröten, Würmer und Insekten – interessanterweise nur selten irgendeine Art von Nagetieren.
„Aber im Allgemeinen wich die Seuche auf der ganzen Linie zurück, und die amtlichen Mitteilungen, die anfänglich eine geheime, schüchterne Hoffnung entstehen ließen, bestärkten die Bevölkerung schließlich in ihrer Überzeugung, dass der Sieg errungen sei und die Krankheit ihre Stellungen aufgebe. In Wirklichkeit war es schwer, zu behaupten, dass es sich um einen Sieg handelte. Es war nur festzustellen, dass die Krankheit zu gehen schien, wie sie gekommen war. Die Art der Kriegsführung gegen sie hatte sich nicht geändert. Gestern noch unwirksam, war sie heute offenbar erfolgreich. Nur hatte man den Eindruck, dass die Krankheit sich von selbst erschöpft hatte, oder vielleicht, dass sie sich zurückzog, nachdem sie alle ihre Ziele erreicht hatte. Ihre Rolle war irgendwie zu Ende."15
Die Pest in Oran endete, so Camus, ohne dass der Mensch seinen Beitrag dazu leistete – und sie endete, wie so viele Pestepidemien in den Jahrhunderten zuvor, in der Winterzeit. Auch hierfür gibt es mittlerweile eine wissenschaftliche Erklärung: Unter 10 Grad verfallen Flöhe in eine Kältestarre, fallen also als Überträger des Pesterregers aus, während ein Sommer mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad und nicht zu vielen Regenfällen zur Entwicklung und damit Verbreitung der Flöhe ideal ist.16
Die Übertragung der Erreger auf den Menschen kann auf zweierlei Wegen geschehen:
1. durch den Stich des Flohs, wobei Inhalte seines Vormagens oder Flohkot und damit auch die darin möglicherweise befindlichen Pestbazillen unter die Haut des Menschen gelangen. 17 Der Stich kann nun entweder symptomlos abheilen oder Pestkarbunkel (das sind kleine Bläschen auf der Haut) und/oder eine Hautpest hervorrufen. Die Erreger dringen teilweise über die Lymphbahnen in die Lymphknoten ein, in denen es zu einer Entzündung und Vereiterung kommen kann, wodurch die Knoten anschwellen: Das sind die Pestbeulen. Plötzliches hohes Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerzen, Benommenheit und Kreislaufkollaps sind weitere Symptome. Werden die Lymphknoten, die als eine Art Filter zur Aussonderung unerwünschter Substanzen fungieren, von den Erregern nicht überwunden, so besteht eine recht gute Überlebenschance des Erkrankten. 18 Kommt es hingegen zu einer Einschwemmung der Erreger in das Blut, so kann dies eine schwere Blutvergiftung zur Folge haben: „mit toxischem Schock, Haut- und Schleimhautblutungen, [...] Ruhelosigkeit oder Apathie, Krampfanfällen und Koma"19. Diese Form der Pest wird zumeist Beulen- oder Bubonenpest genannt. Im weiteren Verlauf kann sich hingegen eine sogenannte sekundäre Lungen pest bilden: Die Erreger gelangen vor bis zur Lunge. Brustschmerz, Husten und Blutauswurf kommen zu den genannten Symptomen hinzu.
2. Eine Tröpfcheninfektion anderer Menschen ist nun möglich. 20 Während die Bubonenpest eine Inkubationszeit von 2 bis 5, teilweise bis zu 10 Tagen und, ohne Behandlung, eine Letalität bis zu 80 Prozent besitzt, verläuft die Lungenpest, bei einer Inkubationszeit von bis zu drei Tagen, ohne spezifische Therapie zu 100 Prozent tödlich. 21
Bei Albert Camus klingt der Verlauf einer Beulenpesterkrankung in einem konkreten Fall folgendermaßen:
„Aber als [der Arzt] Rieux zu seinem Kranken kam, lehnte sich dieser gerade aus dem Bett, die Hand auf den Leib gepresst, die andere am Hals, und erbrach unter Krämpfen helle, rötliche Galle in einen Abfalleimer. Außer Atem nach der großen Anstrengung legte er sich endlich ins Bett zurück. Das Thermometer zeigte 39,5 Grad; die Halsdrüse und die Glieder waren geschwollen. An seiner Hüfte breiteten sich schwärzliche Flecken aus. Er klagte über innere Schmerzen. ,Es brennt', sagte er, ,der Schweinehund brennt.' Wegen seiner schwarzen, geschwollenen Zunge konnte er nur lallen. Seine hervorquellenden, vor Kopfschmerzen tränenden Augen waren auf den Arzt gerichtet."22
Nachdem das Fieber am Morgen des folgenden Tages auf 38 Grad gefallen war, kam bei dem Kranken, einem Hauswart, und seiner Frau Hoffnung auf, aber:
„Am Mittag schnellte das Fieber plötzlich wieder auf 40 Grad, der Patient delirierte unablässig und musste sich von neuem erbrechen.
Die Halsdrüsen schmerzten bei Berührung, und der Hauswart schien seinen Kopf möglichst weit vom Körper entfernt halten zu wollen."23
Dieser Verlauf der Erkrankung, das zunächst abfallende, anschließend heftiger auftretende Fieber, kann als typisch beschrieben werden. Oft tritt nun der Tod ein24, wie auch bei Camus' Hauswart, der sich mittlerweile in einem Krankenhaus befand:
„Mit grünverfärbten Gesicht, wachsbleichen Lippen, bleiernden Lidern, kurzem, stoßweisem Atem, von den Lymphknoten gemartert, lag er tief in seiner Matratze, als wollte er sich darin einschließen oder als riefe ihn ohne Unterlass eine Stimme aus der Tiefe der Erde: so erstickte der Hauswart unter einem unsichtbaren Gewicht. Seine Frau weinte. ,Ist keine Hoffnung mehr, Herr Doktor?' ,Er ist tot', sagte Rieux."25
Als Albert Camus seinen Roman „Die Pest" schrieb, wurden gerade die ersten wirksamen Heilmittel gegen diese Seuche, einzelne Antibiotika, entwickelt. Bis dahin galt, trotz aller Erkenntnisse über die Ursache und den Verlauf der Krankheit, die Pest als unheilbar.
Wie bereits erwähnt: Vieles von dem, was Camus und die heutige Medizinwissenschaft über die Pest wussten bzw. wissen, ist erst seit gut 120 Jahren bekannt. Im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnten bestimmten Erregern auch spezifische Krankheiten zugeordnet werden: So entdeckte beispielsweise 1873 der an einem Lepraspital in Bergen (Norwegen) tätige Assistenzarzt Gerhard Armauer Hansen mit Hilfe leistungsstarker Mikroskope den Lepraerreger (lt. Mycobacterium lepraey)26, Robert Koch fand und isolierte 1882 den Tuberkelbazillus (It. Mycobacterium tuberculosis)27, ein Jahr später den Erreger der Cholera (It. Vibrio cholerae), 1894 schließlich wurde der Pesterreger entdeckt (s.o.). In den Jahrhunderten zuvor blieb vieles Spekulation, wie auch etlichen zeitgenössischen Gelehrte bewusst war. Die Möglichkeiten zur Entdeckung der Erreger fehlten.
Bezüglich der Pest in der Frühen Neuzeit und den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurden folgende, in der Grafik 1 (siehe unten) dargestellte Ätiologien angenommen:
einerseits natürliche Faktoren wie
die Sterne,
ein spezielles Klima,
Dünste aus dem Erdinneren,
bestimmte Gewässer,
Tiere, Leichen und Aas,
einzelne Pflanzen und Früchte und
sogar der Mensch selbst,
andererseits übernatürliche Faktoren, wie
Gottes Engel sowie
Alle (mehr oder minder) ursächlichen Erscheinungen wirken entweder direkt oder auf Umwegen (zumeist wird die Luft genannt) auf den Menschen ein, der seinerseits über die Ansteckung die Pest, den Pestsamen, die Pestmaterie oder die Pestluft seinen Mitmenschen weitergibt.
Bei der Untersuchung dieser Ätiologien erweist es sich m. E. als sehr problematisch, sie aus dem heutigen medizinischen Wissen heraus als fortschrittlich oder rückständig einzustufen, wie dies vielfach in älteren medizingeschichtlichen Handbüchern geschehen ist: Die Strafe Gottes und der Einfluss der Himmelskörper werden hier missbilligend oder überhaupt nicht beurteilt28, die Befürworter der Pestansteckung (die sogenannten Kontagionisten) erscheinen grundsätzlich als tüchtige, unerschrockene und aufgeklärte Ärzte29, wobei z. T. ihre Begründungen keine Erwähnung finden, weil sie offensichtlich nicht in das Fortschrittsmodell der Medizinwissenschaft hineinpassten.30 Diese Tendenzen zeigen sich teilweise auch noch in neuere Fachliteratur zur Medizingeschichte, wie anhand der Einordnung des Kontagionisten Girolamo Fracastoro in dem Kapitel „3.3.3 Theorien der Ansteckung im 16. und 17. Jahrhundert" näher beleuchtet wird.
„Die Kultur der Vergangenheit kann man nur durch ein streng historisches Herangehen verstehen, nur dann, wenn man sie mit dem ihr entsprechenden Maße misst"31, schrieb Aaron J. Gurjewitsch im Jahre 1972 über das Mittelalter, doch trifft diese Aussage auch auf die darauffolgenden Jahrhunderte zu. Die „Vorstellungen und Werte" der Menschen dieser Zeit müssen, so führt er weiter aus, rekonstruiert, „die Methode, mit der sie die Wirklichkeit bewerteten", aufgezeigt werden.32 Anstatt also einzelne Gedanken über die Ursachen der Pest gänzlich unerwähnt zu lassen oder sie lediglich als Kuriosum aufzufassen, sollten vielmehr die Zeit und die Umstände der einzelnen Annahmen und Begründungen stärkere Beachtung finden. Erst dann wird, wie Hilde Schmölzer zurecht in ihrem Buch über die „Pest in Wien" (1985) schreibt, beispielsweise der Ratschlag, morgens und abends die Kirchenglocken kräftig läuten zu lassen, um die Luft zu säubern, nicht als unvernünftiges Mittel erscheinen, sondern innerhalb der frühneuzeitlichen Theorien als logische Konsequenz.33
Wie definiert eine Gesellschaft „Krankheit", „Seuche", „Pest"? Welche Akteure und welche Umstände sind an diesem Prozess der Begriffsbestimmung, der Sinngebung beteiligt? Martin Dinges stellt in seinem Aufsatz
„Neue Wege in der Seuchengeschichte?"34 ein sozial-konstruktivistisches Modell zur Erforschung der Seuchen vor, welches helfen soll, diese Fragen zu beantworten. Ausgehend von der „Vorstellung [...], dass es nur jeweils kommunikativ erzeugte Wirklichkeiten gibt", betont Dinges, dass eine Krankheit und der Umgang mit ihr soziale Konstrukte sind, die in einem „interaktiven Prozess" ausgehandelt werden. Daran beteiligt sind, nach Dinges, 1. die Kranken (in ihrem sozialen Umfeld); 2. die Heiler; 3. die ,Obrigkeit'; 4. die an den Seuchen interessierten Personen oder Institutionen (z. B. die Kirche); 5. „die öffentlichen Meinungen", worunter nicht nur die Summe der Einzelmeinungen, sondern auch die sich daraus ergebenen „Eigengesetzlichkeiten"35 zu verstehen sind; 6. das „Aushandeln zwischen den Akteuren in einer Wechselbeziehung mit dem [...] technisch-zivilisatorischen Stand (der Naturbeherrschung) einer Gesellschaft, der auch die naturräumlichen Gegebenheiten der Pathozenose einbezieht". Dieses Aushandeln findet (7.) in einzelnen Diskursen und Praktiken statt, welche (8.) „in einem gewissen historisch veränderlichen Machtgefälle zwischen den Beteiligten zum Einsatz kommen und dieses selbst mit konstituieren."36
Dieses Modell eignet sich m. E. sehr gut, um den Prozess einer Meinungsbildung (und damit Wirklichkeits-Bildung) in einer Bevölkerung möglichst umfassend darzustellen. Nachfolgend muss natürlich hinterfragt werden, welche Personen oder Institutionen zu den ersten vier Gruppen gehören, welche Beziehungen es innerhalb dieser Gruppen und zwischen ihnen gab, wie diese Beziehungen aufrechterhalten wurden – über welche Medien, welche Kommunikationsformen –, welche Naturgesetzlichkeiten hinzukamen, oder besser: wahrgenommen wurden.
Bezüglich der folgenden Untersuchung der spätmittelalterlichen und früh neuzeitlichen Pest, ihrem Wesen und ihrer Ursachen bedeutet dies folgendes: Als Quellen herangezogen wurden lediglich Schriften von Ärzten und Theologen. (Im weitesten Sinne können auch die jeweiligen Obrigkeiten genannt werden, auf dessen Geheiß einzelne Mediziner ihre Ansichten über die Pest veröffentlichten.) Innerhalb beider Gruppen gab es v. a. unter den Medizinern eine offenbar recht ausführliche Erörterung einzelner Standpunkte. Meinungen anderer Ärzte und deren Beobachtungen werden angeführt und besprochen, wobei, auch bei konträrer Meinung, kaum harsche Kritik zu finden ist. In den Pestschriften der Geistlichen finden sich hingegen kaum Diskussionen über eventuell strittige Themen. Zwar berufen sich einige Autoren in ihrer Argumentation auf die Meinung einer Autorität, auf Augustinus oder auf Martin Luther, jedoch nicht auf eine andere Pestschrift.
Betrachtet man nun die Beziehungen zwischen den Ärzten und Geistlichen, zeigt sich, dass die Grenzen zwischen den Wissenschaften (Medizin und Theologie) nicht so scharf gezogen wurden, wie dies heute der Fall ist: Der Calvinist und Doktor der Theologie, Wilhelm Triphyllodacnum (auch Klebitius genannt), steuert ebenso eine allgemeine (d. h. auch natürliche Ursachen besprechende) Pestschrift bei wie der Jesuitenpater Athanasius Kircher, dessen „Natürliche und medicinalische Durchgründung der laidigen ansteckenden Sucht"37 (1658/1680) auch von Medizinern angeführt wird.38 Gleichzeitig finden sich in vielen Schriften von Ärzten auch theologische Erklärungen, z. T. gar recht ausführlich. Leider führen sie jedoch kaum die Quellen ihres religiösen Wissens an.39
Was jedoch wusste der (nicht-gelehrte) Großteil der mitteleuropäischen Bevölkerung von den verschiedenen Ätiologien der Pest? Aufgrund der mangelnden Quellenlage ist diese Frage kaum befriedigend zu beantworten. Predigten zur Pestzeit, z. B. die des Ulmer Konrad Dieterich40, werden sicherlich viele Personen gehört haben, und auch die Maßnahmen der Obrigkeit zur Reinhaltung der Luft, zur Vermeidung der Kontagion werden sie wahrgenommen haben. Doch gab es auch tiefer gehende Reflexionen der einzelnen, von Gelehrten angenommenen Ursachentheorien? Besaßen die Mediziner der Frühen Neuzeit so viel Einfluss auf die Definition von Krankheiten wie heute? Dies müsste ebenso wie die zuvor genannten Beziehungen zwischen den Gelehrten noch näher untersucht werden, wenn man ein möglichst vollständiges Bild der Pestätiologien in einer Gesellschaft nachzeichnen möchte.
Meine Abhandlung beschränkt sich also auf die gelehrte Konstruktion der Krankheit „Pest". Ausgangspunkte zur Bestimmung dieses Begriffs sind zum einen die eigenen Erfahrungen, zum anderen Schriften über vergangene Pestausbrüche bzw. zumeist aus der Antike stammende theoretische Gedanken über diese Krankheit. Eine wechselseitige Wirkung muss hierbei angenommen werden: Einerseits wurde versucht, die eigenen Eindrücke in das traditionelle, zumeist humoralpathologisch geprägte Krankheitsbild einzuordnen, andererseits sind diese Eindrücke, die einzelnen Wahrnehmungen natürlich schon beeinflusst und selektiert durch eben dieses Krankheitsbild.
Wie gesagt: In Unkenntnis der tatsächlichen Ursache dieser Seuche waren die Gelehrten gezwungen, auf ihre bzw. auf die Erfahrungen anderer zurückzugreifen. Sie konnten ,nur' ihre Beobachtungen und die daraus geschlossenen Einsichten niederschreiben: wie sich eine zurückliegende Pest ,verhalten' hat, wie sie in ihren Augen entstand, sich ausbreitete, wie sie auf den Einzelnen wirkte und welche Mittel sich am besten zur Vorbeugung und Heilung eigneten. Von dieser Warte aus versuchten sie mit religiösen, astrologischen, magischen oder (im weitesten Sinne) naturwissenschaftlichen Erklärungen dem Phänomen „Pest" näherzukommen.
In diesem Rahmen werden die einzelnen Ätiologien vorgestellt und bewerte sie, wobei einzelnen Bereichen, die in der Forschungsliteratur z. T. aus obengenannten Gründen bislang nur am Rande behandelt wurden, eine besondere und ausführlichere Berücksichtigung zukommt: so v. a. den religiösen Anschauungen und der Ätiologie der Imagination. Dabei wird möglichst nahe an den Quellen gearbeitet. Das bedeutet z. B. bezüglich der theologischen Frage nach der Vorsehung, dass nicht eine ausführliche und tiefgreifende Ausführung über dieses, dem Nicht-Theologen vielfach unbegreifliche Thema geliefert wird. Lediglich Erklärungen, die zum Verständnis einer Quelle über Vorsehung und Krankheit vonnöten sind, sollen gründlich ausgeführt werden.
Dass auch die Ansteckung und die Disposition in dieser Abhandlung unter die Ursachen der Pest gerechnet werden, hat im Übrigen folgende Gründe: Sie wurden von vielen Gelehrten, die über die Pest schrieben, als Ursachen angesehen, was zum größten Teil in der oft unscharfen Begriffsgebung begründet liegt. So wird etliche Male zwischen primären und sekundären Ursachen unterschieden: Auf der einen Seite wird, manchmal in ein und derselben Quelle, ein Gift als primäre Ursache benannt, auf der anderen Seite die durch dieses Gift verdorbene Luft. Teilweise wird die beschmutzte Luft als erste Ursache angesehen, teilweise das hinter allem, also auch hinter der Luft, stehende Wirken Gottes. Die Reihe ließe sich noch fortführen. Bezüglich der Ansteckung und der Disposition heißt dies: Die Kontagion betrachteten einige beispielsweise als einzige Ursache in ,unseren' Breitengraden, weil nach ihrer Meinung das Pestgift nur in wärmeren Gebieten entstehen kann und von dort in mitteleuropäische Gefilde getragen' wird. Die Disposition wiederum beschrieben sie teilweise als sekundäre Ursache, weil immer wieder beobachtet wurde, dass einige Menschen scheinbar resistent gegen die äußeren Einflüsse waren. Hier stellt sich die Frage, was der jeweilige Gelehrte als wichtiger ansah: die Bekämpfung der eigentlichen Ursache, z. B. des Gifts in der Luft, oder die Stärkung der Abwehrbereitschaft des menschlichen Körpers – eine Frage, die, wie zum Schluss der Abhandlung näher erklärt, noch heute aktuell ist.
1.1 Literatur
Die Literatur, die sich mit der Pest befasst, ist mittlerweile nahezu unüberschaubar geworden. Die Liste umfasst Arbeiten über Epidemien allgemein, über Pestausbrüche zu bestimmten Zeiten und/oder in einzelnen Städten oder Landschaften und über die Folgen dieser Seuche: über ihre wirtschaftlichen, sozialen und religiösen, ja auch kunstgeschichtlichen Auswirkungen. Im Vordergrund der meisten Untersuchungen steht der große Teile Europas betreffende „Schwarze Tod" der Jahre 1347-135241, z. B. in der gut lesbaren Überblicksdarstellung von Klaus Bergdolt.42 Die anschließenden Pestwellen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit haben in der deutschen Forschungsliteratur lange Zeit recht wenig Beachtung gefunden. Mittlerweile liegen einige vorbildliche Regionalstudien vor, beispielsweise über Venedig43, Uelzen (und Umgebung)44, Basel45, Schleswig-Holstein46 und Bremen.47
Einen guten Überblick zur Pest allgemein liefert Manfred Vasold in seinem Buch „Pest, Not und schwere Plagen" aus dem Jahre 1991. Neben anderen Plagen (z. B. Pocken und die Cholera) hauptsächlich die Pest besprechend, diskutiert er fachkundig auch Probleme, die bis heute nicht restlos geklärt sind, so z. B. die Frage nach dem Ende der Pest in Mitteleuropa oder nach der Übertragungsweise der Seuche. Und auch einzelne Randthemen werden angeschnitten, so z. B. die Verbindung zwischen dem Hexenwesen und der Pest in der Frühen Neuzeit. Dass manches trotzdem unerwähnt bleibt, einzelne Ätiologien etwa, hängt natürlich vom Charakter solcher Überblicksdarstellungen ab.
Wegen des reichhaltigen Bildmaterials, aber auch einiger fundiert geschriebenen Aufsätzen bietet sich der von Hans Wilderotter herausgegebene Ausstellungskatalog aus dem Jahre 1995 als Ergänzung an.48
Ein Mangel dieser und weiterer allgemeiner Darstellungen der Pest bzw. der Seuchen insgesamt49 ist allerdings das Fehlen einer umfassenden Untersuchung der frühneuzeitlichen Pestschriften50 – Schriften, die vielfach zwar eher theoretischen Charakter besitzen, jedoch, im Gegensatz zu heutigen medizinischen Werken, immer wieder eigene Erfahrungen des Autors im Umgang mit der Pest, den Kranken und ihrem Umfeld beinhalten. Auch die in diesen Pestschriften mehr oder weniger ausführlich beschriebenen Ätiologien fanden bislang nur wenig Beachtung bzw. werden nur ausschnitthaft erwähnt – und das, obwohl sich gerade hier, gegenüber den mittelalterlichen Quellen, grundlegend neue Ansichten finden lassen. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung Johann Werfrings über die Ätiologien der Pest, die mir erst nach Abfassung eines Großteils meiner ursprünglichen Abhandlung zugänglich war.51
Verwiesen sei an dieser Stelle noch auf die grundlegenden Schriften zur Medizingeschichte, allen voran Karl Eduard Rothschuhs Werk über die „Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart".52 Weitere Literatur werden jeweils zu Beginn der einzelnen Kapitel genannt.
1.2 Quellen
„Die Pest ist eine solche unerforschliehe Kranckheit, daß, wie sehr sich auch die Allergelehrtesten darüber bemühet, bißhero doch noch keiner sich gefunden, der eigentlich die Ursache und Natur dieser ansteckenden Seuche gründliche hätte können beschrieben"53, heißt es in der Schrift „Der aufrichtige und erfahrne Pest-Barbierer" (erstmals 1683 erschienen) des Breslauer Chirurgen und Stadtarztes Mathäus Gottfried Purmann. Wie gesagt sollten noch über 200 Jahre vergehen, bis die Ursache der Pest erkannt werden würde. Tatsächlich haben sich die Gelehrten der Frühen Neuzeit sehr „bemühet", denn allein im mitteleuropäischen Raum54 zwischen 1500 und 1850 erschienen insgesamt über 1500 gedruckte Schriften, die die Pest – oder die Krankheiten, die unter diesen Sammelbegriff fielen55 – zum Thema hatten.56
Im Folgenden soll versucht werden, die unterschiedlichen Quellen zu ordnen. Eine Aufteilung in Traktate, Konsilien und Regimina, wie sie Rosemarie Dilg-Frank für die mittelalterlichen Quellen vorschlägt57, macht wenig Sinn, weil in der Frühen Neuzeit eine ganze Reihe neuartiger Quellen entstehen, die sich nicht in diese Einteilung fügen. Wie im Anhang aufgelistet, wird der Inhalt zum Ordnungskriterium gemacht, was auch bedeuten kann, dass eine Schrift in ihrem Titel den Begriff „Pestordnung" tragen kann und trotzdem unter die „allgemeinen Pestschriften" gerechnet wird.58 Zudem muss beachtet werden, dass es auch hier Mischformen gibt. Folgende Pestschriften sind zu unterscheiden:
a) allgemeine Pestschriften: Abhandlungen größeren Umfangs, die die Entstehung der Pest, ihr ,Wesen' und ihre Verbreitung, sowie die prophylaktischen und therapeutischen Mittel und Maßnahmen beschreiben. Zudem werden oft noch einzelne, wohl strittige Fragen behandelt. Diese Schriften können ein eigenständiger Bestandteil eines medizinischen Gesamtwerkes sein, oder aber schriftliche Werke, die der Autor in obrigkeitlichem Auftrag oder in ,Eigenregie' „dem barmhertzigen Gott zu Danck und Ehren / dem lieben Vatterland zu gutem / vnnd dem dürfftigen Nechsten zu Trost"59 in Druck gab;
b) spezielle Pestschriften: Abhandlungen, die sich mit einzelnen Aspekten der Pest beschäftigen, die z. T. auch in den allgemeinen Pestschriften erwähnt werden: mit der Astrologie bzw. Astronomie, mit der Luft als Pestursache, mit der Ansteckung und mit der Flucht vor der Pest.
c) Pestordnungen: Der Begriff „Pestordnung" bezeichnet alle Schriften, die vornehmlich Ratschläge über Maßnahmen zur Abwendung der Seuche – vom Einzelnen ebenso wie von den Einwohnern einer Stadt, eines Landes –, zur Versorgung und Heilung der Erkrankten, zur Organisation des öffentlichen Lebens beinhalten. Autoren waren zumeist ein einzelner heimischer Mediziner, ein so genanntes „Collegium medicum" oder Gesundheitsrat, der meist aus den Gelehrten der medizinischen Fakultät bestand 60 , oder auch ein Jurist. Sie handelten vielfach im Auftrag der jeweiligen landes- oder stadtherrlichen Obrigkeit;
d) Pestberichte: Pestberichte sind Darstellungen vergangener oder zeitgenössischer Seuchenausbrüche;
e) Pestkomrnentare: Diese Schriften erörtern frühere, zumeist antike Abhandlungen über die Pest;
f) religiöse Pestschriften: Religiöse Pestschriften umfassen alle Werke, die sich dem Phänomen Pest rein vom theologischen Standpunkt aus zuwenden; sie stammen demnach hauptsächlich von Geistlichen.
In der folgenden Grafik sind die Erscheinungsdaten aller Quellen verarbeitet: Danach erschienen die meisten Pestschriften zwischen 1560 und 1570, 1600 und 1630, 1670 und 1690 sowie zwischen 1720 und 1730. Anschließend nimmt die Zahl rapide ab und findet nur noch um 1790 einen kleinen Höhepunkt. Diese Daten decken sich ziemlich genau mit dem Auftreten der Pest in Mitteleuropa. Zwar gab es immer wieder kleinere Pestwellen: In Schleswig-Holstein beispielsweise kehrte die Pest zwischen 1350 und 1547/48 im Durchschnitt alle 12,5 Jahre wieder.61 Große Gebiete umfassende Pestwellen lassen sich um 1560, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), um 1680 und um 1714 beobachten.62 Dass hierbei trotz des vermehrten Auftretens der Seuche in den 1630er Jahren die Zahl der Quellen abnimmt, lag wahrscheinlich an den Auswirkungen des Krieges. Die hohe Zahl der Quellen um 1720 ist damit zu erklären, dass zum einen die letzte Pestwelle noch nicht überall vollständig abgeklungen bzw. noch im Gedächtnis war, dass zum anderen bereits Nachrichten über einen erneuten Einfall der Pest in Marseille (1720) nach Mitteleuropa drangen.63 Die Menschen hier konnten natürlich nicht ahnen, dass sie in der Folgezeit von dieser Krankheit verschont bleiben würden. Und so erscheinen auch in der zweiten Hälfte noch einige Schriften – wohl auch mit Blick auf einzelne Pestausbrüche in Osteuropa, so beispielsweise 1771 in Moskau.64
Fast genau die Hälfte aller Ausgaben der Pestschriften, 748 an der Zahl, sind Pestordnungen. Den Großteil dieser Quellen nehmen allgemeine Verordnungen über Abwendung und Therapie der Pest ein. Einzelne Themenbereiche folgen: 103 Verordnungen bezüglich der Arzneien und der dafür verantwortlichen Apotheken, 16 Schriften über einzelne, zur Pestzeit einzuleitende Maßnahmen und 18 juristische Schriften.
Aus diesen frühneuzeitlichen Quellen wurden insgesamt 180 ausgewählt, wobei bis auf die Kommentare alle Arten der Pestschriften vertreten sind. Als Kriterien der Auswahl sind zum einen eine zeitlich breit gestreute Quellenbasis zu nennen. Zum anderen sollten auch solche Schriften Erwähnung finden, die in der Frühen Neuzeit sehr bekannt waren, von der heutigen Medizingeschichtsschreibung hingegen vernachlässigt werden. Zudem dürfen auch nicht die Schwierigkeiten bei der Beschaffung bzw. Einsichtnahme frühneuzeitlicher Schriften vergessen werden.
Zu den Schriften vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert kommen einzelne Quellensammlungen des Mittelalters hinzu, einerseits zum Vergleich, andererseits, weil es m. E. zu Beginn der Frühen Neuzeit keine entscheidende medizin-historische ,Epochengrenze' gab.65
1 Camus, Albert: Die Pest. Aus dem Franz. übers. v. Guido G. Meister. Hamburg 1987, S. 13. Noch einige Anmerkungen zu meiner Zitierweise und Rechtschreibung: Eckige Klammem stehen für meine Zusätze oder Auslassungen, runde Klammern stammen von den Autoren selbst. Verwendet wird allgemein die aktuelle Rechtschreibung. Unverändert bleiben die Quellen, sofern sie aus dem Untersuchungszeitraum stammen (bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts).
2 Steht statt der Lebensdaten lediglich ein bestimmtes Jahr in Klammem, so ist damit das Erscheinungsjahr der jeweiligen Schrift gemeint. Bei wichtigen Quellen gebe ich z. T. zwei Daten, getrennt durch einen Schrägstrich, an: Das erste zeigt das Jahr der Ersterscheinung der Quelle an, das zweite die von mir benutzte Ausgabe.
3 Camus ging im März 1940 aus seinem Heimatland Algerien nach Paris. Zwei Monate später marschierten deutsche Truppen in diese Stadt ein, woraufhin Camus über verschiedene Stationen nach Algerien zurückkehrte, nach Oran, der Heimatstadt seiner Frau Francine. 1942 erkrankte er an Tuberkulose und reiste zur Genesung wiederum nach Frankreich. Eine Tante seiner Frau besaß in Le Panelier, einem fast 1000 Meter hoch gelegenen Ort südlich von Saint-Etienne, eine Pension. Der weitere Vormarsch der Deutschen nach Süden schnitt ihn von fast allen Kontakten zu seinem Heimatland, seiner Frau und seinen Verwandten ab. (Nach: Sändig, Brigitte: Albert Camus. Eine Einführung in Leben und Werk. 3., überarbeitete Aufl. Leipzig 1992, S. 103 ff.)
4 Camus, Albert: Tagebuch Januar 1942-März 1951. Reinbek bei Hamburg 1967, S. 65. Zitiert nach: Sändig (1992), S. 140. Siehe dazu auch: Steel, David: Plague writing: from Boccaccio to Camus. In: Journal of European Studies 11 (1981), 88-110, v. a. S. 102 ff.
5 Zur Frage der nahezu gleichzeitigen Entdeckung des Erregers durch den Japaner Kitasato siehe: Becht, Hans-Peter: Medizinische Implikationen der historischen Pestforschung am Beispiel des 'Schwarzen Todes' von 1347/51. In: Kirchgässner, Bernhard und Jürgen Sydow (Hg.): Stadt und Gesundheitspflege (Stadt in der Geschichte, Bd. 9). Sigmaringen 1982, S. 78-94, hier S. 82, Anm. 15. Nach Becht gestand der Japaner 1925 ein, sich bei der vermeintlichen Entdeckung getäuscht zu haben.
6 Ruffié, Jacques und Jean-Charles Sournai: Die Seuchen in der Geschichte der Menschheit. Übers. v. Brunhild Seeler. 2. Aufl. München 1993, S. 9.
7 Die erste Form dieser tierischen Pest (der Wildtiere) wird silvatisch, die zweite domestisch genannt. Schmitschek, Erwin und Günther T. Werner: Malaria, Fleckfieber, Pest: Auswirkungen auf Kultur und Geschichte – Medizinische Fortschritte. Stuttgart 1985, S. 158.
8 Kupferschmidt, Hugo: Die Epidemiologie der Pest: der Konzeptwandel in der Erforschung der Infektionsketten seit der Entdeckung des Pesterregers im Jahre 1894. (= Gesnerus: Supplement, Bd. 43; zugl. Zürich, Univ., Diss. 1992) Aarau/Frankfurt a. M./Salzburg 1993, S. 103.
9 Kupferschmidt (1993), S. 101.
10 Auch andere Floh arten kommen als Überträger in Betracht: Manfred Vasold führt aus, dass von den 2400 Floharten „vielleicht 120 die Pest übertragen können", von denen „weniger als 20" sich dem Menschen nähern. Siehe: Vasold, Manfred: Pest, Not und schwere Plagen: Seuchen und Epidemien vom Mittelalter bis heute. München 1991, S. 79. Ob auch Läuse und Wanzen, die den Pesterreger in sich tragen können, als Überträger in Frage kommen, ist nicht vollständig geklärt. Siehe Kupferschmidt (1993), S. 71 ff. und 80; Vasold (1991), S. 85.
11 Becht (1982), S. 93.
12 Kupferschmidt (1993), S. 109 ff. Siehe auch Bulst, Neithard: Demographische, wirtschafts- und kulturgeschichtliche Aspekte der Pestkatastrophe von 1347-1352. Bilanz der neueren Forschung. In: SaecuIum 30 (1979), S. 45-67, hier S. 48; Hatje, Frank: Leben und Sterben im Zeitalter der Pest: Basel im 15. bis 17. Jahrhundert. Basel/Frankfurt a. M. 1992, S. 22; Delumeau, Jean: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts. Übers. v. Monika Hübner (u.a.). Hamburg 1989, S. 145.
13 Becht (1982), S. 87.
14 Camus (1987), S. 13.
15 Camus (1987), S. 176.
16 Vasold (1991), S. 79; Hatje (1992), S. 23; Zinn, Karl Georg: Kanonen und Pest: über die Ursprünge der Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert. Opladen 1989, S. 164.
17 Vasold (1991), S. 80; Kupferschmidt (1993), S. 80. Vasold verweist an dieser Stelle auf die Tatsache, dass der Menschenfloh im Gegensatz zu dem Rattenfloh keinen Vormagen besitzt, weshalb für den Pulex irritans nur die zweitgenannte Übertragungsmöglichkeit, hauptsächlich mit Hilfe des Kratzens der gestochenen Person, zustande kommt. Zu der Diskussion über den Menschenfloh, die Emst Rodenwaldt mit seinem 1953 erschienenen Aufsatz über die Pest in Venedig 1575 bis 1577 auslöste, siehe: Vasold (1991), S. 80 ff.; Rodenwaldt, Ernst: Die Pest in Venedig 1575-1577. Ein Beitrag zur Infektkette bei den Pestepidemien Westeuropas. (=Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie d. Wissenschaften, Math.-Naturwiss. Klasse, Jg. 1952) Heidelberg 1953.
18 Siehe: Becht (1982), S. 84; Ibs, Jürgen Hartwig: Die Pest in Schleswig-Holstein von 1350 bis 1547/48: eine sozialgeschichtliche Studie über eine wiederkehrende Katastrophe. (=Kleine Werkstücke, Reihe A, Bd. 12; zugl. Kiel, Univ., Diss. 1993) Frankfurt a. M. 1994, S. 76. Diese Art der Pest wird „pestis minor" genannt und hat in Mittelalter und Früher Neuzeit eine wohl nicht unerhebliche Rolle gespielt.
19 Schmitschek/Werner (1985), S. 161.
20 Erkrankt ein Mensch auf diese Weise, spricht man von einer primären Lungen pest.
21 Ibs (1994), S. 76; Schmitschek/Wemer (1985), S. 160 f.; Vasold (1991), S. 71 ff. Die zeitlichen Angaben schwanken teilweise.
22 Camus (1987), S. 16.
23 Camus (1987), S. 17.
24 Siehe: Zinn (1989), S. 166 f. Zinn zitiert hier: Trüb, C. L. P., Daniels, J. und J. Posch (Hgg.): Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. (=Das öffentliche Gesundheitswesen, Bd. III/Teil A/2) Stuttgart 1971, S. 315.
25 Camus (1987), S. 17.
25 Siehe Feldmeier, Hermann: Lepra. In: Schadewaldt, Hans (Hg.): Die Rückkehr der Seuchen: Ist die Medizin machtlos? Köln 1994, S. 43-71, hier S. 57.
27 Voigt, Jürgen: Tuberkulose. In: Schadewaldt (Hg., 1994), S. 73-94, hier S. 83.
28 Siehe: Haeser, Heinrich: Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten. 3 Bde. 3. Aufl. Jena 1875-1882 (ND Hildesheim/New York 1971), hier 3. Bd., S. 353.
29 Haeser, Bd. 3 (1882), S. 353 und 416.
30 Siehe das Beispiel des Arztes Ausgustus Quirinus Rivinus, auf den ich im Kapitel über die Imagination als Ursache der Pest näher eingehe.
31 Gurjewitsch, Aaron: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus d. Russ. übers. v. Gabriele Loßack. München 1980 (russ. Ausg.: Moskau 1972), S. 8.
32 Gurjewitsch (1980), S. 17.
33 Schmölzer, Hilde: Die Pest in Wien. „Deß wütenden Todts Ein umbständig Beschreibung..." Wien 1985, S. 109 f. Siehe weiter unten das Kapitel „Weiteres Verfaultes und Übelriechendes", wo ich auf dieses Beispiel zurückkomme.
34 Dinges, Martin: Neue Wege in der Seuchengeschichte? In: Ders. und Thomas Schlich (Hg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte. (=Medizin, Gesellschaft und Geschichte, Beih. 6). Stuttgart 1995, S. 7-24.
35 Dinges (1995), S. 14.
36 Dinges (1995), S. 9.
37 Kircher, Athanasius: Natürliche und medicinalische Durchgründung der laidigen ansteckenden Sucht, und so genanten Pestilentz [...]. Augsburg 1680, die It. Schrift erschien 1658.
38 Siehe z. B. Haen, Anton von: Von der Pest. Basel 1789.
39 Eine Ausnahme ist z. B. der Frankfurter Arzt Ludwig von Hörnigk, der z. B. bei der Beantwortung der Frage, ob die Pest auch durch die Sterne verursacht werden kann, neben etlichen Ärzten (gleichrangig) auch einige Theologen anführt. Siehe: Hörnigk, Ludwig von: Würg-Engel: Von der Pestilentz Namen / Eygenschafft / Ursachen / Zeichen / Praeservation / Zufällen / Curationen [...]. In 500 Fragen [...]. Frankfurt a. M. 1644, S. 115 f.
40 Dieterich, Konrad: Vlmische Dancksagungspredig Wegen gnädiger Abwendung der grausamen geschwinden Seuche der Pest / Auß dem 107. Psalmen / v. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Gehalten [...]. Ulm 1644.
41 Seit dem 17. Jahrhundert wird die Pestkatastrophe von 1347-1352 als „Schwarzer Tod" bezeichnet. Vgl. Bulst (1979), S. 45.
42 Bergdolt, Klaus: Der Schwarze Tod in Europa: die große Pest und das Ende des Mittelalters. München 1994. Hier findet sich, wie auch bei Bulst (1979) und Becht (1982), weitere Literatur.
43 Rodenwaldt (1953).
44 Woehlkens, Erich: Pest und Ruhr im 16. und 17. Jahrhundert. Grundlagen einer statistisch-topographischen Beschreibung der großen Seuchen, insbesondere in der Stadt Uelzen. Hannover 1954.
45 Hatje (1992).
46 Ibs (1994).
47 Schwarz, Klaus: Die Pest in Bremen. Epidemien und freier Handel in einer deutschen Hafenstadt 1350-1713. (=Veröffentlichungen a. d. Staatsarchiv d. Freien Hansestadt Bremen, Bd. 60) Bremen 1996. Weniger empfehlenswert sind m. E.: die zumeist unkritisch die Quellen nacherzählende Schrift Elisabeth Pfaus über Ulm (Pfau, Elisabeth: Die Pest in der Freien Reichsstadt Ulm. Inaug.-Diss. zur Erlangung der med. Doktorwürde der hohen medizinischen Fakultät der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main. Frankfurt a. M. 1948); die Arbeit von Heide Schmölzer (1985) über Wien, die auf jegliche Quellen- und Literaturverweise verzichtet; der recht oberflächliche Ausstellungskatalog über die Pest im Ruhrgebiet (Pest im Ruhrgebiet. Seuchen und Krankheiten im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zum Jubiläum „350 Jahre Westfälischer Frieden". Ausstellungskatalog Städtische Galerie im Schlosspark Strünkede, Herne 19. Juni-23. Aug. 1998. Heme 1998).
48 Wilderotter, Hans (Hg.): Das große Sterben. Seuchen machen Geschichte. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums Dresden v. 8. 12.1995 bis 10. 3. 1996. Berlin 1995.
49 Siehe z. B. Ruffié/Sournai (1993); Winkle, Stefan: Geißeln der Menschheit: Kulturgeschichte der Seuchen. DüsseIdorf/Zürich 1997; Leven, Karl-Heinz: Die Geschichte der Infektionskrankheiten: von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Landsberg/Lech 1997.
50 Ältere Abhandlungen, wie z. B. das erwähnte „Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epidemischen Krankheiten" von Haeser besprechen zwar eine ganze Reihe von Quellen, jedoch, wie gesagt, immer nur einzelne Aspekte unter dem Maßstab der Fortschrittlichkeit.
51 Werfring, Johann: Der Ursprung der Pestilenz: zur Ätiologie der Pest im loimographischen Diskurs der frühen Neuzeit. [=Reihe Medizin, Kultur und Gesellschaft, Bd. 2] Wien 1998. Nach einem ersten Überblick finden sich einige Punkte meiner Abhandlung auch in Werfrings Werk, das jedoch auf einer deutlich schmaleren Quellenbasis fußt.
52 Rothschuh, Karl E.: Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart. Stuttgart 1978. Zudem noch: Eckart, Wolfgang U.: Geschichte der Medizin. 2., komplett überarbeitete Aufl. Berlin/Heidelberg 1994; Ackerknecht, Erwin H.: Geschichte der Medizin. 7., überarbeitete und erg. Aufl. von Axel Hinrich Murken. Stuttgart 1992; Diepgen, Paul: Geschichte der Medizin. Die historische Entwicklung der Heilkunde und des ärztlichen Lebens. Bände 1, 2/1 und 2/2. Berlin 1949-1951.
53 Hier zitiert nach der Ausgabe: Purmann, Matthaeus Gottfried: Rechter und wahrhafftiger Feldscherer [...]. Nebst Beyfügung des Pest-Barbiereres [...]. Frankfurt/Leipzig 1738, S. 273.
54 Zur genaueren Bestimmung dieses Raums sowie zur Auswahl der Quellen siehe die Fußnote im Anhang zu dem Kapitel „Gesammelte Quellen über die Pest aus dem mitteleuropäischen Raum".
55 Der Begriff „Pest" wurde in Mittelalter und Früher Neuzeit für weit mehr Arten von Krankheiten gebraucht als heute. Die Frage, ob es sich bei einer beschriebenen Krankheit tatsächlich um die Pest (nach heutiger Definition) handelte, ist zumeist nur spekulativ zu beantworten (siehe dazu: Leven, 1997, S. 13 und Hatje, 1992, S. 18). Meist findet sich in den Quellen eine sehr weit gefasste Definition der Pest, unter die auch die Pest im heutigen Sinne fällt.
56 Ich habe insgesamt 1587 Quellen gezählt, die auch heute noch in Archiven und Bibliotheken einsehbar sind. Es muss davon ausgegangen werden, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Quellen gibt, nicht mehr vorhanden sind bzw. noch nicht verzeichnet sind.
57 Siehe: Dilg-Frank, Rosemarie: das „Consilium de peste" des Saladin Ferro von Ascoli. Kritische Textausgabe mit deutscher Übersetzung. Ein Beitrag zur Pestliteratur des ausgehenden Mittelalters. Diss. rer. nat. Marburg (Univ.: Inst. f. Gesch. d. Pharmazie) 1975, S. 62 ff: Unter Traktate versteht sie „kurze bis mittelgroße, mehr oder weniger gelehrte Abhandlungen zum Thema Pest, oft auch nur Rezepte [...], die im Mittelalter den Kern des Pestschrifttums ausmachen" (S. 64), unter Regimina eine scholastische Gattung, die einerseits eine „wissenschaftstheoretische Konzeption" vertritt, andererseits „als Lehrschrift zur gesunden, vernünftigen Lebensführung, aber auch auf praktische Anwendbarkeit ausgerichtet" ist, wobei Theorie der Medizin und ärztliche Praxis miteinander vermengt sind. Ihr Hauptgegenstand sind die diätischen Maßnahmen, zentral die sogenannten „sex res non naturales" (siehe unten). Ihre ,Blüte' besaßen sie im 13.-15. Jahrhundert durch Impulse aus der arabischen Medizin. Die „Konsilien" tauchen verstärkt seit Beginn des 15. Jh. zunächst in Italien auf (Consilia preservativa; Consilia curativa; Consilia conservativa), sind an einzelne oder mehrere Adressaten gerichtet und wurden von einem oder mehreren Autoren meist als Auftragsarbeit verfasst. Hier treten mehr und mehr „eigene therapeutische Erfahrungen, experimenta, in den Vordergrund": „Mit ihnen zeichnet sich die allmähliche Loslösung vom starren Autoritätenglauben ab." (S. 65) Vielfach sind Mischformen – trotz spezieller Bezeichnung im Titel – anzutreffen.
58 Siehe z. B. die Schrift: Sorbait, Paulus de: Pest-Ordnung / Oder Der gantzen Gemein Nützlicher Bericht und Gutachten / Von der Eigenschafft und Ursachen / Der Pestilentz IN GENERE [...]. Wien 1679, S. 44, in: [Anonym] Pest-Beschreibung und INFECTIONS-Ordnung. Welche Vormahls in besondern Tractaten heraus gegeben / nunmehro aber in ein Werck zusammen gezogen [...] Wien 1727.
59 Hörnigk (1644), Einleitung.
60 Siehe: Sander, Sabine: Handwerkschirurgen. Sozialgeschichte einer verdrängten Berufsgruppe. (=Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 83) Göttingen 1989, S. 32 f.
61 Ibs (1994), S. 129 f.
62 Vasold (1991), S. 123 ff., 146 ff., 164 ff.
63 Vasold (1991), S. 171 f. Einige Pestschriften behandeln daher auch speziell diesen Pestausbruch (siehe im Anhang „Berichte über ,aktuelle' oder vergangene Pestepidemien").
64 Auch von diesen Ausbrüchen handeln einige Pestschriften dieser Zeit (siehe im Anhang „Berichte über ,aktuelle' oder vergangene Pestepidemien").
65 Bergdolt, Klaus (Hg.): Die Pest 1348 in Italien. Fünfzig zeitgenössische Quellen. Heidelberg 1989. Sudhoff, Karl: Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der Epidemie des „schwarzen Todes" 1348. In: Arch. Gesch. Med. Bd. 4 (1910/11), S. 190-222 und 389424; Bd. 5 (1911/1912), S. 36-87 und S. 332-396; Bd. 6 (1912/1913), S. 313-379; Bd. 7 (1913/1914), S. 57-114; Bd. 8 (1914/1915), S. 175-215 und S. 236-289; Bd. 9 (1915/1916), S. 53-78 und S. 117-167; Bd. 11 (1918/1919), S. 44-92 und S. 121-176.
2. Übernatürliche Ursachen der Pest
2.1 Die Pest als Strafe Gottes
2.1.1 Einleitung
„Krieg / Hunger und Pestilentz" waren nach einer „Historischen Beschreibung" (1714) aus Regensburg die drei Plagen, von denen diese Stadt in den Jahren 1613 und 1633/34 heimgesucht wurde.66 Dass dem Krieg der Hunger, dem Hunger die Pest folgt – dieser Formel, in den Quellen immer wieder erwähnt67, kann auch nach dem gegenwärtigen Forschungsstand der Medizin zugestimmt werden. Noch heute zeigt sich, dass gerade in Kriegsgebieten und Kriegszeiten eine erhöhte Seuchengefahr besteht – zum einen wegen der oft mangelhaften hygienischen Zustände, zum anderen aber auch wegen der oft unzureichenden Bestellung der Felder in diesen Zeiten und der daraus resultierenden mangelnden oder ungesunden Ernährung. Diese Umstände können, neben anderen Faktoren, zu einer größeren Anfälligkeit des Einzelnen gegenüber Krankheiten allgemein führen.68 Solche Vorstellungen einer sogenannten Disposition oder Krankheitsbereitschaft waren auch den früh neuzeitlichen Gelehrten nicht fremd: Eigene Beobachtungen und Erfahrungen zeigten ihnen immer wieder, dass nicht alle Menschen von einer schnell und erbarmungslos um sich greifenden Krankheit wie der Pest ergriffen wurden, wie weiter unten in dem Kapitel über die verdorbene Luft und Miasmen noch näher ausgeführt wird.
Die Dreiheit Krieg-Hunger-Pest hingegen war kein reiner Erfahrungswert' der Frühen Neuzeit: Sie wird bereits in der Bibel angesprochen, explizit zum ersten Mal in 2. Samuel 24.69 Während Krieg, Hunger und Pest schon zuvor, z. B. in 3. Mose 26,23 ff., nur ein Teil des Strafenkatalogs Gottes waren, verfestigte sich nun dieser Topos: Jeremia 29,17 und 34,17, Hesekiel 7,15 und 12,16 sind nur einige Beispiele. Zu dieser Dreiheit kommen an einigen Stellen noch die wilden Tiere hinzu, so beispielsweise in Hesekiel 14,21 oder in der Prophezeiung über das vierte apokalyptische Pferd gemäß Offenbarung 6,8: „Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden."70 (Andere Übersetzungen nennen hier statt „Tod" die „Pest"71 oder „Seuchen"72.) Die wilden Tiere werden in den Pestquellen jedoch nur selten genannt: lediglich von dem lüneburgischen Arzt Gervasius Marstaller (gest. 1578)73 und dem in Danzig geborenen lutherischen Prediger Joachim Weickhmann (1662-1736)74. Letztgenannter führt dafür als Begründung an: Gott nimmt die wilden Tiere einfach seltener zu Hilfe, um die Menschen zu strafen.75
Auch in bildlichen Darstellungen des strafenden Gottes werden Krieg, Hunger und Pest wiederholt dargestellt, symbolisiert durch drei Pfeile, die Gott selbst oder Engel in seinem Auftrag zur Erde hinunter schleudern. Zwei Gemälde seien beispielhaft genannt: eines von einem schwäbischen Meister aus dem Jahre 151976, ein anderes – in Form von zwei Altarflügeln, die wohl ursprünglich für einen Pestaltar vorgesehen waren – von Martin Schaffner (Ulm) aus derselben Zeit (um 1520).77 Beide Werke werden in den jeweiligen Kapiteln – über die Jungfrau Maria und über die Rolle der Heiligen – noch genannt.
Dass Gott die Menschen für ihre Vergehen bestraft, wird in den von mir untersuchten Pestschriften nur selten angezweifelt. Lediglich der venetianische Arzt Nicolaus Massa (gest. 1564)78, dessen Schrift über die pestartigen Fieber 1540 erschien, lehnt dies direkt ab. Hinzu kommen vereinzelt Schriften, die unter den Ursachen der Pest die Strafe Gottes nicht erwähnen. Dies kann, muss allerdings nicht bedeuten, dass sie einen göttlichen Einfluss auf die Pest ablehnen: Eine Augsburger Pestverordnung von 1521 beispielsweise nennt die Gottesstrafe zunächst nicht, führt jedoch als besten Schutz gegen die Pest die Zuflucht zu Gott an.79
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts aber erhöht sich der Prozentsatz der Schriften, die die Strafe Gottes nicht erwähnen, gegenüber der Gesamtzahl der Quellen aus dieser Zeit recht auffällig.80 Dies fiel auch den Zeitgenossen auf, wie im Kapitel „Atheismus und die Pest" noch aufgezeigt wird. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts findet sich allein in der Schrift des Wiener Mediziners Anton von Haen (1704-1776)81 noch die Frage, ob die Pest eine unmittelbare Strafe Gottes ist.82 Die drei von mir untersuchten Schriften des 19. Jahrhunderts nennen den göttlichen Einfluss schließlich gar nicht mehr.83 Die möglichen Gründe dafür – z. B. die Säkularisierung der Wissenschaften – wird weiter unten erläutern. Hierzu gehört auch die Frage nach der in den Quellen vielfach zu beobachtenden Trennung zwischen einer natürlichen und einer übernatürlichen Pest.
2.1.2 Quellen
Neben den allgemeinen Pestschriften wurden zur Beantwortung hauptsächlich die religiösen Abhandlungen hinzugezogen. Insgesamt konnten 207 Quellen ausfindig gemacht werden, die sich vom religiösen Standpunkt aus dem Phänomen der Pest nähern. Bis auf 21 Schriften war es möglich, den Autoren eine bestimmte Konfession zuzuordnen, wobei sich ein deutliches Übergewicht auf der lutherischen Seite zeigt: 119 lutherischen Quellen stehen 53 katholische (davon drei aus vorreformatorischer Zeit) und 14 reformierte (calvinistische und zwinglianische) gegenüber.84 Ein Grund für diese Dominanz liegt nach der entsprechenden Forschungsliteratur85 wohl in dem Zusammenhang zwischen der neuen Drucktechnik und der Reformation: V. a. lutherische Schriften waren für die Drucker besser abzusetzen als die katholischen. Hierfür gab es ,äußerliche' und inhaltliche Gründe: Zum einen erschwerte die von den katholischen Gelehrten bevorzugte lateinische Sprache den Absatz ihrer Schriften.86 Zum anderen hat sicherlich auch die Erwartungshaltung der potenziellen Leserschaft, die dem Neuen, also dem reformatorischen Gedankengut, mehr Bedeutung zumaß, eine Rolle gespielt. Fakt war jedenfalls, dass einige katholische Buchdrucker selbst bei bestehenden Verboten reformatorische Schriften druckten oder drucken wollten.87
Nach Form und Inhalt lassen sich die 207 religiösen Quellen wie folgt aufteilen: Die meisten Schriften wurden bis 1750 gedruckt, drei Quellen aus den Jahren 1788, 1797 und 1833 kommen hinzu. Die vorstehende Grafik zeigt auf, dass die Höhepunkte in etwa mit denen der Quellen insgesamt (Grafik 2, siehe oben) übereinstimmen, wobei sich bei den religiösen Quellen ein deutliches Übergewicht in den Jahren 1561 bis 1630 zeigt, in denen insgesamt 113 Schriften erschienen (siehe Grafik 3).
Bezüglich der konfessionellen Unterscheidung der Schriften (Grafik 4) kann festgehalten werden, dass die meisten lutherischen Schriften ebenfalls in diesen Zeitraum fallen. Bei den katholischen Beiträgen fällt auf, dass immerhin 19 Schriften aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen, davon 11 aus den Jahren 1711-1720. Der Grund für dieses ,katholische Nachhinken' ist mir nicht bekannt: In diesen Jahren wütete die Pest nicht nur im eher katholischen Süden und Südosten, sondern auch im Norden Mitteleuropas.
Von der Länge und Gliederung der einzelnen Schriften lassen sich ebenso wenig wie vom Inhalt her übergreifende Einteilungen erstellen. Ein vierseitiges „Gebett zu dem heil. Benno, zur Zeit der Pestilenz"88 ist ebenso vertreten wie eine 32-seitige Danksagungspredigt89, eine mehrseitige Anweisung für die Pfarrer in Seuchenzeiten90 ebenso wie ein über 100 Seiten starkes lateinisches Buch über die Ursachen der Pest91. Lediglich einzelne Fragen – wie z. B. die eher ethische Problemstellung, ob ein Christ zu Pestzeiten aus einer Heimat fliehen dürfe92 – und Besprechungen bestimmter Bibeltexte sind mehrmals anzutreffen.93
Von den 207 religiösen Pestschriften wurden 37 Quellen untersucht, davon eine vorreformatorische, neun katholische, 24 lutherische, drei reformierte und eine Quelle von einem Autor unbekannter Konfession ausgewählt94, von denen einige ausführlicher besprochen werden.
Zu den allgemeinen Pestschriften ist noch zu sagen, dass sie bis in das 18. Jahrhundert hinein die Strafe Gottes als Ursache teilweise recht ausführlich, teilweise jedoch, im Verhältnis zu den übrigen Ursachen, nur kurz erwähnen.95 Leider ließen sich die Konfessionen der Autoren nur selten feststellen: Die zu Rate gezogenen Biografien96 geben, sofern sie die Verfasser überhaupt erwähnen, meist keine Auskunft über ihr Bekenntnis. Eine lückenlose Aufschlüsselung der Konfession wäre interessant – nicht nur für die Bewertung der Gottesstrafe als Ursache der Pest, sondern auch für die der anderen Ätiologien.
2.1.3 Literatur
Es gibt nur relativ wenige Schriften, die sich historisch mit dem Zusammenhang zwischen Religion und Medizin auseinandersetzen. Zu nennen sind hier einige Überblicksdarstellungen: Unter der älteren Literatur sind z. B. Emanuel Berghoffs „Religion und Heilkunde im Wandel der Zeiten" (1937)97 und H. Magnus' „Medizin und Religion in ihren gegenseitigen Beziehungen" (1902)98 zu nennen, für die neuere Zeit sei Karl Ed. Rothschuhs Kapitel über die sogenannte latrotheologie zu erwähnen.99
Daneben finden sich einige Darstellungen, die einzelne Zeitperioden oder Probleme behandeln: Darrel W. Amundsen und Gary B. Ferngren beschäftigen sich mit dem vor- und frühchristlichen sowie mittelalterlichen Verhältnis von Medizin und Religion100, Martin E. Marty mit der lutherischen101, Kenneth L. Vaux mit der reformierten Tradition102; die Beziehung zwischen Wundern bzw. Wunderheilungen und Medizin sind mehrmals thematisiert worden103; die biblischen Aussagen über Krankheit und Medizin fanden ebenso Beachtung104 wie die Ausführungen der Kirchenväter zu diesem Thema.105 Auch die meinem Thema nahekommende Untersuchung des Phänomens der Sünde als Ursache von Krankheit ist eingehender beleuchtet worden: 1950 in einer zeitlichen Gesamtübersicht von Wolf von Siebenthal106, 1986 für das Mittelalter von Jerome Kroll und Bernard Bachrach.107
Für den von mir untersuchten Zeitraum, die Frühe Neuzeit, fällt jedoch auf, dass in der diesen Zeitraum umfassenden Forschungsliteratur selten die Frage nach einer möglichen konfessionell unterschiedlichen Bewertung von Krankheit und Krankheitsursache gestellt wird. Und dort, wo sie aufgeworfen wird, scheint die Quellenlage kaum beachtet worden zu sein: Teilweise werden relativ wahllos Aussagen verschiedener Gelehrter besprochen108, teilweise – ganz in der Tradition der Medizingeschichte – lediglich die Aussagen ,großer' Männer erwähnt: Die Theologische Realenzyklopädie führt z. B. unter dem Stichwort „Krankheit", Kapitel „Reformationszeit" (S. 694 ff.) lediglich die Ansichten Luthers und Calvins hervor, im anschließenden Kapitel über die Neuzeit (S. 697 ff.) sind nur einzelne allgemeine Feststellungen über die protestantische Theologie und ihr Verhältnis zur Medizin sowie über den Pietismus zu finden.109 In Karl Eduard Rothschuhs in vielerlei Hinsicht wichtigem Buch „Konzepte der Medizin in Vergangenheit und Gegenwart" (Stuttgart 1978) erscheint unter der Überschrift „latrotheologie und neuzeitliche Medizin" lediglich einmal der Begriff „reformatorisch" – und dort auch nur, um die Zeit nach dem Mittelalter zu kennzeichnen. Über konfessionell bedingte Ansichten erfährt man nahezu gar nichts, obwohl Rothschuh selbst treffend schreibt: „Außerdem war die Theologie im 16. Jahrhundert fast die Alleinherrscherin, zumindest die Gouvernante unter allen Wissenschaften."110
Der direkte Zusammenhang zwischen religiösen Anschauungen und der Pest wird vielfach nur in seiner praktischen Dimension beschrieben111- die Wallfahrten und die Heiligenverehrung zur Abwendung der Pest die theoretischen Grundlagen hingegen bleiben oft unberücksichtigt. Eine Ausnahme bildet, zumindest für das Altertum, Stefan Winkles Kapitel über die Pest in seinem Buch „Geißeln der Menschheit", in dem er auch auf die biblischen Aussagen zur Pest näher eingeht.112
Begonnen wird mit der Erläuterung einzelner Themen, die sich religiös mit der Pestätiologie beschäftigen. Eine oder mehrere religiöse Pestschriften werden dafür jeweils in den Vordergrund gestellt, um, bei aller erwähnten Unterschiedlichkeit der Quellen, zumindest einen kleinen Eindruck über Form und Inhalt derselben zu vermitteln.
2.1.4 Die erste Sünde, Sünden und ihre Folgen
2.1.4.1 Christoph Camerer (1650): Eva und Maria
In seiner 1649 gehaltenen und 1650 gedruckten „Predig Umb gnädige Abwendung der Pest [...]" fragt der Jesuit Christoph Camerer113 danach, „was doch das stärckiste [=stärkste] Ding were in der gantzen Welt?"114 Er stellt einige, z. T. recht unterschiedliche ,Dinge' zur Diskussion: (a) den Krieg, (b) die Liebe Gottes, (c) die Frau, (d) den Frieden und (e) den Tod.
Camerer spricht zunächst den Krieg an, und er bezieht sich dabei auf die Ereignisse und Erlebnisse in den Jahren zuvor, auf den Dreißigjährigen Krieg. Dieser habe „den armen Kindern / den armen Wittib [=Witwen] vnd Waysen" nichts anderes „als zween Gäst [...]/ den laidigen bittern Hunger vnd die erschröckliche Sucht [=Krankheit] der Pestilentz" zurückgelassen. Doch selbst die schrecklichen Konsequenzen des Krieges können, nach Camerer, nichts gegen die (b) Liebe Gottes ausrichten, sie vermögen den gläubigen Menschen nicht von der Charitas Gottes zu trennen.115
Oder ist (c) die Frau „das allerstärckiste Stuck"116? Schließlich hat ein „Weib" die Sünde in die Welt gebracht und damit alles Leid ausgelöst.
Höher als den Krieg, die Liebe Gottes und die Frau stellt der Jesuit (d) den Frieden, denn dieser herrscht jetzt wieder, er hat den Krieg besiegt, er ist „so stark / daß GOTT die gantze Welt darmit eingenommen". Friede bedeutet Liebe gegenüber dem Feind und ist daher viel höher anzusehen als die Liebe zu einem Freund, wie das biblische Beispiel des Stephanus gemäß der Apostelgeschichte (7,54-59) zeigt: Seine Liebe zu denen, die ihn aufgrund seiner Lehren steinigten, bewirkte, dass er „durch alle Himmelthür durch biß zu dem Thron GOttes hinauff" sehen konnte.117
Bevor der Schreiber endlich das wahrhaft Stärkste zur Sprache bringt, erwähnt er noch das fahle Pferd der Apokalypse (Offenbarung 6,7-8), auf dem der Tod sitzt, der stärker ist als alle Soldaten und Waffen, der mit Krieg, Hunger und der Pest118 tötet. Er ist der „Tyrann vnd Weltstürmer", der den Menschen u. a. mit dem „Pfeil der Pestilentz"119 nach ihrem Leben trachtet.
Allein die Mutter Gottes, Maria, übertrifft in Form des „wunderthätigen Bildnuß der glorwürdigsten Jungkfrawen zu Alten Oetingen" all ' die genannten ,Dinge' an Stärke: Sie hat den Ort Altötting vor dem Eindringen der Feinde bewahrt, die Pest nicht vordringen lassen. (Tatsächlich wurde Altötting, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges der größte süddeutsche Wallfahrtsort, von den Kriegswirren der folgenden Jahre verschont.120) Vorbild für das Handeln in Altötting war, Camerer zufolge, der Kreuzgang von Papst Gregor dem Großen im Rom des 6. Jahrhunderts zu einem Marienbild, „Salus populi Romani" genannt. Diese Ikone, angeblich vom Evangelisten Lukas gemalt, befindet sich noch heute in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Durch den Kreuzgang erbarmte sich die Mutter Gottes und der schlagende Engel zog das „blutige Schwert der Pestilentz"121 hinweg. Darufhin hörte Papst Gregor Engelsstimmen und die Pest endete.
Was schrieb nun Christoph Camerer selbst über die Ursache der Pest? Zunächst bemerkt Camerer, dass der Reiter des fahlen Pferdes von Gott selbst geschickt wurde: „Dann diser Reuter ist von einem grossen Haupt außgeschickt / dieser Rumormaister [lt. rumor=Lärm, Aufstand] ist von dem gerechten GOTT selber auß / vnd in vnser Land herein geschickt vnd gesandt worden; alles auß gerechtem Vrtl [=Urteil] wegen vnserer Sünd vnd Laster [...]."122





























