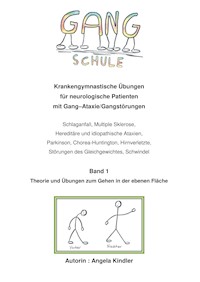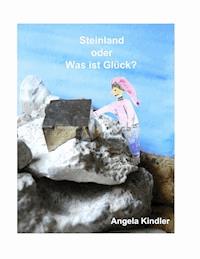Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Vielzahl neurologischer Erkrankungen wie z.B. Schlaganfall, Multiple Sklerose und Heredo-Ataxien haben eine Gang-Ataxie (Gangstörung infolge mangelnder Bewegungskoordination) zur Folge. Diese kann bis zum völligen Verlust der Gehfähigkeit führen. Ich bin selber Betroffene und habe fast nicht mehr laufen können und musste es teilweise wiedererlernen. Da es keine praxisorientierte Übungsliteratur für diesen Fall gab, habe ich mir mit Unterstützung meiner Therapeuten und Ärzte über fünf Jahre ein Konzept erarbeitet und danach geübt. Heute kann ich wieder laufen und freue mich über die wiedergewonnene Selbstständigkeit und die Möglichkeiten, die sich mir nun bieten. Mein Wissen will ich medizinischem Fachpersonal und insbesondere anderen Betroffenen mit diesem Buch zur Verfügung stellen, damit auch sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten wieder an Lebensqualität gewinnen. Die "Gangschule" ist in zwei Teile gegliedert: Band1: Theorie und Übungen zum Gehen in der ebenen Fläche Band2: Theorie und Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens, zum Automatisieren und zum Gang auf unebener Fläche/Treppe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis
Die Gangschule besteht aus zwei Bänden.
Teil 1:
Theorie und Übungen zum Gehen in der ebenen Fläche
In diesem Teil wird der klassische Vorgang des korrekten Gehens in der Ebene beschrieben und geübt.
Band 2
Theorie und Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens, zum Automatisieren und zum Gang auf unebener Fläche/Treppe
In diesem Teil wird das Gehen in der ebenen Fläche automatisiert. Die Begleitbewegungen des Gehens (Pendeln der Arme während des Gehens) werden beschrieben und geübt. Weiterhin wird das Gehen in der unebenen Fläche, z.B. in schräger Fläche (Abhang/Berg/Hügel) oder Treppe erläutert. Hierzu folgen viele Übungen.
Hinweise:
Die Informationen und Übungen in diesem Buch dürfen in keinem Fall als ein Ersatz für die individuelle ärztliche Beratung und die professionelle, auf den Einzelfall bezogene Physiotherapie gesehen werden. Obwohl die Übungen in diesem Buch langjährig erprobt sind und von der Autorin und dem Verlag sorgfältig geprüft wurden, kann keine Garantie übernommen werden. Jegliche Haftung der Autorin und des Verlages und seiner Beauftragten für Gesundheitsschäden und/oder Personenschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für Nichteintritt des Erfolges.
Übersicht über die Symbole der Trainingsarten
(zum Herausschneiden)
Bei allen Übungen beachten:
In der Anstrengungsphase erfolgt die Ausatmung. Die Einatmung erfolgt in der Ruhephase bzw. in einer weniger anstrengenden Phase der Übung.
Dynamische Übung
Empfohlene Belastungsdosierung: 2 x 5-10 (Sätze x Anzahl der Wiederholungen)
Statische Übung
Empfohlene Belastungsdosierung: 2-5 x 5-10 Sekunden
Sensomotorische Übung
Empfohlene Belastungsdosierung: 1-7 Wiederholungen
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Empfohlene Belastungsdosierung: 1-7 Wiederholungen
Übung zur Konstanz der Bewegungsausführung
Empfohlene Belastungsdosierung: 2-3 x 15-25 (Sätze x Wiederholungen)
Muskeltraining mit dem Ziel größtmöglicher Ausdauer
Empfohlene Belastungsdosierung für Anfänger: 1-2 x 10-20 (Sätze x Wiederholungen)
Empfohlene Belastungsdosierung für Fortgeschrittene: 2-3 x 10-20 (Sätze x Wiederholungen)
Muskeltraining mit dem Ziel größtmöglicherKraft
Empfohlene Belastungsdosierung für Anfänger:
1 x 8-12 (Sätze x Wiederholungen)
Empfohlene Belastungsdosierung für Fortgeschrittene:
2 x 8-12 (Sätze x Wiederholungen)
Dehnung
Empfohlene Belastungsdosierung: 3-5 x 8-10 Sekunden
Ausdauerbelastung des Herz-/Kreislaufsystems Empfohlene Belastungsdosierung:
z.B. 20 Minuten Ausdauerbelastung, dazwischen eine Pause von 2-4 Minuten
Hinweis: Sehr individuelle Anpassung an die körperliche Belastbarkeit nötig. Begleiterkrankungen, die sich auf die Ausdauerbelastung auswirken, müssen beachtet werden.
Übungen zur Bewegungsqualität/-sicherheit bei erhöhter Geschwindigkeit oder unter erschwerten Bedingungen
Empfohlene Belastungsdosierung: Sehr individuell anzupassen
Alltagsfreundliche Übung
Manche Übungen wiederum können ohne Material und ohne Auf- und Abwärmen problemlos in den Alltag zwischendurch integriert werden (z.B. beim Warten auf den Bus). Diese Übungen sind im Buch mit einem Smiley gekennzeichnet.
Inhaltsverzeichnis:
Band 1
A-B Geleitworte
A Prof. Dr. Grau (Direktor der neurologischen Klinik Ludwigshafen)
B Frau Kathani, Herr Ruhstorfer (Physiotherapeuten)..
0. Einleitung
Oder
„Aller Anfang ist schwer!“
1. Physiologisches Gangbild
Oder
„Wie läuft man entspannt, kraftsparend und gesund?“
1.1. Gemeinsamer Stand
1.2 Standbeinphase
1.3. Spielbeinphase
1.4 Physiologisches Gehen am Rollator
2. Typische und häufige Störungen bei Ataxie
Oder
„Bewegen ist nicht gleich Bewegen.“
2.1 Typische und häufige Störungen bei Ataxie
2.2 Ganganalyse mittels Schuhsohle Oder „Was uns unsere abgelaufenen Lieblingsschuhe erzählen“
3. Allgemeines zur Durchführung von krankengymnastischen Übungen sowie der Gangschule im Besonderen
Oder
„Lernen zu Lernen“
3.1. Kenntnis der physiologischen Vorgänge, Kenntnis der Pathologie, Körperwahrnehmung
3.2. Lerntheorien kennen/Kenntnis des motorischen Lernens und der Automatisierung
3.3. Zielfestlegung (Zwischenziele/Endziele)
3.4. Geeignete Übungen kennen, verstehen und selbständig ausführen können
3.5. Organisation des Trainings
3.6. Regelmäßiges Üben (Trainingsarten und Belastungsdosierung)
3.7. Integration der Übungen in den Alltag
3.8. Erfolgskontrolle
Anlage 1 Krankengymnastisches Ablaufschema
Anlage 2 Standardisierte Tests
4. Übungen
Oder
„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“
4.1. Sensomotrisches Training
4.1.1 Propriozeptives Training
4.1.2 Posturale Balance
4.1.3 Dynamische Balance
4.1.4 Gleichgewichtskontrolle/Autostabilisation
4.2. Verbesserung der Bewegungssteuerung und - regelung/Bewegungskoordination
4.2.1 Koordination der oberen Extremitäten
4.2.2 Koordination der unteren Extremitäten
4.2.3 Zeitgleiche Koordination von oberen und unteren Extremitäten
4.2.4 Koordination der Augenbewegungen
4.3. Gangschule i.e.S. bezogen auf ebene Flächen
4.3.1 Stand
4.3.2 Spurbreite
4.3.3 Gangtempo
4.3.4 Schrittlänge
4.3.5 Abrollphase
4.3.6 Training Rumpfmuskulatur
4.3.7 Training Beinmuskulatur
4.3.8 Training Kniemuskulatur
4.3.9 Training Fußmuskulatur
4.3.10 Übungen zum kompletten Gangzyklus
Band 2
5. Begleitbewegungen des Gehens
Oder
„Was mache ich mit meinen Armen während des Gehens?“
5.1. Funktion/Zweck der Begleitbewegungen
5.2. Physiologischer Ablauf der Begleitbewegungen
5.3. Pathologische Begleitbewegungen
5.4. Übungen zu den Begleitbewegungen
5.5. Integrieren der Begleitbewegungen in den Gang
6. Automatisieren der erlernten Bewegungen durch Bewegungsqualität, Bewegungssicherheit, Bewegungsvielfalt, Bewegungsschnelligkeit
Oder
„Das kann ich im Schlaf!“
6.1. Bewegungsqualität
6.2. Bewegungssicherheit
6.3. Bewegungsvielfalt
6.4. Bewegungsschnelligkeit
7. Gang auf unebener Fläche
Oder
„Die Königsdisziplin der Ataktiker“.
7.1 Physiologisches Gehen auf unebener Fläche sowie krankheitsbedingte Abweichungen
7.1.1 Einführung
7.1.2 Gehen in der schrägen Fläche
7.1.3 Treppenkonstruktion und „Goldener Schnitt“ einer bequemen und sicheren Treppe
7.1.4 Treppe aufwärts
7.1.5 Treppe abwärts
7.1.6 Unphysiologisches (=krankheitsbedingtes) Treppensteigen
7.2 Übungen zum Gehen auf unebener Fläche
7.2.1 Gehen mit oftmaligen Richtungswechseln, auf verschiedenen Untergründen kombiniert mit Hindernissen
7.2.2 Übungen zum Treppensteigen
8. Auf- und Abwärmübungen
9. Glossar
10. Literaturverzeichnis
11. Schlusswort Oder „Ende gut – Alles gut?“
Kapitel 5:
Begleitbewegungen des Gehens Oder „Was mache ich mit meinen Armen während des Gehens?“
Beobachtet man das Gangbild eines gesunden Menschen, so sieht man, dass dieser beim Gehen seine Arme rhythmisch mitschwingt. Der Zweck und die Physiologie der Begleitbewegungen des Gehens werden hier als erstes dargestellt. Sodann werden krankhafte (=pathologische) Abweichungen hiervon beschrieben sowie krankengymnastische Übungen vorgestellt.
5.1 Funktion/Zweck der Begleitbewegungen
Die Arme sind das Gewicht des Körpers, welches am besten reagieren kann. Durch die Gehbewegung des Beckens und der Beine entsteht ein Ungleichgewicht zwischen rechts und links und zwischen vorne und hinten. Das zwingt die Arme, die entsprechende Gleichgewichtsreaktion auszuführen, die bei normaler Spurbreite, optimaler, individueller Schrittlänge und idealem Gangtempo von ca. 120 Schritten pro Minute am deutlichsten in Erscheinung treten. Bei diesem Tempo stellt sich das Pendeln der Arme automatisch ein. Geht man deutlich langsamer als 120 Schritte pro Minute pendeln die Arme normalerweise nicht mit.
An diesen Ausführungen sieht man bereits, dass eine gute und harmonische (=physiologische) Beinarbeit beim Gehen Voraussetzung für die Begleitbewegungen der Arme sind. Deshalb wurde auch zuerst ausschließlich das korrekte Gangbild hinsichtlich der Beine trainiert und die Arme außen vor gelassen.
Gangtypische Bewegungen bringen das Gewicht der Arme und des Schultergürtels nach vorne in die Bewegungsrichtung. Sie sorgen somit für zusätzlichen Schwung nach vorne und geben dem Körper Schwung. Das Gehen wird somit leichter, energieärmer und ökonomischer.
5.2 Physiologischer Ablauf der Begleitbewegungen
Bild 5.2.1:
Ausgangsstellung:
Beine / Stand: hüftbreit, Wirbelsäule aufgerichtet, Blick geradeaus
Arme : seitlich am Körper
Bild 5.2.2: Bewegungsablauf
Rechtes Bein vor (= Standbein)
Linker Arm vor (= Spielarm, wird manchmal auch Schwungarm genannt) und gleichzeitig Linkes Bein hinten (= Spielbein) Rechter Arm hinten (= Standarm)
Bild 5.2.3: Wechsel von Stand- und Spielbein, Stand- und Spielarm
Danach wird im Wechsel das Spielbein zum Standbein und der Spielarm zum Standarm.
Also:
Linkes Bein vor (= Standbein)
Rechter Arm vor (= Spielarm)
und gleichzeitig
Rechtes Bein hinten (= Spielbein)
Linker Arm hinten (= Standarm)
Ganz wichtig ist es zu wissen, dass die Arme und Beine hierbei immer in der Diagonale bewegt werden!
Anmerkung zu den verwendeten Begriffen:
Aus Kapitel 1 (Physiologisches Gangbild) sind uns die Begriffe Spielbein und Standbein bekannt. Diese werden analog auch für die Arme (=Spielarm und Standarm) benutzt.
5.3 Pathologische Begleitbewegungen
Häufig vorkommende Auffälligkeiten bei Ataktikern sind folgende:
Fehlende Begleitbewegungen, meist verursacht durch einen zu langsamen Gang.
Falsche Ausgangsstellung, z.B. zu breiter Stand; hierdurch sind die Arme daran gehindert, frei nach vorne zu schwingen.
Passgang (= Gleichzeitiges Bewegen von rechtem/linkem Bein und rechtem/linkem Arm), es findet keine Arbeit in der Diagonale statt (siehe hierzu
Bild 5.3.1
und
Bild 5.3.2
).
Bild 5.3.1 und Bild 5.3.2:
5.4 Übungen zu den Begleitbewegungen
Die Übungen aus Kapitel 4.2.1 (Koordination der oberen Extremitäten) sind Vorrausetzung für dieses Kapitel und sollten mit den nun folgenden Übungen kombiniert werden.
Im Folgenden werden Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens vorgestellt. Diese sind in zwei Gruppen unterteilt:
Koordinative Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens
Muskuläre Übungen für den Schulter-/Nackenbereich
Es werden hier Muskuläre Übungen vorgestellt, da meistens die Kraft im Schulter-/Nackenbereich abgebaut wurde, infolge der mangelhaften bzw. fehlenden Begleitbewegungen.
Hier die Übungen im Einzelnen:
a) Koordinative Übungen zu den Begleitbewegungen des Gehens:
b) Muskuläre Übungen für den Schulter-/Nackenbereich:
Übung Nr.1: Gehen im Sitzen
Zweck: Vorübung für die Begleitbewegungen des Gehens
Dynamische Übung
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Übung zur Konstanz der Bewegungsausführung
Sensomotorische Übung
Alltagsfreundliche Übung
Eigene Belastungsdosierung: _______________________
Ausgangsstellung:
Gerader Sitz auf dem Stuhl, Sitz nur auf dem vorderen Drittel des Stuhles
Bild 5.4.1: Durchführung:
Spielbein- und Spielarm jeweils 90° im Gelenk beugen, im Wechsel möglichst rhythmisch bewegen (ggf. mit Musik oder Metronom üben; Idealerweise Musik im Tempo von ca. 120 Schlägen pro Minute wählen, denn dies entspricht dem physiologischen Gangtempo, → siehe Glossar und Band 1, Kapitel 4.3.3 Gangtempo).
Übungsvarianten für Fortgeschrittene:
Variante 1:
Bild 5.4.2:
Übung im Stehen mit Unterstützung der Wand durchführen
Variante 2:
Bild 5.4.3:
Übung auf dem Pezzi-Ball durchführen
Übung Nr.2: Armschwung
Zweck:
Wahrnehmung der Armbewegungen, Lockerung und Kräftigung der Schultermuskulatur, Gleichgewichtstraining, auch als Aufwärmübung geeignet.
Dynamische Übung
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Übung zur Konstanz der Bewegungsausführung
Ausdauerbelastung des Herz-/Kreislaufsystems
Alltagsfreundliche Übung
Eigene Belastungsdosierung: _______________________
Ausgangsstellung: gerader, aufgerichteter, hüftbreiter Stand Bild 5.4.4 und 5.4.5:
Durchführung:
Arme vor und zurück schwingen
Variante 1 (einfachere Variante):
Zuerst im Sitzen üben!
Variante 2 (für Fortgeschrittene):
Bild 5.4.6:
Übung im Zehenstand ausführen; beim Armschwung nach vorne in den Zehenstand gehen
Bild 5.4.7:
Beim Rückschwung Füße aufsetzen
Übung Nr.3: Arme diagonal schwingen
Zweck: Wahrnehmung der Armbewegungen und Kräftigung der Schultermuskulatur, Koordination der Armbewegungen, Vorübung für die Begleitbewegungen, auch als Aufwärmübung geeignet
Dynamische Übung
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Übung zur Konstanz der Bewegungsausführung
Ausdauerbelastung des Herz-/Kreislaufsystems
Alltagsfreundliche Übung
Eigene Belastungsdosierung: _______________________
Ausgangsstellung: gerader, aufgerichteter, hüftbreiter Stand
Bilder 5.4.8 und 5.4.9:
Durchführung:
Arme diagonal schwingen
Variante 1 (einfachere Variante):
Zuerst im Sitzen üben!
Variante 2 (für Fortgeschrittene):
Bild 5.4.10 und 5.4.11:
Übung im Zehenstand ausführen!
Dabei darauf achten in der Diagonale zu arbeiten!
Bild 5.4.12:Fehlerbild!
So bitte nicht üben!
Fehler: Abknicken in der Hüfte, Wirbelsäule ist nicht mehr aufgerichtet (gerade), der Stand wird instabil.
Übung Nr. 4: Hüft- und Armschwung
Zweck: Koordination, Körperwahrnehmung für das Zusammenspiel der oberen und unteren Extremitäten, Lockerung der Wirbelsäule und des Schulterbereiches, auch als Schwindeltraining geeignet
Dynamische Übung
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Sensomotorische Übung
Alltagsfreundliche Übung
Eigene Belastungsdosierung: _______________________
Ausgangsstellung: Stand
Bilder 5.4.13 und 5.4.14:
Durchführung:
Rechter Arm und rechte Hüfte nach vorne schwingen, dabei im Schwung ganz leicht in die Hocke gehen, anschließend linken Arm und linke Hüfte schwingen
Hinweis:
Übung wechselseitig ausführen!
Übung Nr.5: „Guten Tag Herr Müller!“- „Guten Tag Herr Meyer!“ (Mini-Übung für die Wirbelsäule 1)
Dynamische Übung
Übung zur Bewegungspräzision, Koordination, Gleichgewicht
Dehnung
Alltagsfreundliche Übung
Eigene Belastungsdosierung: _______________________
Ausgangsstellung:
Kopf mittig, Wirbelsäule und Kopf aufgerichtet