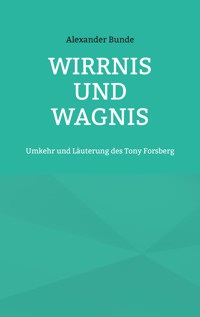Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Andreas, der Held dieses Buches, ist jung, ehrgeizig und scheut keine Herausforderung, nach oben zu kommen. Er spielt hervorragend Tennis und ist eine Stütze seines Clubs. Frauen kreuzen seine Wege, aber eigentlich liebt er Julia, eine junge Studentin, doch nach einem Missverständnis kommt es zum Bruch. Nach einer schicksalhaften Begegnung mit einer attraktiven Barsängerin schwelgt er im siebten Himmel. In dieser Phase des Glücks und des Erfolgs entdeckt er durch Zufall, dass er von ihr getäuscht und zum Schmuggel von Rauschgift missbraucht wurde. Es kommt zu einem Kampf mit Dealern, bei dem er lebensgefährlich verletzt wird. Noch nicht genesen, macht er einen Versuch, seine große Liebe Julia wiederzusehen, doch diese weist ihn zurück. Werden die beiden wieder zueinander finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlung und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Immer häufiger dachte ich darüber nach, ob für mich nicht die Zeit gekommen war, mit einer Frau eine feste Bindung einzugehen, mit einem Wort, das Ja-Wort zu geben. Möglichkeiten hatte ich gehabt, aber ich war noch nicht reif gewesen, ich wollte meine Unabhängigkeit nicht aufgeben.
Als das Telefon läutete, wurde ich aus meinen Gedanken gerissen. Ich warf einen Blick auf meinen PC, alles war unter Kontrolle, musste auch so sein, denn es war Freitag und alle LKWs waren offensichtlich rückgeladen worden und auf dem Weg in die Heimat. Seit drei Jahren arbeitete ich in einer der größten Spedition Wiens und war für den LKW-Frachtverkehr in die frankophonen Länder, also Belgien und Frankreich verantwortlich. In diesem Job stand man immer unter Hochspannung, auf der Straße konnte viel passieren, dann wurde die Planung über den Haufen geworfen, man musste improvisieren.
Meine innere Stimme verhieß nichts Gutes als ich abhob. Ich täuschte mich nicht, einer meiner LKW-Fahrer suchte verzweifelt aufgrund einer Fehlfunktion seines Navigationssystems die Ladestelle für die Rückfracht, die dringend in einem Kunststoffwerk benötigt wurde. Wenn er nicht laden konnte, kam das einer Katastrophe gleich, denn eine Leerfahrt zurück nach Österreich würde teuer kommen, abgesehen von den Problemen mit dem Kunden, der ohne Material einen Produktionsstillstand hätte. Also rief ich den Lieferanten in Paris an, um eine Wegbeschreibung zu bekommen, die ich dem genervten Fahrer weitergeben konnte. Plötzlich platzte mein Chef ins Büro, misstrauisch, mit vorwurfsvoller Miene verfolgte er meine Bemühungen.
„Sie warten so lange, bis der Fahrer an der Ladestelle eingetroffen ist“, sagte er bissig, „das nächste Mal statten Sie Ihre Fahrer mit genauen Informationen aus.“
Ich wollte schon eine patzige Antwort geben, als ich aber in sein fleischiges, vom Zorn gerötetes Gesicht blickte, verzichtete ich darauf. In dieser Situation hätte es mir nichts genützt, die Unerfahrenheit des Fahrers ins Treffen zu führen, der zum ersten Mal eine Ladung in Frankreich übernahm und nicht einmal Ja und Nein auf Französisch sagen konnte. Ich wartete also, bis der Fahrer mir die Übernahme der Ware bestätigte.
Spät verließ ich das Büro, es dämmerte bereits. Es machte keinen Sinn mehr, in meinen Tennisclub zu fahren, um für das morgige Meisterschaftsspiel zu trainieren. Das Training wäre wichtig gewesen, da ich das erste Mal in der Kampfmannschaft antreten sollte.
Am nächsten Tag spielten meine Nerven verrückt, je mehr ich mich bemühte, mich zu entspannen, desto mehr entglitten sie meiner Kontrolle. Ich fragte mich, warum ich mir diesen Stress eigentlich antat. Tennis sollte ursprünglich ein Ausgleichssport für mich sein. Aber ich war kurzfristig in die Kampfmannschaft aufgenommen worden, weil der vor mir gereihte Kollege verletzt war. Ich verfluchte die Verkehrsampeln. Bei jeder Rotphase sah ich ebenfalls rot, um dann bei Grün mit meinem Golf davon zu spurten.
Der Tennisclub zählte zu den ältesten und renommiertesten der Stadt. Die Courts lagen am Rande einer Parkanlage und waren von uralten Kastanienbäumen gesäumt. Der Club leistete sich den Luxus eines Restaurants, manches Mal wurde dort Schach oder Karten gespielt, auch so manches Geschäft hatte dort seinen Anfang gefunden. Gegen das gepflegte Restaurant fielen jedoch die Umkleidekabinen stark ab. Durch die kleinen Fenster fiel nur spärliches Licht, die Wände waren von Feuchtigkeitsflecken und abgeblättertem Verputz verunstaltet, die auf den Spinden abgestellten Tennisschuhe verströmten den spezifischen Geruch von Fußschweiß.
Es war heiß und schwül an jenem denkwürdigen Tag. Von meinen Kameraden konnte ich noch keinen erblicken. Ich begab mich in die Umkleidekabine, um mich umzuziehen. Meine Bewegungen waren hastig, fahrig. Wie sollte ich in einem solchen Zustand präzise Bälle schlagen? Als ich mein Rakett aus der Plastikhülle entnahm, fühlte es sich wie ein Fremdkörper in meiner schweißigen Hand an. Bilder einer bevorstehenden Niederlage tauchten vor mir auf. Als mein Freund Felix Schönlaub bei der Tür hereinkam, ein breites Grinsen auf seinem jungenhaften Gesicht, atmete ich erleichtert auf.
„Du bist ein bisschen blass, Andreas, ist alles okay?“
„Nicht ganz, ich wollte gestern noch trainieren, aber ich bin nicht rechtzeitig vom Büro weggekommen. Ich bin froh, dass wir uns jetzt ein bisschen einschlagen können.“
Ich wollte ihm beichten, dass meine Nerven verrücktspielten, unterließ es aber. Obwohl wir viele Vertraulichkeiten austauschten, genierte ich mich, eine Schwäche zu zeigen.
„Das kann nicht schaden, wird eine harte Partie heute“, sagte er lakonisch, während er in sein Tennisdress schlüpfte.
Im Gegensatz zu mir, der ich groß und schlaksig war, hatte Felix einen stämmigen, muskulösen Körper. Seine freundlichen Gesichtszüge, die Grübchen in den Wangen sowie die leicht schräg gestellten braunen Augen gaben seinem Gesicht einen schalkhaften Ausdruck.
„Die Mannschaftsbesprechung ist um zwölf Uhr, wir haben genug Zeit, um uns einzuschlagen“, sagte er, als er umgezogen war. Felix warf mir einen prüfenden Blick zu. „Du scheinst ein bisschen nervös zu sein, alter Freund. Du wirst sehen, nach den ersten Ballwechseln baut sich die Nervosität ab, man wird ruhiger. Und vergiss nicht, deinem Gegner geht es nicht besser, eine gewisse Anspannung ist immer da, das lässt sich nicht vermeiden.“
Ich warf ihm einen dankbaren Blick zu. Ein guter Freund merkt, was in einem vorgeht, selbst wenn man es verheimlichen will, dachte ich.
Wir starteten unser Training. Zuerst wechselten wir lange Bälle, entlang der Linie und cross, dann gingen wir abwechselnd zum Netz, um zu vollieren. Nach und nach probierten wir verschiedene Schlagvarianten, zum Schluss spielten wir ein paar Games. Normalerweise war ich, bedingt durch meine Körpergröße, ein guter Aufschläger. Aber an diesem Tag funktionierte der Aufschlag nicht, wieder stieg eine leichte Beunruhigung in mir auf.
„Mach noch ein paar Aufschläge“, empfahl Felix. Ich sammelte die umliegenden Bälle auf und versuchte mein Bestes. Nach einigen Minuten machten wir Schluss. „Wir werden unsere Kräfte heute noch brauchen“, bemerkte Felix.
Wir trockneten uns den Schweiß ab, zogen unsere Pullover über und schlenderten ins Restaurant, wo ein langer Tisch in einer ruhigen Ecke für die Besprechung reserviert war.
Bernd Wächter, unser Kapitän, und die meisten Mannschaftsspieler waren bereits anwesend. Einige schlugen sich noch ein, aber nach und nach waren wir komplett. Man merkte die Anspannung, die von den meisten Besitz ergriffen hatte, ich war also keine Ausnahme.
Wächter fixierte mich mit seinen kalten, stahlblauen Augen. „Wie geht’s Andreas?“
„Ich muss mich erst daran gewöhnen, mit der Verantwortung umzugehen“, sagte ich.
„Das erste Mal ist immer schwierig, versuch dein Bestes und denk nicht an Sieg oder Niederlage, das macht nur zusätzlichen Druck.“
Ich hatte schon unzählige Tennismatches hinter mir. Aber das waren freundschaftliche Partien. Nur wenn ich um einen Ranglistenplatz kämpfte, ging es um etwas. Wenn ich gewann, konnte ich mein Ranking um einen Platz verbessern, wenn ich verlor, rutschte ich um einen Platz ab. Aber ob ich gewann oder verlor, nutzte oder schadete nur mir. Doch an diesem Tag trug ich eine Mitverantwortung für die Mannschaft, ob sie ins Finale aufstieg oder nicht.
Soweit Wächter die gegnerischen Spieler kannte, gab er uns Informationen über deren Stärken und Schwächen.
Er strich seine emporstehenden Haare zurück und blickte mich nachdenklich an. Seine dichten dunkelblonden Haare waren charakteristisch für sein Aussehen. Er hatte sie zurückgekämmt, trotzdem standen sie in hohem Bogen weit nach hinten ab. Sein Haarschopf und die scharfe Adlernase gaben ihm ein kühnes Aussehen.
„Ich kenne den Typen, gegen den du spielen wirst“, sagte er gedehnt. „Er heißt Ingo Lindenthal und hat schon viele Meisterschaftsspiele absolviert, die meisten hat er gewonnen. Er ist schnell auf den Beinen und macht seine Punkte von der Grundlinie. Wenn man ihn nicht unter Druck setzt, macht er wenig Eigenfehler. Ich glaube, von hinten ist es schwer, gegen ihn zu gewinnen. Eine Chance hast du, wenn du etwas riskierst und versuchst, ihn auszuvollieren. Das müsste dir ja liegen, denn es entspricht deiner Spielanlage.“
„Ich werde es versuchen“, sagte ich, aber es klang nicht überzeugend.
Die gegnerische Mannschaft hatte sich ebenfalls im Restaurant versammelt. Wächter tauschte mit dem Mannschaftsführer die Spielerlisten aus und besprach die Abfolge der Matches. Ich versuchte herauszubekommen, wer mein Gegner sein könnte. Zufällig fiel sein Name, als er von einem seiner Clubkollegen angesprochen wurde. Er war Anfang dreißig und hatte einen merkwürdigen, spitzen Haaransatz in der Mitte der Stirn. Die schmalen, braunen Augen waren leicht nach oben gezogen, wie auch seine dunklen Brauen. Die Nase war leicht geschwungen, sein Gesicht wurde nach unten schmaler und ließ das Kinn spitz wirken. Er wirkte entspannt, sein athletischer Körperbau und die sehnigen Arme waren beeindruckend und ließen darauf schließen, dass er viel Zeit auf dem Tenniscourt verbrachte.
Mein Start war nach den ersten drei Partien eingeplant. Ich verließ den Club, um mich bei einem Spaziergang etwas auszugleichen. Die Wolken hingen tief, es war schwül, wenn Regen fiel, müsste der Wettkampf verschoben werden. Ich hoffte, dass es trocken blieb, denn ich hatte mich darauf eingestellt, an diesem Tag meine Feuertaufe zu bestehen. Ich konzentrierte mich auf meine Schritte und versuchte, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Nachdem ich einige Minuten die Allee hinuntergewandert war, fühlte ich, wie sich mein Gedankenfluss beruhigte. In meinem Geist spielte ich Spielvarianten durch, welche bei einer defensiven Spielweise des Gegners zum Erfolg führen könnten. Ein Blick auf meine Uhr gemahnte mich, in den Club zurückzukehren, um mich auf mein Spiel vorzubereiten.
Im Club klopften mir meine Kameraden aufmunternd auf die Schulter. Von den ersten drei Einzelpartien hatten wir zwei verloren und eine gewonnen. Ich brauchte nicht lange auf meinen Gegner zu warten. Ich sah ihn, wie er sich mit ruhigen, elastischen Schritten näherte, den Kopf erhoben, selbstsicher, jedoch ohne Stolz und Arroganz. Ein verhaltenes Lächeln spielte um seinen Mund, als er den Schiedsrichter begrüßte. Dann schüttelten wir uns die Hände. Besorgt blickte er zum Himmel und sagte: „Hoffentlich müssen wir nicht wegen Regen abbrechen!“ Er hatte eine leise, dunkle Stimme.
„Wir werden ja sehen“, sagte ich reserviert. Ich hatte keine Lust, mich vor dem Match mit einem Small Talk von meinem Gegner ablenken zu lassen, zu sehr war ich auf das Spiel fokussiert. Dessen ungeachtet und gegen meinen Willen musste ich eingestehen, dass er sympathisch war. Aber er war mein Gegner, es ging um viel, ich bemühte mich daher, ein Feindbild aufzubauen.
Wir losten und ich gewann. Ich entschied mich für Aufschlag, somit hatte Lindenthal die Platzwahl. Nachdem die Sonne fast senkrecht stand, war dies kein Vorteil für ihn. Wir begannen mit dem Einschlagen. Ich versuchte, meinen Bällen einen kräftigen Spin zu geben, um seine Reaktion zu testen. Er schien sehr früh die Flugrichtung sowie die Landung des Balles zu erkennen, war rechtzeitig zur Stelle und hatte überhaupt keine Probleme, die Bälle zu retournieren, wobei man seinen Bewegungen keine Hektik ansah. Ich werde also einen Gang zulegen müssen, dachte ich mir. Mittlerweile hatten die Zuschauer auf den Bänken neben dem Court Platz genommen, manche standen hinter dem Gitterzaun. Nachdem wir Volleys und Schmetterbälle gespielt hatten, forderte uns der Schiedsrichter auf zu beginnen.
Ich spielte aggressiv und risikoreich, aber ich hatte Glück, die meisten meiner Bälle waren gut, wenn auch manchmal knapp an der Linie. Der eine oder andere Ball von mir war sicherlich strittig gewesen, doch Lindenthal verzichtete darauf zu reklamieren. Er blieb gelassen, selbst als ich ihm bei 4:3 seinen Aufschlag abnahm und mit 5:3 in Führung ging, blieb er gefasst. Ich servierte den ersten Satz zum 6:3 aus und war erleichtert, einen wichtigen Schritt in Richtung Sieg getan zu haben. Es erstaunte mich die Gemütsruhe, mit der mein Gegner den Satzverlust entgegennahm, nur ein paar Falten auf seiner Stirn zeugten davon, dass er intensiv nachdachte.
Im zweiten Satz setzte ich mein druckvolles Spiel fort, nahm ihm sein Aufschlaggame ab und brachte mein Service sicher zu einer 2:0-Führung durch. Doch dann riss der Faden, mein risikobetontes Spiel wurde ungenau, die Fehler häuften sich. Aber vielleicht hätte ich das Spiel noch ausgewogen gestalten können. Doch plötzlich schnitt Lindenthal sein Service derart geschickt an, dass ich weit aus der Platzmitte getrieben wurde und nur mit Mühe retournieren konnte, wobei er mir dann den Ball longline oder cross, unerreichbar für mich, um die Ohren schoss. Während ich am Platz hin und her hetzte, meine Lungen heftig zu pumpen begannen, verteilte Lindenthal souverän die Bälle und hielt mich am Laufen.
Als ich einmal versuchte, einen fast unerreichbaren Ball zu erwischen, stolperte ich und fiel hin. Mein verschwitztes Leibchen wurde vom roten Sand imprägniert, meine rechte Wade war aufgeschunden und blutete. Langsam begann ich, gegen diese gut funktionierende Tennismaschine Groll zu entwickeln. Ich versuchte, einen Zahn zuzulegen und feuerte Aufschläge über das Netz, doch auch dagegen hatte er ein Rezept parat. Er ging früh in den Ball, retournierte hart und erwischte mich beim Vorstürmen zum Netz im Halfcourt. Ich musste schwierige und tiefe Volleys spielen, die ich oft verschlug, oder noch schlimmer, ein unerreichbarer Ball passierte mich. Nach jedem gelungenen Ball applaudierten seine Anhänger. Lindenthal blieb davon unberührt, emotionslos, aber umso effizienter setzte er sein erfolgreiches Spiel fort und gewann den zweiten Satz 6:2.
In der kurzen Pause zum dritten Satz wechselte ich mein verschmutztes Leibchen und schüttete Wasser aus meiner Trinkflasche über die Schürfwunde. Die verbleibenden feinen Sandpartikel konnten unangenehme Entzündungen hervorrufen, aber das bewegte mich nicht. Ich überlegte vielmehr, ob ich weiter nach vorne stürmen oder auf Ball halten spielen sollte. Nachdem Lindenthal ballsicher war, musste ich annehmen, dass er mich eher zu einem Fehler zwingen würde als umgekehrt. Aber was blieb mir anderes übrig als zu versuchen, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Auf mein Aufschlag-Volley-Spiel hatte er sich derart gut eingestellt, dass ich keine Chancen sah, damit etwas zu erreichen. Auch Wächter, der das Spiel beobachtete, riet mir, den Druck aus meinem Spiel zu nehmen.
„Lock ihn mit Stopps nach vorne, versuche, ihn zu passieren. Variiere, spiele ab und zu einen Slice, platziere deine Bälle und gehe erst dann nach vorne, wenn er in der Defensive ist. Das Aufschlag-Volley-Spiel kannst du dir abschminken, darauf hat er sich eingestellt.“
Im dritten, entscheidenden Satz unternahm Lindenthal nicht viel. Er schien die Veränderung meiner Taktik zu studieren, spielte platzierte Bälle, um durch einen Positionsvorteil Winner zu landen. Sicherlich vertraute er auf seine Ballsicherheit, er erwartete, von meinen Fehlern zu profitieren. Es entwickelten sich lange Ballwechsel, wobei er leichte Vorteile hatte, doch auch ich gewann an Ballsicherheit. Ich fühlte, wie ich mit meinem Schläger buchstäblich verschmolz, er fühlte sich an, als ob er ein Teil von mir, als ob ich mit ihm verwachsen wäre. Ich hatte keine Zeit, mich darüber zu wundern, dennoch gab es mir Vertrauen.
Ich hatte zwar Mühe gegen Lindenthal, von dem die meisten meiner Bälle wie von einer Mauer abprallten, das Spiel offen zu halten, doch es gelang. Beim Stand von 5:5 warf ich ihm einen Blick zu und stellte fest, dass er nun auch Nerven zeigte, sein Gesicht hatte einen verbissenen Ausdruck bekommen. Er versuchte nun härter zu servieren, verschlug aber die meisten seiner ersten Bälle. Seine zweiten Aufschläge waren kein Problem für mich. Ich versuchte nach meinen platzierten Returns ans Netz zu gelangen, um einen guten Volley zu spielen. In diesem Game machte Lindenthal keinen einzigen Punkt. Ich schlug nun auf den Matchgewinn auf und fühlte mich stark. Mein Schläger und ich waren eine Einheit, mein Service trieb Lindenthal weit hinter die Grundlinie zurück. In der Defensive waren seine Returns schwach, ich hatte keine Probleme, seine Bälle am Netz zu erwarten, um sie mit einem harten Volley zu vernichten. Der Sieg war mir nicht mehr zu nehmen.
Für die meisten Verlierer ist dem Gewinner zu gratulieren nur eine flüchtige Geste, nicht so Lindenthal, er blickte mir in die Augen und drückte mir fest die Hand.
„Du hast super gespielt. Ich habe alles versucht, aber es hat nicht gereicht“, sagte er neidlos.
„Ich habe viel riskiert und es ist alles gegangen. Es war viel Glück dabei“, sagte ich abschwächend. Es stimmte ja, im ersten Satz hatte ich das Spielglück auf meiner Seite.
Lindenthal lächelte wehmütig. „Gib Acht, dass sich deine Schürfwunde nicht infiziert, der Ziegelstaub ist ein Teufel.“
Wir bedankten uns beim Schiedsrichter und verließen den Platz. Es war eine Genugtuung gegen diesen starken Gegner gesiegt zu haben, aber die Fairness von Lindenthal verdiente meine Achtung, ich hatte nicht die mindesten Triumphgefühle. Nun war ich neugierig, wie meine Clubkameraden spielten, vor allem Felix. Er hatte sein Match ebenfalls beendet. Es war ein glatter Zweisatzsieg für ihn gewesen. Fünf Einzelpartien waren nun gespielt und es stand 3:2 für uns.
„Komm, schauen wir, wie es bei Michael läuft“, schlug Felix vor. Aber es stand nicht gut. Er hatte den ersten Satz glatt verloren und auch im zweiten war er schon im Rückstand. Neben uns stand eine junge Frau, die uns anerkennende Blicke zuwarf. Als ich meinen Kopf in ihre Richtung wendete, lächelte sie.
„Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Sieg“, sagte sie.
„Danke, war viel Glück dabei.“ Ich musterte sie etwas näher. Sie hatte eine sportliche Statur und wirkte selbstbewusst. Ihre dichten, dunklen Haare waren kurz geschnitten, sorgsam gekämmt und hatten einen seidigen Glanz. Die Lippen waren grellrot geschminkt, sie trug ein buntes Sommerkleid mit einem breiten, weißen Gürtel.
„Sie sollten Ihre Schürfwunde gut reinigen. Sind Sie gegen Wundstarrkrampf geimpft?“
„Wegen einer solchen Kleinigkeit?“, sagte ich und lachte.
„Die Wunde scheint tief zu sein.“ Sie beugte sich zu meiner Wade.
„Na gut“, sagte ich, „es ist vielleicht besser, wenn ich sie verbinde.“
„Ich helfe dir“, sagte Felix. Nachdem ich mich mit einem Grüß Gott von der Schwarzhaarigen verabschiedet hatte, ging ich mit Felix zum Clubhaus. Felix bestellte zwei Glas Bier und holte vom Erste-Hilfe-Kästchen allerlei Verbandmaterial.
„Ich werde Wundsalbe auftragen und dann die Wunde verbinden“, sagte er und begann, eine weiße Salbe auf meine Wade aufzutragen.
„Um Gottes willen, so kann man das nicht machen“, hörte ich eine Frauenstimme hinter mir. Es war die Frau von vorhin, die ihre Hände zusammenschlug, und entgeistert Felix’ Samariterdienste betrachtete.
„Haben Sie kein Desinfektionsmittel?“, fragte sie Felix.
Felix war überfordert. Wortlos schob er der Frau die Schachtel mit den Utensilien hin. Sie kramte darin herum, legte Verband, Salbe, Pflaster und Schere beiseite.
„Gibt es kein Desinfektionsmittel? Die Wunde muss gut gereinigt werden!“
„Ich kann noch einmal nachschauen“, bot Felix an.
„Ich glaube, das mache ich am besten selbst“, sagte sie und entfernte sich mit kleinen, schnellen Schritten.
„Ganz schön aufdringlich, die Lady“, bemerkte ich.
„Aufdringlich, aber hübsch und sie weiß, was sie will“, meinte Felix, „ich glaube, sie hat ein Auge auf dich geworfen, du bist der Hero des heutigen Tages. Würde mich nicht wundern, wenn sie sich dem strahlenden Sieger in die Arme wirft.“
„Meinst du?“ Vielleicht war es nur ein ausgeprägter Fürsorgeinstinkt, der sie antrieb. Dennoch interessierte sie mich, sie war sicherlich etwas älter als ich mit meinen 25 Jahren, doch es ging etwas von ihr aus, was mich reizte.
Als sie mit einer braunen Flasche zurückkehrte, sah ich mich veranlasst, uns vorzustellen.
„Ich weiß, wer Sie sind, Ihre Namen stehen ja mit den Ergebnissen am Board.“ Sie hatte eine helle, aber kräftige Stimme.
Ohne Umstände kniete sie sich vor mich hin und begann die Wunde zu reinigen. „Es wird etwas brennen, wenn ich Ihre Wunde auswasche, aber es muss sein. Beißen Sie die Zähne zusammen!“
„Ich bin Ihnen sehr dankbar“, sagte ich.
Sie hob den Kopf und blickte mit einem vielsagenden Lächeln zu mir auf. „Wenn Partikel in der Wunde zurückbleiben, dauert es länger, bis sie zuheilt. Und wenn sie tiefer eindringen, kann es böse Entzündungen geben. Aber wollen wir hoffen, dass das nicht der Fall sein wird.“
„Sie kennen sich aber gut aus. Sind Sie Ärztin?“
Sie lachte und strich sich ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. „Nein, keineswegs, ich bin in der Autobranche tätig. Unsere Mechaniker haben öfters kleine Verletzungen, ich habe schon eine gewisse Erfahrung damit.“
Sie sagte unsere Mechaniker, also musste der Betrieb ihr oder ihren Eltern gehören.
Felix verfolgte etwas amüsiert unsere Unterhaltung. „Die Doppelspiele haben begonnen. Ich werde einmal nachsehen, wie es läuft.“ Offensichtlich zog er sich zurück, um unseren Flirt nicht zu stören.
„Ich komme nach, wenn mich Frau …“, ich machte eine Pause, „wenn mich diese Dame verarztet hat.“ Ich lächelte ihr zu.
„Sagen Sie einfach Eva zu mir“, sie lächelte ebenfalls.
Während sie die Salbe auf die gereinigte Wunde auftrug und diese fachmännisch verband, fragte ich: „Was machen Sie heute Abend, Eva?“
„Ich werde zu Hause sein und mich um die Buchhaltung kümmern.“ Sie errötete leicht.
„Und wenn Sie die Arbeit ruhen lassen und mit mir Essen gehen würden?“
Sie antwortete nicht gleich. Sie schnitt das Verbandende in der Mitte entzwei und band die beiden streifenförmigen Enden um den Verband.
„Soll ich?“ Sie spielte die Unschlüssige und lächelte schelmisch.
„Unbedingt“, sagte ich, „die Arbeit wird Ihnen nicht davon laufen!“
„Da haben Sie leider recht, also gut.“
Bevor sie mich verließ, gab sie mir eine Adresse, dort sollte ich sie um 19 Uhr abholen. Dann gesellte ich mich zu Felix, um das letzte Doppelspiel zu beobachten. Es hing, beim Stand von 4:4, vom Ausgang dieses Spiels ab, ob wir ins Finale aufsteigen würden oder nicht. Die Erleichterung war immens, als das Resultat feststand. Es war gelungen, das letzte Doppel für uns zu entscheiden. Ein euphorischer Bernd Wächter lud uns zu einem Umtrunk ins Restaurant ein. Er ließ sogar Sekt auffahren und richtete eine kurze Ansprache an uns.
„Ich danke euch für euren Einsatz. Wir haben einen wichtigen Schritt zum Gewinn der Meisterschaft getan. Nun wird in Kürze die Entscheidung fallen, ob wir nach langer Zeit wieder österreichischer Meister sein werden. Daher bitte ich alle Spieler der Kampfmannschaft, intensiv zu trainieren. Ich werde diesbezüglich einen Trainingsplan ausarbeiten und dessen Einhaltung persönlich überwachen. Aber jetzt erheben wir das Glas und stoßen auf unseren Sieg an. Ich hoffe, dass wir bald wieder etwas zum Feiern haben werden. Falls wir Meister werden, verspreche ich euch ein Fest, dass ihr niemals vergessen werdet.“
Wir erhoben die Gläser und prosteten uns zu, dann unterhielten wir uns angeregt über die Spiele des Tages. Man lobte mich für meine Leistung, einige meiner Clubkameraden freuten sich, andere konnten ihren Neid nur schlecht verbergen. Bernd Wächter steuerte mich an. Ich hatte den Eindruck, dass sich seine Haare vor Stolz über den Sieg noch mehr abhoben.
„Du warst ein guter Ersatz, Andreas. Lindenthal war ein schwieriger Gegner, ich bin mir gar nicht sicher, ob Gerd gegen ihn gewonnen hätte.“ Gerd war der Kamerad, für den ich eingesprungen war. „Gerd wird uns auch in zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen, er hat sich einen Bänderriss zugezogen. Das bedeutet, dass du wieder spielen wirst. Genauso wie ich alle anderen gebeten habe, bitte ich dich ebenfalls, dem Tennis die nächsten Tage absolute Priorität einzuräumen. Wenn es geht, nimm dir Nachmittag frei und komm zum Training.“
„Ich werde mich bemühen, aber es ist schwierig. Ich fürchte, dass mein Chef sich querlegen wird, selbst wenn ich die Stunden einarbeiten würde.“
„Gib mir die Telefonnummer von deinem Chef, ich werde ihn anrufen!“
Ich schrieb die Nummer auf einen Zettel. „Versprechen Sie sich nicht zu viel davon, wir haben viel zu tun und mein Chef ist total unsportlich, er sagt, Sport ist Energieverschwendung!“
„Probieren geht über Studieren. Wenn wir Meister werden, laden wir ihn zu unserer Feier ein!“
„Viel Glück“, sagte ich nur kurz.
Nach dem Duschen setzte ich mich in meinen Golf und fuhr nach Hause. Als ich die drei Stöcke zu meiner Zimmer-Küche-Wohnung hinaufstieg, spürte ich eine leichte Spannung in der Wade, aber das war schon alles. Ich wollte in meiner Wohnung noch ein bisschen Ordnung machen, vielleicht bekam ich noch Besuch?
2.
Meine Gedankengänge wurden vom Läuten meines Handys unterbrochen. Es war Julia, eine hübsche Studentin, mit der ich seit Monaten befreundet war, mehr nicht. Was ihre Gefühle betraf, war sie zugeknöpft. Intimitäten hatte sie, trotz meiner Avancen, bisher erfolgreich widerstanden.
Als wir uns kennenlernten, hatte ich angenommen, dass es nicht schwierig sein würde, sich auch gefühlsmäßig näher zu kommen. Jedes Mal, bevor ich mich mit ihr traf, überlegte ich, wie ich diese Festung der Tugend und Zurückhaltung erstürmen könnte. Meine Annäherungsversuche hatte sie sanft, aber doch immer wieder zurück gewiesen. Wir küssten uns zwar, aber es gelang mir nicht, einen Schimmer von Leidenschaft in ihr zu wecken.
Trotzdem genoss ich die Stunden mit ihr, sie tanzte hervorragend Rock 'n' Roll. Außerdem unterhielt ich mich gerne mit ihr, sie hatte natürlichen Charme, der mich immer wieder aufs Neue bezauberte. Sie stammte aus einfachen Verhältnissen, ihr Vater war Kriegsinvalide und betrieb eine Tabak-Trafik in Oberösterreich. Mit einem bescheidenen Einkommen musste er die Familie erhalten. Julia war die Älteste, sie hatte zwei jüngere Schwestern und musste sich ihr Pharmazie-Studium mit diversen Nebenjobs finanzieren.
„Wie geht es dir?“ fragte sie, ihre Stimme klang unsicher. Offensichtlich erwartete sie, zum Tanzen eingeladen zu werden. Bisher musste ich immer die Initiative ergreifen, um mich mit ihr zu treffen, dass sie nun anrief, war ungewöhnlich und erstaunte mich.
„Es geht mir gut“, sagte ich und berichtete kurz über das gewonnene Tennismatch.
„Ich gratuliere dir!“
Dann entstand eine Pause. Es war klar, dass sie einen Vorschlag für die Gestaltung des Abends erwartete. Ich wollte dies mit einer Ausrede im Keim ersticken, als sie unvermittelt sagte:
„Wahrscheinlich hast du für heute schon etwas vor, stimmt’ s?“
Was sollte ich ihr nun antworten? Ich wollte nicht lügen, aber die Wahrheit konnte ich auch nicht sagen. Also überging ich ihre Anspielung.
„Es geht heute nicht, Julia, aber wir könnten morgen zum Fünfuhrtee gehen.“
„Morgen?“, sagte sie zögernd, „ich weiß nicht, ruf mich morgen an.“
Sonderbar dachte ich, nie hätte ich angenommen, dass sie, die Schüchterne, sich überwinden würde, mich wegen eines Rendezvous anzurufen. Ich schien also doch mehr als nur ein Zeitvertreib für das Wochenende zu sein.
Ich warf einen Blick aus meinem Fenster. Die Gewitterwolken hatten sich verzogen, in der Ferne, über den Häuserdächern, tauchten die Hügel des Wienerwaldes im untergehenden Sonnenlicht auf. Ich liebte diese späten Nachmittagsstunden in meiner Wohnung, wenn die goldigen Sonnenstrahlen in mein Zimmer leuchteten. Mein alter Kleiderschrank begann zu schimmern, ein riesiges Ding aus Massivholz, hochglanzfurniert, wie er vor einer Ewigkeit modern gewesen war.
Ich warf einen kritischen Blick auf mein Wohnzimmer, auf das Bücherregal und die Couch, die mir als Bett diente. Über dem abgenützten Parkettboden hatte ich einen großen, dunkelroten, mit verschiedenen Mustern versehenen, maschinengeknüpften Teppich gelegt. Eine Stehlampe, zwei Fauteuils und ein kleiner Tisch rundeten die Einrichtung ab. Einfach, aber gemütlich, befand ich.
Ich entnahm meinem Kleiderschrank einen dunkelblauen Blazer und eine graue Flanellhose. Dazu wollte ich ein hellblaues Hemd anziehen. Ich überlegte, ob ich eine Krawatte umlegen sollte, und entschied mich letztlich dafür. Wie würde der heutige Abend verlaufen? Was für ein Typ war Eva? Auf jeden Fall zählte Zurückhaltung nicht zu ihren dominierenden Charaktereigenschaften. Das waren meine Gedankengänge, als ich über gepflegte, baumbestandene Straßen fuhr, Häuser und Villen sah, mit schönen, vorgelagerten Gärten.
Die drückende Schwüle, die den ganzen Tag über der Stadt gelegen war, hatte sich aufgelöst. Vor dem Haus, in dem Eva offensichtlich wohnte, stand eine riesige, alte Linde. Ich stoppte meinen Golf, kurbelte das Seitenfenster herunter, drehte das Radio auf und wartete. Schon nach kurzer Zeit erschien Eva.
„Hallo“, sagte sie beschwingt.
„Hallo“, sagte ich ebenfalls und stieg aus, um ihr die Hand zu reichen. Ich öffnete die Tür meines Autos und ließ sie Platz nehmen. Die Eleganz ihrer Kleidung beeindruckte mich. Das Oberteil war aus einem fließenden Stoff, hinten am Rücken war ein tiefer Ausschnitt, der mit verführerischer Spitze unterlegt war. Die Farbe dieses raffinierten Oberteils war für mich schwer zu definieren, wenn Rosa, dann dunkel, pastellfarben. Der schwarze, körperbetonte Rock war knielang, ihre wohlgeformten, aber kräftigen Beine steckten in schwarzen Strümpfen, einen leichten, anthrazitfarbenen Mantel mit Ornamentmustern hatte sie auf ihren Schoß gelegt.
So wie sie gekleidet ist, kommt nur ein gutes Restaurant infrage, dachte ich, es wird wohl ein teurer Abend werden.
„Was macht das Bein?“, fragte sie gutgelaunt.
„Ich spüre nichts mehr, Sie haben mich perfekt versorgt.“
Wir begannen zu plaudern. Tennis war vorerst unser Gesprächsstoff.
„Ich habe ein paar Trainerstunden genommen, manchmal treffe ich sogar den Ball“, berichtete Eva, „ich hätte nie gedacht, dass Tennis so schwierig ist. Wie lange muss man spielen, damit man so gut spielt wie Sie?“
Ich erzählte, dass ich schon in meiner Kindheit vom Tennis fasziniert war.
„Wir wohnten in der Nähe des Schlosses Schönbrunn, wenn wir spazieren gingen, führte unser Weg an einem Tennisplatz vorbei. Dort blieb ich stehen und betrachtete die Spieler, wie sie weiße Bälle hin- und herschossen. Die rote Erde, die Spieler in ihren weißen Dressen, die fliegenden Bälle und der spezifische Klang beim Ballkontakt, beeindruckten mich. Ich wusste schon als Bub, dass ich einmal Tennisspielen würde.
Eines Tages stand ich wieder hinter dem Gitterzaun und sah den Spielern zu. Man bot mir an, die Bälle aufzusammeln, als Belohnung spendierte man mir eine Limonade. Von da an war ich in der schönen Jahreszeit fast jeden Nachmittag auf dem Tennisplatz und sammelte Bälle für die Spieler ein. Als ich größer wurde, gab mir der Platzwart ein uraltes Rakett. Stundenlang drosch ich die alten, ausgemusterten Bälle gegen eine Übungswand.
Als ich vierzehn Jahre alt war, sagte der Trainer zu mir, dass ich Talent hätte und ernsthaft mit dem Tennisspiel beginnen sollte. Ich trat als Spieler in den Club ein, meine Mutter sparte sich das Geld für meine Mitgliedschaft vom Mund ab. Der Trainer beschäftigte sich mit mir, ohne dafür Geld zu verlangen. Mit siebzehn war ich der beste Jugendliche und konnte es sogar mit den Senioren aufnehmen.“
Sie hörte mir interessiert zu. „Ich weiß nicht, ob ich Talent habe, aber ich spiele sehr gerne. Mich hat Tennis schon immer interessiert. Da ich keinen Partner habe, spiele ich mit dem Trainer und das kostet, wer will denn schon mit einer Anfängerin spielen?“
In mir regte sich der Verdacht, dass Eva nur jemand suchte, der mit ihr spielte. Eine kleine Enttäuschung stieg in mir auf. Nichtsdestotrotz ging ich auf ihre Anspielung ein.
„Bis zum Finale muss ich viel trainieren, da werde ich wenig Gelegenheit haben, mit Ihnen zu spielen, aber nach dem Finale würde ich Ihnen gerne etwas zeigen.“
„So habe ich es nicht gemeint“, sie lächelte, „ich kann mir den Trainer schon leisten!“
Mein Verdacht als Tennistrainer ausgenutzt zu werden, verflüchtigte sich. „Ich habe noch eine Schuld bei Ihnen abzutragen, vielleicht hätte man mir ohne Ihrer Intervention schon das Bein amputiert“, sagte ich scherzhaft, „außerdem würde es mir Vergnügen bereiten, mit Ihnen zu spielen.“
„Das haben Sie aber nett gesagt, Andreas.“ Sie blickte mich an, ihre selbstbewussten Gesichtszüge schienen nun warm, gefühlvoll betont. Das erste Mal in der kurzen Zeit, in der ich sie nun kannte, wirkte sie weich, zart. Intuitiv nahm ich meine rechte Hand vom Steuer und ergriff sanft die ihre. Langsam schlossen sich ihre Finger um die meinen und ich spürte einen leichten, fast zärtlichen Druck. Ich warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. Einige Augenblicke verstrichen, dann beugte sie sich zu mir und küsste mich. Ich spürte ihre vollen Lippen, der Hauch ihres Atems umfing mich, ihr Parfum umströmte mich. Wir hielten uns noch immer bei den Händen. Der Golf plagte sich im vierten Gang, als Autofahrerin merkte sie es wohl. Sie legte meine Hand mit einer langsamen Bewegung auf den Schalthebel, damit ich zurückschalten konnte.
„Wo fahren wir denn hin, Andreas?“
„Essen Sie gerne Französisch?“
„Schon, nachdem ich französische Autos verkaufe, habe ich eine Vorliebe für die französische Küche. Aber Sie werden sich doch wohl nicht derart in Unkosten stürzen wollen?“
„Wer redet von Unkosten an diesem schönen Abend?“
Ich wunderte mich, wie ich nun in Fahrt kam und ließ jene Zurückhaltung vermissen, die kurz nach dem Kennenlernen angebracht gewesen wäre.
Beim Restaurant angekommen, musste ich einige Runden drehen, bis ich endlich eine Lücke fand. Wir betraten das kleine Lokal, in dem der Besitzer auch für die Küche verantwortlich war. Die Tische waren durch Holzparavents voneinander getrennt, dadurch war man von anderen Gästen abgeschirmt. Aus der Küche drangen die charakteristischen Geräusche durch, Fleisch wurde geklopft, Gemüse zerkleinert, in den Pfannen brutzelte es.
Es war noch früh am Abend, daher konnten wir den Tisch auswählen. Wir entschieden uns für einen Platz in der Ecke neben dem großen Fenster, von dem man auf die schmale, spärlich beleuchtete Gasse sah. Absichtlich nahm ich nicht gegenüber Eva Platz, sondern setzte mich im rechten Winkel an die Schmalseite des Tisches. Als der Chef mich erblickte, kam er auf uns zu und begrüßte uns. Ich kannte ihn, denn ich war schon einige Male mit Geschäftsfreunden hier gewesen.
„Wenn Sie Fisch essen wollen, ich habe heute frische Goldbrassen. Wenn sie möchten, serviere ich sie auf provenzalische Art. Und als Vorspeise kann ich Ihnen eine fantastische Bouillabaisse empfehlen, heiß, scharf.“
Obwohl er perfekt Deutsch sprach, merkte man sofort, dass er Franzose war. Es war seine Art, keine Speisekarte vorzulegen, sondern Empfehlungen zu geben. Er wäre indigniert gewesen, wann man es trotzdem getan hätte. Fragend blickte ich Eva an.
„Wäre es Ihnen recht, oder wollen Sie etwas anderes essen?“
„Ich verlasse mich auf den Chef“, sagte sie und lächelte ihn an.
„Aber den Wein dürfen wir selber aussuchen?“, fragte ich amüsiert.
„Naturellement, Sie können alles aussuchen“, sagte er und hob pikiert die Augenbrauen.
Ich berührte besänftigend seine Hand. „Dann bringen Sie uns die Weinkarte, bitte!“
„Tout de suite“, sagte er und kam mit einem dicken Kompendium zurück. Die Auswahl der Weine war auf kartonierten Blättern gedruckt, die durch einen Lederriemen zusammengehalten wurden.
„Ich schlage vor, Weißwein zum Fisch zu nehmen“, sagte ich.
Eva nickte. Ich studierte die Weinkarte, die Preise der Weine waren ebenso exklusiv wie ihre Herkunft. Ich wählte einen Sancerre, einen nicht zu trockenen, kräftigen Weißwein.
Nun kam der Ober, um die Weinbestellung aufzunehmen. Er trug den üblichen schwarzen Anzug, sein bleiches Gesicht hob sich scharf ab. Die schütteren Haare waren zurückgekämmt, die goldgeränderte Brille verlieh ihm trotz seiner noblen Zurückhaltung eine gewisse Strenge. Er bediente sich der französischen Sprache, als er mich nach meinem Weinwunsch fragte.
„Une bouteille Sancerre.“
„Welchen Aperitif wünschen Sie?“ Ich wollte eigentlich keinen Apéritif, es ärgerte mich ein bisschen, überfahren zu werden, aber was blieb mir anderes übrig, nun war ich hier und wollte vor Eva nicht kleinlich wirken.
Ich blickte Eva an. „Ich kann nicht so viel Alkohol trinken und bedenken Sie, Andreas, dass Sie noch fahren müssen.“
Somit ermutigte mich Eva, dem arroganten Pinsel einen Korb zu geben.
„Non, merci, rien!“, sagte ich. Er deutete eine leichte Verbeugung an und verschwand.
„Waren Sie schon oft hier, Andreas?“
„Ja, schon öfters. Ich bin in einer Spedition angestellt, manchmal laden wir Geschäftspartner in dieses Restaurant ein.“
„Spedition, interessant, wofür sind Sie denn verantwortlich?“
„Ich bin für den LKW-Einsatz verantwortlich, vorwiegend nach Belgien und Frankreich. Es ist ein spannender Job, bei den langen Fahrten kann allerhand passieren, man braucht ein enormes Problemlösungspotential. Es gibt fast immer irgendwelchen Trouble."
Der arrogante Ober brachte den Wein in einem Kübel mit Eiswasser, entkorkte die Flasche, roch am Korken und goss ein wenig in mein Glas und ließ mich kosten. Der Wein war vorzüglich, ich forderte ihn auf einzuschenken. Als er abschwirrte, nahm ich mein Glas und prostete Eva zu. Sie neigte sich zu mir, ihre klar schimmernden Augen blickten mich an.
„Wenn ich mich recht erinnere, sind Sie im Autohandel tätig?“
„Wir handeln nicht nur, wir haben auch eine Werkstätte. Der Betrieb gehört meinen Eltern, genauer gesagt meiner Mutter. Mein Vater war als Meister im Betrieb angestellt, irgendwann haben sie geheiratet. Es ist kein großer Betrieb, aber wir verkaufen immerhin 100 neue Autos und 150 gebrauchte und haben fünf Mechaniker angestellt. Insgesamt arbeiten fünfzehn Personen im Betrieb.“
„Beachtlich“, sagte ich, „eine Wachstumsbranche."
„Ja, aber die Branche ist stark mit Mitbewerbern besetzt. Man kann bei den Abschlüssen keine große Rendite erwirtschaften, weil durch den Konkurrenzkampf die Preise verdorben werden.“
Als die Bouillabaisse serviert wurde, machte Eva den Fehler, zu viel geriebenen Emmentaler in ihre Suppe zu streuen. Als dieser schmolz, zog er unendliche lange Fäden. Der Kampf mit dem fadenziehenden Käse ließ ihr Gesicht leicht erröten, kleine Schweißperlen schimmerten auf ihrer Stirn.
„Ich hoffe, Sie schämen sich nicht für mich, wie ich mich hier aufführe!“ In der Tat beobachtete uns der Ober, er konnte einen Ansatz eines amüsierten Grinsens nicht verbergen.
„Aber keineswegs. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder Sie wickeln die Fäden um Ihren Löffel, oder Sie lassen diese heimtückische Suppe stehen.“
„Das möchte ich nicht, sie schmeckt einfach zu gut.“
Tapfer kämpfte sie weiter. Die Goldbrassen aßen wir schweigend. Von Zeit zu Zeit warf ich ihr verstohlene Blicke zu, bewunderte ihre dunklen, braunen Augen, die gepflegten Haare, die schmale Nase, die an der Spitze sich etwas abrundete und vor allem die geschwungenen, vollen Lippen, hinter denen ein kräftiges, blendend weißes Gebiss verborgen war. Ihre Backenknochen waren hoch angesetzt, doch dann verschmälerte sich ihr Gesicht, dies betonte ihren schönen Mund und das prononcierte Kinn.