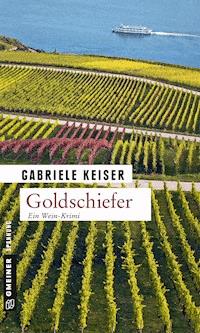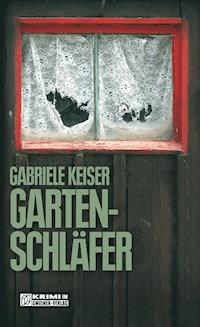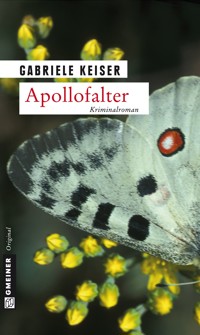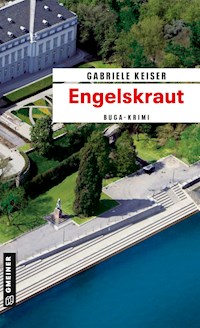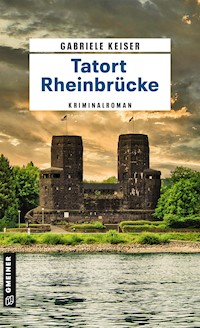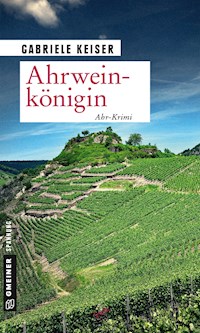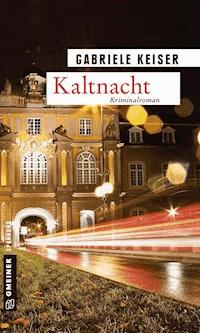Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Anfang der 1950er Jahre in der Westpfalz: Zusammen mit ihrer Mutter bewirtschaftet die 19-jährige Linde Liebold einen kleinen Bauernhof. Seit der Vater im Krieg vermisst ist, fehlt schmerzlich eine starke männliche Hand. Da verliebt sich Linde Hals über Kopf in den neuen Knecht der Nachbarn. Sein weltgewandtes, charmantes Auftreten und seine Zugewandtheit imponieren ihr. Aber im Grunde weiß sie nur wenig von ihm. Als Linde eines Tages von seinem schrecklichen Geheimnis erfährt, bricht für sie ihre so schön zurechtfantasierte Zukunft jäh zusammen … Zur gleichen Zeit ist Kommissar Bernstein auf der Suche nach einem Phantom, dem so genannten Autobahnwürger, der seit geraumer Zeit das ganze Land in Angst und Schrecken versetzt. Der Roman, der von wahren Begebenheiten inspiriert ist, schildert eindrücklich das Landleben kurz nach dem Krieg, als man gewillt war, mit allen Mitteln auf den Trümmern einer schrecklichen Vergangenheit eine blühende Zukunft zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGBundesbahnhof 1, 56859 Bullay/MoselDeutschlandTel.: 06542/5151E-Mail: [email protected] Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-960-6Lektorat: Michael DillingerAusstattung: Stefanie ThurTitelfoto: Almudena_Sanz_Tabernero/pixabay.com
Gabriele Keiser
Hast du Angst vor mir?
Ein denkwürdiger Sommer
Roman
Rhein-Mosel-Verlag
Köln Herbst 1952 Vorspann
In dem Moment, als er sie sah, schwoll das Rauschen in seinem Kopf an. Verwandelte sich in ein Sirren und Summen. Mit starrem Blick beobachtete er, wie sie geradewegs auf das Trümmergrundstück zulief, das wie eine offene Wunde zwischen eilig hochgezogenen Betonbauten klaffte.
Schnell schob er sein voll bepacktes Fahrrad über das holprige Trottoir und folgte ihr. Niemand sonst schien in der unmittelbaren Gegend unterwegs zu sein. Hier an diesem versteckten Fleck, wo ein paar übriggebliebene Mauern in den Himmel ragten, steinerne ausgebrannte Gerippe, zwischen denen junge Bäumchen wuchsen.
Suchend sah er sich um. Wo war sie? Sollte er sie verloren haben? Er lehnte sein Fahrrad an eine der beschädigten Mauerwände und begann, die beiden Hartgummikugeln in seiner Hosentasche zu kneten. Währenddessen irrte sein Blick umher.
Ach, da war sie ja! In einiger Entfernung schlurfte sie mit gesenkten Schultern unter einem übrig gebliebenen Türsturz hindurch. Blieb kurz stehen, bückte sich, als ob sie etwas suche. Hinter ihr bemerkte er die beiden Türme des Doms. Robuste Mauerwerke, die den kriegerischen Zerstörungsversuchen getrotzt hatten.
Schnell lief er zwischen halben Wänden mit offenen Fensterhöhlen hindurch, wich aufgeschichteten Steinhaufen aus, peinlich darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. Das war gar nicht so einfach zwischen all dem Schutt und Geröll, in dem es nach Ruß, Steinstaub und Unrat roch.
Verdammter Mist! Schon wieder war sie aus seinem Sichtfeld verschwunden. Angestrengt lauschte er, aber bis auf ein Rascheln und Knacken war es hier sonderbar still, die Geräusche der Großstadt schienen weit entfernt.
Irgendwo in seiner unmittelbaren Nähe musste sie sein, das sagte ihm sein Instinkt. Er presste die Lippen zusammen. Immer heftiger knetete er die beiden Hartgummikugeln in seiner Hosentasche.
Es dämmerte bereits. Nach einem kurzen Aufleuchten der Sonne hatte sich alles um ihn herum grau zu färben begonnen. Seine Anspannung wuchs und die Unruhe nahm immer mehr zu. Das Sirren in seinem Kopf hatte sich in ein Kribbeln verwandelt, das er auf seiner Haut spürte. Untrügliche Zeichen, die er nur allzu gut kannte.
Er musste sie finden, unbedingt.
Mit einem Mal hörte er schlurfende Schritte. Sofort duckte er sich. Sein Herz begann ein paar Takte schneller zu schlagen. Vorsichtig hob er den Kopf.
Im Zwielicht tauchte ihre Silhouette auf und bewegte sich langsam auf ihn zu. Dreizehn oder vierzehn Jahre mochte sie zählen, das lange, dunkle Haar hing ihr zerzaust bis in den Rücken. Sie hielt den Kopf gesenkt, als ob sie eine schwere Last trüge. Nun stand sie fast vor ihm. Da trat er hinter der Mauer hervor.
Sie zuckte zusammen. Blieb wie angewurzelt stehen. Ihre schreckgeweiteten Augen huschten hin und her.
»Was machst du hier? Wissen deine Eltern, wo du bist?« Er bemühte sich, seine Stimme höflich klingen zu lassen.
Aus riesengroßen dunklen Augen starrte sie ihn an. Tränen glitzerten darin.
»Hast du etwa Angst vor mir? Das brauchst du doch nicht«, äußerte er voller Verständnis. Gleichzeitig genoss er die Erregung, die ihn immer mehr ergriff.
Zwar schüttelte sie den Kopf, doch es war ihr anzusehen, dass sie log. Sein Gespür für solche Dinge hatte ihn noch selten getrogen. Er bemerkte, dass ihr Rock zerschlissen und der Saum abgerissen war, darüber trug sie einen viel zu großen Pullover. Ausgeleierte Kniestrümpfe fielen über ihre Knöchel auf das abgewetzte Leder der braunen Schnürschuhe, die wie Männerschuhe aussahen. Zitternd stand sie vor ihm und rührte sich nicht vom Fleck.
Feines Fräulein! Wie die aussieht. Vollkommen verwahrlost. So läuft man doch nicht rum.
Es war kühl, der Sommer hatte bereits begonnen, in den Herbst überzugehen. Doch er wusste, dass das nicht der Grund ihres Zitterns war.
»Sagst du mir, warum du weinst?« Nun legte er ein mitfühlendes Schmeicheln in seine Stimme.
Sie ließ ihn nicht aus den Augen. Ihr Mund war fest geschlossen. Sie hatte noch kein einziges Wort gesprochen.
»Bist du eine Zigeunerin?« Er trat einen Schritt auf sie zu. Sein Gesicht war jetzt ganz nah vor dem ihren. »Verstehst du überhaupt, was ich sage?«
Ihr starr auf ihn gerichteter Blick hatte sich verändert, war hart, argwöhnisch und ängstlich zugleich.
Der Druck in seinem Inneren verstärkte sich. »Wollen wir uns ein bisschen liebhaben?«, schmeichelte er. Etwas hämmerte gegen seine Schläfen. Seine Hände näherten sich ihrem Hals. Noch immer wich sie nicht zurück. Auch dann nicht, als er mit beiden Daumen ihre Kehle suchte. Mit Genugtuung spürte er das Pochen unter der Haut, die Bewegung des Kehlkopfs beim Schlucken.
Warum wehrst du dich nicht? Komm, wehr dich. Das macht die Sache besser.
Er verstärkte den Druck seiner Finger. Konzentrierte sich vollkommen auf sein Tun. In ihrem pulsierenden Blut spürte er sein eigenes Herz rasen.
In diesem Moment schien sie aus ihrer Schockstarre zu erwachen. Sie reckte beide Arme und versuchte mit Macht, seine Hände wegzuzerren. Als er den Griff um ihren Hals etwas lockerte, schnappte sie keuchend nach Luft.
Ja, Mädchen, das gehört zum Spiel.
Im gleichen Moment verwandelten sich seine Hände wieder in eiserne Klammern. Sie wand sich verzweifelt, trat ihm gegen das Schienbein.
Oho, man kann sich also doch wehren. Wird dir aber nichts nützen, Fräulein.
Da war ein Sog, ein Strudel, der ihn mitriss. Etwas brach aus ihm heraus, das nicht mehr aufzuhalten war. Er kämpfte, keuchte und schwitzte. Das, was er lange unterdrückt hatte, explodierte in diesem Moment und entlud sich. Alles, an dem er sonst erstickt wäre. Er fühlte sich ungeheuer stark, mächtig, als Herr über Leben und Tod. Was es war, das in ihm brodelte, wusste er nicht zu benennen. Er spürte nur, wie es übermächtig in ihm hochstieg, ihn überschwemmte, ihn unsäglich beglückte.
In diesem Augenblick rammte sie voller Wucht ein Knie zwischen seine Beine. Der Schmerz durchschoss ihn wie ein Blitz. Mit einem tierischen Laut schrie er auf. Ein roter Schleier legte sich vor seine Augen, aufheulend presste er die Hände auf sein Geschlecht. »Du dreckiges Luder!«, schrie er voller Wut. »Verdammtes Aas.«
Er wimmerte. Er schluchzte. Krümmte sich. Rotz lief ihm aus der Nase.
Als er wieder klar sehen konnte, war das Mädchen zwischen den Trümmerhalden verschwunden.
Westpfalz Nähe Marienthalerhof Sonntag, 31. Mai 1953 1. Kapitel
Er stieg vom Fahrrad, blieb einen Moment stehen und sah sich um. Spürte, wie allmählich seine Erregung abebbte. Auf der kleinen Lichtung war nur das Zwitschern der Vögel zu hören und das Rauschen der Blätter, durch die der Wind strich. Aus der zerdrückten Packung in seiner Hemdbrusttasche fingerte er eine Juno heraus und stellte enttäuscht fest, dass es seine letzte Zigarette war. Mit einem Streichholz zündete er sie an, inhalierte ein paar Mal tief. Rauchte sie bis auf einen kleinen Rest, wobei er sich fast die Finger verbrannte. Den Stummel ließ er achtlos fallen und zertrat ihn mit der Schuhspitze im Sand. Dann schob er sein Fahrrad weiter durch den unebenen und von Baumwurzeln durchzogenen Waldweg. Irgendwo klopfte ein Specht. Auch ein Kuckuck rief.
Die Luft roch nach Moos und trockenem, sonnenbeschienenem Laub und erinnerte ihn an den Forst seiner Kindheit in Engelsdorf. Am Wegrand wuchsen Schafgarbe, Glockenblumen und üppige Farne, Fliegen und andere Insekten summten um ihn herum, schienen ihn zu begleiten. Ab und an schimmerte die Sonne gleißend zwischen dem Blattgrün hindurch und blendete ihn. Unter den Achseln seines rotkarierten Buschhemdes hatten sich Schweißflecken gebildet. Feuchte Haarsträhnen hingen ihm ins Gesicht, die er immer wieder nach hinten strich.
Ein Stückchen weiter entlang des Weges entdeckte er Walderdbeeren unter einer blühenden Brombeerhecke. Er pflückte ein paar der kleinen roten Beeren und steckte sie in den Mund. Wieder blitzten Gedanken an seine Kindheit auf. Eigentlich schade, dass Engelsdorf so weit weg war.
Mit einem Mal hörte er helle Mädchenstimmen. Schnell schob er das Rad hinter die Hecke, blieb stehen, lugte durch die Zweige und lauschte. So gut es ging, versuchte er, sich unsichtbar zu machen und dennoch alles zu beobachten.
Durch das Gewirr der Ranken hindurch konnte er die Silhouetten zweier Mädchen erkennen. Ein größeres, eigentlich eine junge Frau, und eine Kleinere, die munter neben der Großen hin und her hüpfte. Jetzt blieben beide vor einem riesigen Ameisenhaufen stehen, die Kleine zeigte darauf und sagte etwas, was er jedoch nicht verstehen konnte. Gebannt beobachtete er die beiden Mädchen. Noch konnte er ihre Gesichter nicht erkennen, sie waren lediglich Schemen, aber äußerst ansehnliche Schemen, die sein Herz schneller klopfen ließen.
Die Worte des Gefängnispfarrers schossen ihm durch den Kopf: Er solle seine Begierde beherrschen lernen. Dann hätte er künftig weniger Schwierigkeiten. Er lachte leise vor sich hin. Doch, da war was dran, das musste er zugeben. Aber was wusste solch ein Pfaffe schon vom wirklichen Leben?
Die Mädchen gingen weiter und näherten sich langsam der Stelle, wo er im Verborgenen lauerte. Deutlich sah er jetzt den blonden Lockenkopf der Jüngeren. Eine weiße Schleife groß wie ein Propeller steckte in ihren gescheitelten Locken. Ihr rundes Gesicht war gerötet. Das brünette Haar der Älteren war zu einem Pferdeschwanz hochgebunden. Beide Mädchen kicherten unentwegt und neckten sich. Sie waren adrett gekleidet. Ist ja Sonntag, fiel ihm ein. Am heiligen Sonntag machen sich die Leute fein. Auch auf dem Land.
Seine Augen huschten von einer zur anderen. Die Kleine trug ein weißes Sommerkleid mit Streublümchen und Puffärmeln. Darüber eine weiße Schürze mit Volant, weiße Kniestrümpfe und glänzende Lackschuhe. Die Größere hatte ein luftiges, gelb und weiß getüpfeltes Sommerkleid an, das ihr gut stand. Ein schwarzer Samtgürtel betonte ihre schlanke Taille.
Seine Erregung wuchs immer mehr.
»Fang mich doch«, rief die Kleine jetzt kichernd und rannte weiter. Unwillkürlich duckte er sich. Doch die Mädchen benahmen sich völlig unbefangen. Glaubten sich allein und hatten seine Gegenwart nicht bemerkt.
Die Kleine mochte acht Jahre alt sein, vielleicht auch schon zehn. Die Große schätzte er etwa zehn Jahre älter.
Nun konnte er sie ungehindert betrachten. Ihm wurde heiß und kalt zugleich, das Blut in seinen Ohren rauschte und seine Zunge klebte am Gaumen fest. Mit einem Mal verlangsamte sich alles. Es war ein seltsam unwirklicher Moment, in dem sich alle seine Sinne auf die beiden spielenden Mädchen richteten, die unbeschwert im Wald herumliefen, als ob es keinerlei Gefahren gäbe. Die Große gefiel ihm ganz besonders. Aber die Kleine war ebenfalls sehr niedlich.
Jetzt war sie hingefallen.
»Hast du dir wehgetan?«, vernahm er die besorgte Stimme der Älteren, die sich sofort über das Mädchen beugte und auf eine offensichtliche Wunde pustete. Dann begann sie ein Liedchen zu summen. »Heile heile Gänsje, es wird bald wieder gut …«
»Ist gar nicht schlimm.« Die Kleine sprang lachend auf, rannte, schlug ein paar Haken. Stolperte, rappelte sich wieder auf. Rannte weiter.
Plötzlich war sie direkt vor ihm. Erschrocken schlug sie die Hand vor den Mund. Freundlich lächelte er sie an. »Die Erdbeeren hier sind sehr süß. Hast du auch schon welche gepflückt?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf und stand abwartend da.
»Du, da hinten habe ich einen Igel gesehen«, raunte er mit verschwörerischer Miene und wies über seine Schulter ins Dickicht hinein. »Wenn du willst, zeig ich ihn dir.«
»Ein Igel. Wo?« Sie sprach Pfälzer Dialekt, sagte »Ischel«.
»Na, da hinten. Ein kleines Stückchen weiter. Komm mit.« Er streckte ihr die Hand hin.
In diesem Moment war die Ältere hinter sie getreten und fasste sofort die Jüngere am Arm. Ihre Augen bewegten sich wie gehetzt. »Schnell weg!«, stieß sie hervor und wollte die Kleine mit sich zerren. Doch die blieb weiter wie angewurzelt stehen.
»Der Mann hat einen Igel gesehen. Den will er uns zeigen.«
Die Große warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. »Ischel gibt’s auch bei uns im Garten.« Auch sie sprach mit unverkennbar pfälzischem Zungenschlag. In bestimmendem Tonfall fügte sie hinzu: »Komm jetzt. Wir kennen den Mann net.«
»Aber, aber. Ihr braucht doch keine Angst vor mir zu haben. Ich tu euch ganz bestimmt nichts«, säuselte er in einer Stimmlage, die er eingeübt hatte.
Doch beide Mädchen drehten sich um und liefen los. Schnell hatte er sie eingeholt, umrundete sie, blieb vor ihnen stehen und sah sie mit Unschuldsmiene an. »Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ich zum Aschenbrennerhof komme.«
Die Jüngere sah die Große an, als ob sie von ihr eine Antwort erwarte und trat von einem Fuß auf den anderen.
»Den Hof gibt’s hier net«, sagte die Ältere. »Und wir müssen heim.« Sie zupfte am Schürzenband der Kleinen.
Doch die wollte ihm offensichtlich behilflich sein. »Da vorne ist der Marienthalerhof«, sagte sie arglos und zeigte in die Richtung, die er ursprünglich angepeilt hatte. »Da wohnen wir.« Jetzt starrte sie ihm neugierig ins Gesicht und fragte: »Wer bist denn du?«
»Ich bin der Jean.« Er lachte sie freundlich an. »Und wie heißt du?«
»Marlene«, antwortete sie gehorsam.
»Marlene, wie die Filmschauspielerin. Das ist aber ein schöner Name.« Er fasste in seine Hosentasche, nahm eine der beiden Hartgummikugeln heraus, die er immer bei sich trug, und zeigte sie ihr. »Weißt du was das ist?«
Sie kicherte, verdrehte die Augen und hielt sich die Hand vor den Mund. »Ein Ball.«
»Schon. Aber es ist ein besonderer Ball. Versuch mal, ihn zusammenzudrücken.«
Schüchtern nahm Marlene die Gummikugel in die Hand und drückte mit aller Kraft zu. Sie gab keinen Millimeter nach.
»Das geht net«, sagte sie enttäuscht.
»Doch, das geht. Wenn man stark genug ist.« Er nahm ihr die Kugel aus der Hand und quetschte sie. »Siehst du?«
»Du schwindelst mich an.« Sie kicherte.
»Nein nein. Schwindeln tut man nicht.« Er ließ die Kugel in seiner Hosentasche verschwinden. »Höchstens zaubern. Das mögen alle Leute.«
»Marlene, komm jetzt«, sagte die Große bestimmt. »Die Mama wartet.«
»Stimmt gar net. Die Mama hat nix gesagt«, antwortete Marlene trotzig und wandte sich wieder an Jean. »Kannst du noch mehr zaubern?«
Nun zerrte die Ältere die Kleine so heftig an der Schürze, dass das Band aufging. »Wie oft hat dir die Mama gesagt, dass wir net mit fremden Männern sprechen sollen?«, zischte sie.
»Deine Mutter hat schon recht. Im Wald lauert so mancher böser Bube.« Er lächelte gewinnend. »Aber ich bin nicht böse und ich bin auch kein fremder Mann. Ihr wisst ja, wie ich heiße.«
Marlene nickte. »Schaan. Wie mein Opa.«
»Komm jetzt!« Die Ältere wurde immer ungeduldiger.
Er legte den Kopf schief, sagte freundlich: »Ich hab euch meinen Namen gesagt. Deinen weiß ich, Marlene.« Er tippte ihr auf die Brust. »Aber Ihren weiß ich noch nicht.« Dabei sah er der Älteren tief in die Augen. Augenblicklich errötete sie, wandte sich verlegen ab und trat einen Schritt zurück. Strauchelte kurz und fing sich wieder.
»Das ist Linde«, sagte Marlene. »Und die ist net meine große Schwester. Falls du das denkst.«
Marienthalerhof Anwesen Mosbach 2. Kapitel
Familie Mosbach saß in der geräumigen Küche um den Esstisch. Das Wachstuch, auf dem Annelie auf einem Teller Hausmacher Wurst appetitlich angerichtet hatte zusammen mit sauren, selbst eingelegten Gurken, war zerschlissen und zeigte dunkle Einschnittkerben. Das Brotkörbchen war gut gefüllt. In der Tischmitte dampfte eine Kanne Pfefferminztee.
Im Radio lief die Heimatmelodie, eine Sendung, die Wilhelm jeden Sonntagabend einschaltete.
Die Wohnküche mit dem dominierenden weißgestrichenen Büfett war der Mittelpunkt der kleinen Familie. Vor den beiden Fenstern, die zum Hof hinausgingen, hingen zweiteilige, zur Seite geraffte Tüllgardinen mit Volants, die mit einer rosa Schleife an den Enden zusammen gebunden waren.
Wochenend und Sonnenschein, erklang es mehrstimmig aus dem Radio. Weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein …
Verstohlen beobachtete Annelie ihren Mann, wie er bedächtig seine Brotscheibe dick mit Leberwurst bestrich, dann zum Mund hob, als sei es etwas Kostbares. Dabei musste sie wieder einmal daran denken, wie endlos lange ihr die Zeit vorgekommen war, als er weg war, zuerst im Krieg und danach in Gefangenschaft, und sie nicht wusste, wo er war und wie lange das Warten noch andauern würde. Dass er nicht mehr wiederkommen könnte, diesen Gedanken hatte sie stets zurückgedrängt. Als er schließlich eines Tages vor der Tür stand, abgemagert mit eingefallenem Gesicht und in zerlumpter Uniform, war sie ordentlich erschrocken gewesen.
Damals war Wilhelm kaum wiederzuerkennen und wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass er ihr immer noch etwas fremd vorkam, obwohl er doch nun schon seit fast vier Jahren wieder bei ihnen auf dem Hof lebte. Die Kriegsjahre hatten ihn sehr verändert. Auch die anschließende Zeit in Gefangenschaft. Und noch immer schien er sich nicht in der Gegenwart zurechtzufinden, auf seinem Hof. In seinem Haus.
Sie hätte gern einiges von ihm über diese Zeit erfahren, doch jedes Mal, wenn sie eine Frage stellte, sah er sie mit einem schmerzlichen Blick an, der ihr durch und durch ging. Er zuckte dann lediglich mit den Schultern. Manchmal fing er auch urplötzlich zu zittern an. Oder ihm liefen Tränen die Wangen hinunter. Mehrmals war sie nachts aufgewacht und hatte bemerkt, wie er von einem Weinkrampf geschüttelt wurde. Das, was er erlebt hatte, musste schrecklich gewesen sein, so viel stand fest, doch darüber hatte er kaum gesprochen. Aber man hörte ja auch allerhand. Sie hatte beschlossen, ihn nicht damit zu quälen. Vielleicht war es wirklich besser, über manches zu schweigen.
Zorn durchdrang sie, wenn sie daran dachte, was sie für gutgläubige Marionetten gewesen waren, die hinter diesem Hitler wie einem Gott herliefen. Wie sie ehrfürchtig den rechten Arm in die Luft warfen und mit verklärten Augen »Heil. Mein Führer!« brüllten. Alle hatten sich so verhalten. Sie war keine Ausnahme gewesen. Mit Scham dachte sie daran, wie gerührt sie war, als sie in der Wochenschau sah, wie dieser Mann lächelnd von einem kleinen Mädchen ein Margeritensträußchen entgegennahm und ihr sanft über das Lockenköpfchen strich. Aber sie hatten es eben nicht besser gewusst.
»Marlene, schmatz nicht«, ermahnte sie streng ihre Tochter.
Die schluckte sofort den Bissen hinunter, den sie im Mund hatte, und begann zu husten.
»Hand vor den Mund!«, befahl Annelie und verdrehte die Augen. »Du musst nicht die ganzen Krümel über den Tisch spucken.«
Das Kind gehorchte und bemühte sich sichtlich, manierlich weiterzuessen.
Etliche Stubenfliegen summten um den gelben, mit Leim bestrichenen Fliegenfänger, um kurz darauf zappelnd kleben zu bleiben und zu verenden.
Marlene schlürfte einen Schluck Tee. Annelie blickte sie finster an. Es widerstrebte ihr zwar, ständig ihre Tochter zu ermahnen, aber Wilhelm sollte schließlich nicht denken, dass sie das Kind nicht ordentlich erzog.
»Der Tee ist so heiß und ich hab Durst«, jammerte Marlene.
»Trotzdem muss man sich anständig benehmen«, tadelte sie.
Früher im Krieg und in der Zeit danach, als alles noch schwierig war, hatte sie nicht so sehr auf Benimmregeln geachtet. Da hatte sie sich mit anderen Dingen herumschlagen müssen. Die Sorgen waren inzwischen nicht kleiner geworden. Nur anders.
Wilhelm furchte die Stirn. Er sah nachdenklich aus. »Ich bräuchte unbedingt jemanden, der mir beim Ausschachten hilft«, sagte er, während er sich eine weitere Brotscheibe mit Hausmacher Wurst bestrich. »Ich weiß nicht, wie ich das allein schaffen soll.«
»Man muss doch nichts überstürzen«, beschwichtigte Annelie.
»Aber wir brauchen unbedingt einen Schuppen, wo wir die Geräte und Maschinen unterstellen können«, insistierte er. »Sonst rostet uns alles weg.«
Annelie seufzte. »Musst halt einen Knecht einstellen.«
»Woher nehmen?«, fragte er hart. »Die was taugen sind doch alle im Krieg geblieben. Oder noch in Gefangenschaft.«
»Nicht alle«, wandte Annelie ein. Sie dachte an Egon, ihren früheren Verehrer, der es wunderbar verstanden hatte, sein Fähnchen nach dem Wind zu drehen. U.k. wurde er eingestuft, unabkömmlich, dabei war sein kleiner Schreinerbetrieb genauso wenig kriegswichtig gewesen wie ihr Bauernhof. Er war ein Schlitzohr, immer lustig und ein Liedchen auf den Lippen, darum hatte sie ihn immer beneidet und auch darum, dass er sich am Ende durchsetzte. Ganz anders als Wilhelm, der seiner Einberufung ohne Murren gefolgt war und nun seine Verbitterung förmlich vor sich hertrug.
»Ja, die Drückeberger, von denen gibt es mehr als genug. Die nützen mir aber nichts. Da muss jemand ran, der kräftig ist. Der Muskeln hat. Und dem man nicht alles zweimal sagen muss. Ich hab mich schon überall im Dorf umgehört, aber da ist nichts zu machen.«
Wilhelm schien nur noch das Negative zu sehen. Das war früher nicht so. Da hatte er oft Späßchen gemacht und viel gelacht.
»Ich könnt auch einen gebrauchen, der mir im Garten hilft. Da wuchert alles zu. Früher, da hatten wir immer Fremdarbeiter. Die konnten ordentlich was wegschaffen.«
Wilhelm sah ärgerlich hoch. Schüttelte den Kopf. »Fremdarbeiter!« Das klang abfällig. »Die Zeiten sind Gottlob vorbei.«
Wieso sprach er so? Es war nicht alles schlecht gewesen im Krieg. Sie musste schließlich sehen, wo sie blieb, allein mit dem Kind. Die Fremdarbeiter, die bei ihr auf dem Hof geholfen hatten, Polen und Russen, waren kräftige, lustige Burschen gewesen. Und ihre Hilfe war bitter notwendig. Wie hätte sie denn alles bewerkstelligen sollen ohne männliche Hilfe? Sie hatte sich nichts vorzuwerfen, war immer gut zu ihnen gewesen. Selbstverständlich hatten sie zum Essen bei ihnen mit am Tisch gesessen, obwohl das offiziell verboten war. Extra ein Merkblatt war herausgegeben worden, auf dem stand, wie man sich den Fremdarbeitern gegenüber zu verhalten hatte. Das hatte sie jedoch sofort weggeschmissen. Die jungen Männer waren willig, arbeiteten fleißig, hatten immer Hunger und freuten sich über kleine, eigentlich selbstverständliche Freundlichkeiten. Sie hatten ihr sogar vor Dankbarkeit die Hand geküsst, eine Geste, die sie nur aus Kinofilmen kannte. Noch immer hatte sie ihr »dawei!, dawei!« im Ohr, wenn sie die Pferde antrieben.
Gut, der kleine Pole der Weingarts vom Nachbarhof, der hatte Pech gehabt. Was hat der sich auch in die Charlotte vergucken müssen? Liebschaften zwischen deutschen Frauen und Ostarbeitern konnten einfach nicht gutgehen. Das war wider die Natur. Im Grunde war es nicht verwunderlich, dass der alte Weingart die Schwester seiner Frau mit ihrem dicken Bauch vom Hof jagte.
Plötzlich spürte Annelie die Anspannung, die in der Luft lag. Im Radio wurde eine Pause gemacht. Die eingetretene Stille war unheimlich. Sie bemerkte, wie Marlene irritiert von einem zum anderen sah, schließlich den Kopf wandte und zum Fenster hinausblickte.
»Da kommt jemand«, rief die Kleine, sprang auf und lief zur Tür.
Die Radiomusik setzte wieder ein.
So oder so ist das Leben.
Schon hörte man Schritte auf der Treppe. Dazu ein Murmeln. Eine fremde Männerstimme. Kurz darauf erschien das Kind zusammen mit einem jungen Mann zurück in der Küche.
»Das ist der Jean«, sagte sie freudestrahlend. »Den kenn ich. Er heißt wie der Opa.«
Annelie bemerkte, dass Wilhelm den Fremden finster mit zusammengezogenen Brauen anblickte. So wie er jedem Unbekannten begegnete. Er war so misstrauisch geworden.
»Johannes Margan, im allgemeinen nennt man mich Jean«, stellte sich der junge Mann vor und trat von einem Bein aufs andere. »Ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe.« Er sprach schriftdeutsch mit einem kleinen, undefinierbaren Akzent. Seine Stimme hatte einen warmen Klang.
»Woher kennen Sie meine Tochter?«, fragte Wilhelm argwöhnisch.
»Wir sind uns zufällig heute Mittag begegnet. Da hat sie so schön mit ihrer Freundin gespielt.« Er lächelte und zwinkerte dem Kind zu. »Nicht wahr, Marlene?«
Das Mädchen nickte eifrig. »Der Jean ist ganz stark«, sagte sie. »Er kann einen harten Ball zerquetschen.«
»So?« Wilhelm horchte regelrecht auf. »Sie suchen also Arbeit. Was können Sie denn?«
»Alles, was anfällt. Ausmisten, melken, Holz hacken. Ich bin auf einem Bauernhof großgeworden, da liegt mir das sozusagen im Blut.« Er lachte. »Beim Schlachten hab ich schon geholfen. Mit Pferden kann ich auch ganz gut umgehen. Und mit Maschinen.«
Wilhelm hörte ihm interessiert zu.
»Der Bauer, bei dem ich zuletzt gearbeitet hab, hatte leider keine Arbeit mehr für mich. Obwohl er sehr zufrieden mit mir war. Aber wie das so ist.« Der Fremde hob die Schultern und ließ sie wieder fallen.
»Dann setzen Sie sich mal zu uns.« Wilhelms Miene war offener geworden, sein Ton freundlich. Er nickte Annelie zu. »Wir sind gerade beim Abendbrot. Wollen Sie mitessen? Es gibt Hausmacher Wurst. Aus eigener Schlachtung.« Das klang stolz.
»Gerne.« Auf Margans Gesicht erschien ein Strahlen. »Sehr gerne.«
Annelie erhob sich und legte ein weiteres Gedeck auf.
»Zufälle gibt’s«, murmelte Wilhelm.
Der junge Mann setzte sich zu ihnen an den Tisch.
»Lassen Sie es sich schmecken. Greifen Sie nur tüchtig zu«, forderte Annelie ihn auf. »Ich schneide Ihnen gern noch ein paar Scheiben Brot ab.«
»Das ist sehr freundlich.«
»Wo waren Sie denn zuletzt?«, wollte Wilhelm nach einer Weile wissen.
»Im Lautertal. Auf einem Einsiedlerhof.«
»Wo genau?«
»Albrechtshof«, antwortete er.
Wilhelm legte die Stirn in Falten. »Kenn ich nicht. Du, Annelie?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nie gehört.«
»Ist auch einige Kilometer weiter weg und recht abgelegen. Aber auch auf einem kleinen Hof gibt es immer was zu tun. Besonders mit Tieren habe ich’s gern zu tun.«
Annelies Blick glitt immer wieder zu dem Fremden hin. Es war nicht zu leugnen, der junge Mann gefiel ihr. Er hatte eine stattliche Statur, eine gesunde Gesichtsfarbe und sah aus, als ob er was wegschaffen könne. Wenn er bei ihnen wohnen und tüchtig mit anpacken würde, wäre Wilhelm sicher zugänglicher, weil nicht mehr alles an ihm hängen blieb. Und er hätte endlich die Hilfe, die er sich so sehr wünschte. Auch dass dieser Jean so gesprächig war, fiel ihr angenehm auf.
»Zahlen kann ich nicht viel«, sagte Wilhelm jetzt. »Aber wir hätten eine Knechtkammer, da können Sie wohnen. Ist zwar einfach. Aber es ist alles da, was man braucht. Essen werden Sie natürlich bei uns mit am Tisch.«
»Selbstverständlich wasche ich Ihre Wäsche mit«, bot Annelie eifrig an.
»Das hört sich gut an.« Jean Margan biss herzhaft in das Brot mit der Blutwurst. Als ihre Blicke sich kreuzten, wurde ihr ganz heiß.
*
Er stieg die Treppe hoch und betrat den kleinen Raum, der ihm zugewiesen worden war. Besser als im Heuschober oder in einer Scheune war es hier allemal. Er drapierte seinen Rucksack und die Beutel mit seinen Habseligkeiten rund um den einzigen Stuhl. Ein schmales Bett aus dunkler Eiche mit hoher Kopflehne mit einer geschnitzten Rose darin stand an der Wand, die rot-weiß gewürfelte Bettwäsche war sauber und roch frisch gewaschen. Über dem Bett hing ein Wandbehang aus weißem Leinen, den zwei gestickte Engel zierten. Ein schmaler Schrank, eine Kommode, auf der eine Porzellanschüssel mit einem passenden Krug stand, waren die wenigen Möbelstücke neben dem Bett, dem Nachtschränkchen und dem Stuhl. Das Wasser für das Waschlavoir könne er sich aus der Küche holen, hatte die Bäuerin gesagt.
Bei dem Wort »Waschlavoir« musste er unwillkürlich grinsen. Die Nähe zum Nachbarland war nicht zu leugnen. Selbst der Opa hieß Jean.
Der Name Johannes hatte ihm nie gefallen, deshalb hatte er sich selbst den Namen Jean gegeben. Das klang doch gleich viel vornehmer. Er zog das rot-weiß-karierte Buschhemd aus und hängte es über den Stuhl. Dann schob er den Vorhang ein wenig zur Seite und sah zum Fenster hinaus. Das Haus auf der gegenüberliegenden Seite wirkte verlassen. Soweit er das in der Dunkelheit erkennen konnte, nahmen Hof und Wiese vor dem langgezogenen Gebäude mit Scheune und Stall viel Platz ein, ein zweiflügeliges Tor verschloss die Einfahrt. Links neben dem Hof schloss sich ein großer Garten an. So spät am Abend waren kein Mensch und kein Tier zu sehen.
Er hatte noch eine ganze Weile mit dem Bauern geredet unten am Tisch, während seine Frau hochgegangen war, um das Zimmer für ihn zurechtzumachen. Irgendwann waren sie auf Frankreich zu sprechen gekommen. Es sei sein favorisiertes Land, hatte er geantwortet. Er spreche die Sprache ganz gut und überlege, später einmal nach Frankreich zu ziehen. Das war nicht mal gelogen.
Der Blick des Bauern hatte Überraschung ausgedrückt. Zögerlich erwähnte er, dass er Frankreich in keiner guten Erinnerung habe, nachdem er mit seiner gesamten Heeresgruppe in der Normandie bei der Invasion der Alliierten in Gefangenschaft geraten war.
Hauptsächlich hatten sie sich jedoch darüber unterhalten, was er, Jean, künftig auf dem Hof tun solle und was man von ihm erwartete. Es klang nicht allzu schwierig. Das meiste war ihm vertraut und eine Zeitlang würde er das schon hinkriegen, ohne sich allzu sehr anzustrengen. Insgeheim beglückwünschte er sich zu dieser Idee, die ihm in dem Moment gekommen war, als die Kleine sagte, sie wohne auf dem Marienthalerhof. Dass alles so einfach sein sollte, dass man dort wirklich Hilfe brauchte, hatte er fast nicht zu hoffen gewagt. Doch nachdem er sich im Dorf umgehört hatte, stand sein Entschluss fest.
Er hatte eine sichere Unterkunft gefunden. Hier wurde er ordentlich verpflegt und man brachte ihm Respekt entgegen – so lange er sich an die Regeln hielt, das war ihm wohlbewusst. Er lachte leise in sich hinein.
Aus seinem Rucksack nahm er ein kleines schwarzes Büchlein und notierte ein paar Zeilen darin. Noch eine ganze Weile blieb er im Unterhemd am Fenster sitzen und starrte in die Dunkelheit. Alle möglichen Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Schließlich verlor er sich in irrigen Tagträumen. Noch eine Zigarette rauchte er. Danach machte er sich für die Nacht zurecht und legte sich ins Bett. Seine Gedanken hörten nicht auf, um die beiden Mädchen zu kreisen, denen er im Wald begegnet war. Dass die eine in unmittelbarer Nähe lebte, mit ihm unter einem Dach, erzeugte ein angenehmes Prickeln.
Er schlief ausnehmend gut in dem Bauernbett und erwachte ausgeruht und voller Tatendrang am nächsten Morgen. Schnell kleidete er sich an, rasierte sich sorgfältig, schüttete reichlich Rasierwasser in die hohle Hand und rieb sein Gesicht damit ein. Damit wollte er den strengen Gerüchen, denen man unweigerlich auf einem Bauernhof ausgesetzt war, etwas entgegensetzen. Er hatte eben ein feines Näschen, zog Wohlgerüche der Landluft vor.
Dann ging er die Treppe hinunter in die Küche. Dort wartete bereits das Frühstück auf ihn. Dicke Brotscheiben hatte die Bäuerin abgeschnitten. Butter und Marmelade standen dabei.
»Alles selbstgemacht. Auch die Butter stampfen wir selber.« Das klang stolz. »Seit mein Mann aus der Gefangenschaft wieder zu Hause ist, darf ich keine Margarine mehr auftischen.« Bei dieser Bemerkung kicherte sie wie ein junges Mädchen. »Glücklicherweise gibt so ein Bauernhof einiges her, der hat uns vor manchem bewahrt im Krieg, als ich ganz allein war mit der Kleinen«, erzählte sie leutselig und seufzte kurz auf. »Ich bin so froh, dass Sie zu uns gekommen sind. Hilfe können wir gerade jetzt im Moment wirklich gut gebrauchen.«
»Das freut mich.« Er beobachtete sie, wie sie mit flinken Schritten zum Herd lief. Sie war noch nicht alt, sehr schlank, um nicht zu sagen, dürr. Sicher war sie mal ganz hübsch anzusehen gewesen, aber jetzt wirkte sie ziemlich verhärmt in ihrer unförmigen geblümten Kittelschürze. Hat wahrscheinlich viel arbeiten und alles zusammenhalten müssen, als der Alte im Krieg und in anschließender Gefangenschaft war.
»Bohnenkaffee?«, fragte sie und hob die Kanne hoch, die auf der Herdplatte stand.
Er nickte freudig. »Oh ja. Gern.«
Sie goss eine dickwandige Porzellantasse voll. Stellte Milch in einem Kännchen daneben.
»Ist das Pflaumenmus?«, fragte er, als er die dunkelzähe Masse aus einem Glas löffelte, auf das gebutterte Brot strich und sofort hineinbiss. »Schmeckt hervorragend.«
»Ladwersch«, sagte sie lächelnd. »So heißt das bei uns.«
»Es ist schön, so verwöhnt zu werden«, erwiderte er kauend. »Nicht jeder ist so freundlich wie Sie.«
Er beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Sie wurde tatsächlich rot. Beugte sich über den Herd. Schob dort was zur Seite. Eine Reaktion, die ihm gefiel. Es hatte etwas Rührendes, auch, wie sehr sie sich bemühte, hochdeutsch zu sprechen.
»Ist Ihr Mann schon draußen?«, fragte er.
Sie nickte. »Der wartet im Stall auf Sie. Aber ich hab ihm gesagt, dass Sie erst mal richtig frühstücken müssen.«
»Dann beeile ich mich besser.« Er leckte die Finger ab, an denen noch das Pflaumenmus mit dem komischen Namen klebte.
Die Bäuerin sah auf die Wanduhr. Dann lief sie zum Radio, das auf dem Küchenbüffet stand. Ein braunes Gehäuse, stoffbespannt. Sie drückte auf eine der elfenbeinfarbenen Tasten, drehte an einem Knopf, ein grünes Licht leuchtete, dann ein Rauschen, ein Knistern, bis eine sonore Herrenstimme die Zeit ansagte.
»Ich mache immer die Nachrichten an«, sagte sie zu ihm. »Damit man auf dem Laufenden bleibt. Man muss schließlich wissen, was in der Welt vor sich geht.«
»Das ist nicht verkehrt.« Er stand vom Tisch auf, hob grüßend die Hand. Beim Hinausgehen hörte er Worte, die ihn kurz aufhorchen ließen.
»In einem Waldstück nahe Heiligenborn wurde am gestrigen Sonntag eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden, die bis jetzt noch nicht identifiziert werden konnte. Die junge Frau ist ungefähr zwanzig Jahre alt, womöglich auch jünger. Sie ist von schlanker Gestalt. Ihre Größe beträgt 1,55 Meter. Sie hat krauses dunkles Haar und blaugraue Augen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, auch noch so unscheinbare Beobachtungen der nächsten Polizeidienststelle mitzuteilen …«
Marienthalerhof Anwesen Liebold 3. Kapitel
Linde nahm ein nasses Wäschestück nach dem anderen aus der Brenk und klammerte es an der Leine fest, die entlang des Gartenpfades über der Rabatte mit den Federröschen gespannt war. Wie es sich gehörte, hängte sie Handtuch neben Handtuch, danach kamen die Geschirrtücher. Ordnung musste sein, das hatte ihr die Mamme von klein auf eingetrichtert. Viele Tücher waren aus handgewebtem Leinen und trugen in einer Ecke die Anfangsbuchstaben von Mutters Mädchennamen, säuberlich mit rotem Kreuzstich gestickt. Bis auf das große weiße Badetuch stammten sämtliche Tücher von Mutters Aussteuer. Da es für das Badetuch nicht mehr genügend Platz auf der Leine gab, ließ sie es vorerst in der Brenk liegen. Sie würde warten, bis kleinere Wäschestücke getrocknet waren und es später aufhängen.
Als sie eine von Mutters rosa Flanellunterhosen mit den angeschnittenen Beinen an die Leine klammerte, musste sie lächeln. Dagegen nahmen sich ihre weißen Baumwollschlüpfer geradezu zierlich aus.
Linde betrachtete ihre Unterhosen genauer, wendete sie, prüfte, ob alle Flecken raus waren. Die Mamme war da sehr empfindlich. Man muss immer ordentlich daherkommen. Egal ob drüber oder drunter. Seufzend stellte sie fest, dass in ihren Schlüpfern noch einzelne Schatten im Zwickel zu erkennen waren. Das würde der Mutter mit ihrem Adlerblick sicher auffallen.
Nach der Stallarbeit hatte sie den halben Morgen in der Waschküche gestanden, wie jeden Montag. Die Baumwollwäsche hatte sie in der Nacht zuvor in Seifenlauge eingeweicht, am Morgen wurde gerubbelt, gekocht und gestampft. Danach wurde alles klargespült und ausgewrungen. Mit den Wollsachen und feineren Stücken ging sie behutsamer um. Die Schleuder, die vor Kurzem angeschafft worden war, bedeutete eine große Hilfe, da kamen die Wäschestücke nicht mehr ganz so tropfnass auf die Leine und trockneten wesentlich schneller.
Drüben bei den Nachbarn öffnete sich die Haustür. Wilhelm Mosbach trat heraus, schirmte die Hand gegen die Sonne ab und ging über den Hof. Wieder einmal dachte sie daran, welches Glück Marlene hatte – ihr Vater war nach der Gefangenschaft aus dem Krieg nach Hause gekommen, im Gegensatz zu ihrem, Lindes Vater, von dem sie nur ein paar Feldpostbriefe erreicht hatten, nachdem er nach Russland abkommandiert worden war. Die Nachrichten von ihm waren mit der Zeit spärlicher geworden und irgendwann hörten sie und ihre Mutter gar nichts mehr von ihm. Dennoch klammerten sie beide sich an die Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehren würde. Hörte man doch immer mal wieder von späten Kriegsheimkehrern.
Plötzlich stutzte sie. Da lief ein junger Mann mit schnellen Schritten über den Hof direkt auf die Mistkaute zu. Hatten die Mosbachs einen neuen Knecht? Sie reckte sich ein wenig, um genauer sehen zu können, doch der Bursche war bereits im Stall verschwunden.
Sie bückte sich und hängte nun die Strümpfe auf, und zwar genau so, wie die Mutter es ihr beigebracht hatte: Paarweise, wobei die Fersen in die gleiche Richtung zeigten. Die Wäsche flatterte und verbreitete den Geruch von Kernseife. Dann ging Linde zurück ins Haus, wo ihr in der Küche die aufgestaute Hitze des Herdfeuers entgegenschlug.
Vor dem Wäschewaschen hatte sie Erdbeeren gepflückt, als es angenehm kühl draußen gewesen war. Mutter und Großvater waren derweil ins Heu gegangen. Auch Tante Resi, Mutters Schwester, war mitgekommen, um zu helfen, und Tante Gustchen sowieso, die treue Seele, die keine direkte Verwandte war, aber immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde.
Linde war froh, nicht in der Hitze das Heu zusammenrechen zu müssen, um dann verschwitzt, verstaubt und müde aus dem Feld heimzukehren. Auch wenn das bedeutete, dass sie heute allein die Wäsche hatte machen müssen. Und noch immer gab es eine Menge Hausarbeit zu tun.
Vor dem Mittagessen wollte sie Erdbeermarmelade kochen. Zwei große Emailleschüsseln voller reifer Früchte warteten darauf, verarbeitet zu werden. Genügend Zucker und Opekta hatte sie im Dorfladen besorgt.
Sie wusch die Erdbeeren, schüttete sie zum Abtropfen in ein Sieb, schnitt die grünen Blütenansätze weg und zerteilte sie. Das Waschwasser goss sie in einen Eimer, das würde sie zum Gießen im Garten verwenden. Den Fruchtbrei kochte sie unter stetigem Rühren auf und füllte ihn nach angemessener Zeit in die mit klarem, heißem Wasser ausgespülten Gläser.
Mit besorgtem Blick sah sie auf die Uhr. Mit dem Mittagessen würde sie sich beeilen müssen. Wenn die Helfer aus dem Heu kamen, brachten sie einen ordentlichen Appetit mit.
Schnell schnitt sie Zellophanfolie zurecht, die sie mit einem Gummiring auf den Marmeladegläsern fixierte.
Sie öffnete die Herdklappe, legte ein paar Scheite Holz nach und blies eine feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie schwitzte am ganzen Körper.
Immer wieder hatte Linde darauf gedrungen, einen Gasherd anzuschaffen, damit man im Sommer nicht ständig Feuer anmachen müsse. Das käme als nächstes dran, sobald sie was zusammengespart hätte, wurde sie nun schon eine Zeitlang von der Mutter vertröstet.
Linde war durchaus bewusst, wie knapp das Geld war. Ständig wurde betont, die magere Zuwendung, die Mutter vom Staat erhielt, reiche hinten und vorn nicht. Immerhin haben wir satt zu essen, meinte sie entschuldigend, sobald die Rede auf das fehlende Geld kam. Ja, das stimmte. Der kleine Bauernhof warf gerade mal so viel ab, dass sie nie Hunger leiden mussten. Gemüse und Obst bauten sie im Garten an, Kartoffeln im Feld. Und durch Eier- und Milchverkauf verdienten sie sich ein paar Groschen dazu. Auch während des Krieges und unmittelbar danach war das so gewesen. In Zeiten, als es anderen Menschen sehr schlecht ging, konnten sie auf die eigenen Vorräte zurückgreifen und hatten immer etwas Essbares zum Tauschen. Wie oft hatten Leute aus der Stadt bei ihnen vor der Haustür gestanden und gebettelt – Anna Liebold schickte niemanden weg, ohne ihm zumindest eine Kleinigkeit abzugeben. Weder Städter noch Bettler. Auch wenn sie von Städtern ansonsten wenig hielt.
Sie konnte so ein großes Herz haben, ihre Mamme. Doch manchmal machte sie Linde das Leben schwer. Stets wartete sie mit Vorschriften auf, wollte alles bestimmen. Gehorsam und Folgsamkeit, darauf bestand sie, seit Linde klein war. Darüber, was richtig und was falsch war, hatte sie oft eine ganz eigene Meinung, von der sie vehement ihre Umwelt zu überzeugen versuchte. Auch wenn nicht jeder auf sie hören wollte. Besonders Resi lachte laut auf, wenn die große Schwester sie zurechtweisen wollte. »Alles weiß sie besser. So war sie schon immer«, flüsterte Tante Resi dann in Lindes Richtung – und tat doch, was sie wollte.
Wenn Linde nicht sofort parierte – oder wenn es um Anschaffungen ging, ein neues Kleid, ein Paar Schuhe – solche Dinge brauchte der Mensch doch – da konnte die Mamme sich sehr stur stellen. Die Wäscheschleuder hatten sie sich nur deshalb zugelegt, weil Onkel Bernhard, Mutters und Resis Bruder, über Beziehungen verschiedene Gerätschaften wesentlich günstiger bekam als im normalen Handel.
Schon öfter hatte Linde überlegt, wie sie selbst etwas dazuverdienen könnte. Nach dem Volksschulabschluss hätte sie gern eine Lehre begonnen, wie ihre Freundin Erika, die als Bürokraft bei einer Futtermittelhandlung im Dorf untergekommen war. Von Erikas Chef war sie einmal gefragt worden, ob sie sich denn vorstellen könne, ihnen ab und an zur Hand zu gehen. Das sei oft nur stundenweise und würde gut bezahlt werden. Aber da war die Mamme energisch dagegen gewesen. »Als ob wir nicht genug Arbeit hätten. Soll ich denn alles allein machen, oder wie stellst du dir das vor, Kind?«
Damit war dieses Thema vom Tisch gewesen.
Nachdem Linde die Gemüsesuppe aufgesetzt hatte, ging sie nochmal hinaus in den Garten. Einige Wäschestücke waren bereits trocken, die nahm sie von der Leine und schaffte Platz für das große Badetuch, das noch nass in der Brenk lag.
Das Tuch war eine der Kostbarkeiten, die ihr Vater aus dem Frankreichfeldzug mitgebracht hatte. Zusammen mit Leinentischwäsche und verzierten Silberlöffeln aus einem richtigen Schloss. Wie er von der französischen Hauptstadt berichtete, diesen Klang hatte Linde noch immer in den Ohren, obwohl es schon so lange her war. »Die Stadt ist ein Traum, kann ich euch sagen, irgendwann, wenn wieder Frieden ist, fahren wir da mal alle zusammen hin. Wisst ihr, als Soldat sieht man was von der Welt. Unter dem Triumphbogen sind wir durchmarschiert. Den Eiffelturm hab ich gesehen und die Seine. Das ist der Fluss, der durch Parriss fließt.« Richtig geschwärmt hatte er von der französischen Hauptstadt, deren Namen er auf eigentümliche Weise betonte. Aufmerksam hatte sie damals seinen Worten gelauscht und ein sehnsüchtiges Ziehen in der Brust verspürt.
»Es ist wirklich eine ganz andere Welt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Untergebracht waren wir in einem schicken Hotel. Mit Badewanne und so einem komischen Wasch-Ding, das die Bidet nennen. Überall ist man uns freundlich begegnet. Ja, das war eine gute Zeit.«
Mit einem Seufzer nahm Linde das große weiße Tuch heraus, schlang es über die Leine und klammerte es an den Enden und in der Mitte fest. Dass ihr Vater ein tapferer Soldat war, bewiesen das Eiserne Kreuz I. und II. Klasse, die Nahkampfspange und das Sturmabzeichen, Auszeichnungen, die zusammen mit den Feldpostbriefen und wenigen Postkarten in einem Schuhkarton aufbewahrt wurden, der auf dem Kleiderschrank stand.
»Linde! Huhu!« Marlene kam mit ihrem braunen Lederschulranzen auf dem Rücken um die Kurve gebogen und winkte ihr zu. Die heraushängenden Tafellappen wippten, ihr Röckchen hüpfte auf und ab. Alles an ihr war in Bewegung. »Soll ich nachher zu dir rüberkommen?«
»Wenn du willst. Aber zum Spielen hab ich heute keine Zeit. Hab viel Arbeit.«
»Ich kann dir doch helfen.«
Linde lächelte nachsichtig. »Musst ja erst mal deine Hausaufgaben machen.«
Marlene war ein liebes Mädchen, das sie als Kleinkind oft gehütet hatte. Jetzt war sie ein Schulkind, so schnell verging die Zeit. Augenblicklich kam Linde die merkwürdige Begegnung gestern im Wald in den Sinn. Marlene war aber auch manchmal zu vertrauensselig. Das war nicht gut. Zwar hatte der fremde Mann durchaus nicht wie ein Sittenstrolch ausgesehen, vor denen stets gewarnt wurde, aber es war irgendwie komisch gewesen, wie er da plötzlich hinter der Hecke aufgetaucht war.
Linde fühlte sich ein wenig verantwortlich für das Nachbarmädchen. Sie war fast wie ein Geschwisterchen, das sie gern gehabt hätte.
Sie hörte ein leises Miauen. Mimi, ihre schwarzgescheckte Hauskatze, schlich sich heran, blieb abwartend mit erhobenem Schwanz stehen. Linde bückte sich und kraulte das zutrauliche Tier hinter den Ohren.
»Kriegst gleich was zu fressen«, sagte sie in beruhigendem Tonfall.
Das Tier hob den Kopf, dehnte den Körper und begann leise zu schnurren.
Kaiserslautern Polizeipräsidium 4. Kapitel
Arthur Bernstein musste sich zusammenreißen. Ein paar Mal war er bereits zusammengezuckt, weil ihm die Augen zuzufallen drohten. Die Tageshitze hing noch im engen Büro, dessen holzgetäfelte Wände mit Regalen voller Karteikästen, Registraturen und Aktenordnern vollgestopft waren. Seinen Hemdkragen hatte er aufgeknöpft und die Krawatte gelockert. Das Jackett hing über der Lehne des Schreibtischstuhls. Er strich sich durch das schüttere, ergraute Haar, erhob sich und ging zum Fenster. Als er einen Flügel öffnete, strömte ihm angenehm kühle Luft entgegen. Er beugte sich hinaus in die nächtliche Stille. Hinter den Silhouetten der Dächer war der Bahnhof mit seinen Gleisen zu erahnen, die in die weite Welt führten. Eine Welt, die die Deutschen vernichten und nach ihren Vorstellungen neu aufbauen wollten. Kurz erinnerte er sich daran, wie im Mai 1940 die ersten Luftangriffe auf Kaiserslautern niedergingen. Als der eigentliche Bombenkrieg im August 1941 begann, waren seine Familie und er schon längst nicht mehr in der Stadt.
Unauslöschlich hatte sich der 22. Oktober 1940 in sein Hirn eingebrannt, ein Datum, das er niemals vergessen würde. Mit dem Omnibus hatte man ihn und seine Familie in die Löwenburg hinter dem Bahnhof zu den Deportationszügen gebracht, nachdem am frühen Morgen Männer an ihre Wohnungstür geklopft und die Bewohner in barschem Ton aufgefordert hatten, innerhalb kürzester Zeit das Nötigste zusammenzupacken. Warum und weshalb, wurde ihnen trotz mehrfacher Nachfrage nicht mitgeteilt. Auch nicht, wohin die Reise gehen sollte.
Nur allzu deutlich erinnerte er sich an das ohnmächtige Gefühl, das ihn damals schier übermannte. Nicht mehr zu der richtigen, der gerechten Seite der Gesellschaft gehören zu dürfen, war eine äußerst schmerzliche Erfahrung. Tun zu müssen, wozu man von staatlichen Befehlshabern aufgefordert wurde, ohne sich irgendeiner Schuld bewusst zu sein, vor allem, ohne etwas dagegenhalten zu können, das hatte sich als tiefe Wunde in seinem Innersten eingeäzt. Allerdings musste er zugeben, dass er sich heute, nach allem, was passiert war, besser in Beschuldigte hineinversetzen konnte. Bevor er Menschen eines Verbrechens bezichtigte, prüfte er detailliert die genauen Umstände. Wusste er doch, wie schnell sich die Dinge ändern konnten, niemals waren sie ausschließlich schwarz oder weiß, vielmehr durchsetzt von vielen Grau- und Zwischentönen, die sich miteinander vermischten und ineinander verschwammen. Er hatte am eigenen Leib erfahren müssen, wie schnell sich Recht in Unrecht verwandeln konnte – und dass es durchaus Gründe gab, die einen Menschen auf die andere Seite des gerade herrschenden Gesetzes katapultieren konnten.
Er atmete ein paar Mal tief ein, vertrieb die unguten Erinnerungen und begab sich zurück zu seinem vor Akten und Papierstapeln überquellenden Schreibtisch.
Der Tatortbericht war noch nicht geschrieben. Dies musste er schleunigst nachholen. Die ersten Stunden nach einem Mord waren entscheidend, das war eine der wichtigsten Polizeiregeln, an die er sich stets hielt. Da es durchaus sein konnte, dass sich der Täter noch in der Nähe aufhielt, hieß es, sich beeilen. Deshalb war sofort am gestrigen Sonntag ein Funkspruch an alle Kriminalstellen Deutschlands mit der genauen Beschreibung der unbekannten Toten durchgegeben worden. Am Morgen hatte er seine Sekretärin instruiert, die Vermisstenanzeigen zu durchforsten. Doch bisher gab es nicht den geringsten Hinweis, wer die Tote sein könnte.
Bevor er ein Blatt Papier in die Schreibmaschine spannte, schaltete er das Radio ein. Leise klassische Musik ertönte. Dann begann er zu tippen.
»Unbekannte Frauenleiche in den Mittagsstunden des gestrigen Sonntags von Spaziergängern in einer Waldlichtung bei Heiligenborn aufgefunden …«
Das Maschineschreiben, das er leidlich beherrschte, hatte sich schon manches Mal als Segen erwiesen. Gut, dass er darauf bestanden hatte, das klapprige Vorkriegsmodell, das im Büro vorhanden war, durch ein neues modernes auszutauschen, wofür ihm Fräulein Scheuermann äußerst dankbar war. Überhaupt erledigte seine Sekretärin alle ihr aufgetragenen Aufgaben hervorragend, jedoch Tatortberichte schrieb er gern selbst, auch, weil ihm manches Wichtige oftmals während des Tippens einfiel oder nachdem er in seinem Notizbuch geblättert hatte und alles nochmal Revue passieren ließ.
Die dezenten Klänge aus dem Radio gaben ihm ein wenig das Gefühl, sich in angenehmer Gesellschaft zu befinden. Das Radio war der erste Luxusartikel, den er selbst gekauft hatte, als er dieses Büro bezog. Eine wichtige Anschaffung für ihn allein schon deshalb, weil Juden während der Nazizeit als potentielle Staatsfeinde keine Radios besitzen durften.
So spät am Abend war es im Polizeigebäude ruhig. Im Grunde mochte er diese Zeit, wenn er vor Störungen einigermaßen gefeit war, weil niemand einfach hereinplatzte, Fernschreiber und Telefon stillstanden und er während seiner Arbeit ein Gläschen seines guten französischen Cognacs genießen konnte.
Mit einigem Unbehagen dachte er an seinen neuen jungen Kollegen, der ihm kürzlich zur Seite gestellt wurde. Frisch von der Polizeischule kam dieser Schulz. Übereifrig mit seinem zackigen Gehabe ging er Bernstein gehörig auf die Nerven.
Schulz war in seinen Augen einer, der offensichtlich immer noch nicht verstand, dass sich die Zeiten geändert hatten, und zwar gründlich. Sonst wäre er, Arthur Bernstein, ganz sicher nicht nach Deutschland zurückgekehrt und hätte seinen Dienst bei der Kripo wieder antreten können. Obwohl er wusste, dass ein schweres Stück Arbeit vor ihm lag und er weiterhin gegen Widrigkeiten und Unvernunft würde ankämpfen müssen. Die Kriegsjahre, insbesondere die Nachkriegsjahre hatten den ehemals heißblütigen, stets Gerechtigkeit einfordernden Jungpolizisten, der er vor der Machtergreifung der Nazis war, zu einem besonnenen Kriminalisten geschliffen.
So etwas Ungeheuerliches wie dieser Nazi-Ungeist durfte nie wieder auferstehen, dafür war er bereit, sich mit aller Kraft einzusetzen. Dass es noch allzu viele gab, die Adolf Hitler nachtrauerten, damit wurde er tagtäglich konfrontiert. Aber da waren auch glücklicherweise die anderen, wie sein Chef Helmut Kramer, der aus ähnlichem Holz geschnitzt war wie er. Kramer, ein fachlich versierter Gendarm von der Pike auf, hatte bereits im ersten Weltkrieg gedient. Dessen größtes Problem war gewesen, sich nicht unterordnen zu können, was während der Naziherrschaft mit ihrem Befehlsgehorsam gar nicht gern gesehen wurde. Aus diesem Grund war er nach der Machtübernahme zeitweise vom Dienst suspendiert worden, »beurlaubt«, wie es euphemistisch hieß. Später stellte sich heraus, dass er von einem Kollegen denunziert worden war. Nach dem Krieg war Kramer aufgrund seines widerständlerischen Denkens von der amerikanischen Militärverwaltung als Leiter der Kriminalpolizei eingesetzt worden. Er tat sich zwar noch immer schwer, sich Befehlen von oben unterzuordnen, aber er war ein äußerst loyaler Chef. Ein erfahrener Polizeipraktiker. Insbesondere in der kriminalistischen Spurensuche war er versiert. Nicht nur durch dieses fundierte Fachwissen unterschied er sich von den meisten der eilig von den Besatzern eingesetzten Polizeibeamten, denen oftmals die notwendige Schulung fehlte.
Bernstein hatte es einige Genugtuung bereitet, dass man ihn, den Juden, den man einst aus dem Dienst gejagt hatte, zurückgeholt und ihm einen wichtigen Posten im Kriminalkommissariat anvertraut hatte. Dabei konnte es als Wunder angesehen werden, dass er überhaupt noch am Leben war. Wie viele Männer seines Alters waren im Krieg umgekommen oder in einem der zahlreichen Lager getötet worden. Auch sein Vater, sein großes Vorbild und ebenfalls Polizist, hatte die Deportationen nicht überlebt. Wie seine Frau, Bernsteins Mutter, ist er während der rechtlosen Zeit getötet worden. Irgendwo hatte man ihre Leichen verscharrt. Es gab kein Grab, das er besuchen konnte. Kein Ort, um zu trauern.
Nun herrschte glücklicherweise ein anderer Geist in Deutschland: Hier in Kaiserslautern hatten sowohl die Amerikaner als auch die Franzosen gründlich deutsche Behörden durchkämmt und sofort nach dem Krieg Entlassungen angeordnet. Gegen etliche, die bei der Gestapo waren, hohe Funktionen innehatten oder irgendwie politisch negativ aufgefallen waren, hatte man strafrechtlich ermittelt. Allerdings schienen neun erfolgte Verurteilungen bei einer Zahl von mehreren hundert Mitarbeitern der Polizeidirektion und Gendarmerie ziemlich wenig. Sicher hatten einige, die an den Verbrechen und Vergehen beteiligt waren, den Krieg nicht überlebt. Aber nachweislich war eine größere Anzahl von Polizeibeamten aktiv an den Verbrechen beteiligt gewesen und von nicht wenigen war bekannt, dass sie schnell ihre Uniformen entsorgten, Parteiabzeichen und verräterische Dokumente vernichteten. Zwielichtige Charaktere, die ihre politische Vergangenheit nach außen hin verschwiegen, Legenden streuten, um möglichst unauffällig durch die neue Zeit zu kommen und im Grunde dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten, gab es genug.
Das größte Manko war, dass durch die Säuberungen insbesondere bei der Kripo gute Leute fehlten. Die meisten der Neulinge waren lediglich eilig ausgebildete Kriminalisten, die weder viel von der realen Polizeiarbeit verstanden noch vom Leben überhaupt etwas wussten. Hinzu kam, dass etliche Angeber und Wichtigtuer die Gunst der Stunde nutzten, wie dieser Schulz, der ihm zuarbeiten sollte. Obwohl er mit seinem kurzgeschorenen akkurat gescheitelten Haar eher einem Pennäler ähnelte, hatte er sich bis jetzt vornehmlich durch kraftmeierndes Getue und heiße Luft hervorgetan. So wie dieser Adlatus ihn manchmal ansah, war ihm sicher zu Ohren gekommen, dass Bernstein kein »reinrassiger Arier« war. Zumal die Gerüchteküche wie eh und je funktionierte. Die Vorurteile gegen »den Jud« waren tief in den Köpfen der Menschen verankert, da machte er sich nichts vor.
Nachdem er einen guten Schluck Cognac genossen hatte, tippte er den Tatortbericht weiter.
Bernstein war einer der ersten am Fundort gewesen, einer moosbewachsenen Waldlichtung, umrandet von einer Brombeerhecke. Der Anblick des geschundenen Frauenkörpers hatte ihn unwillkürlich zusammenzucken lassen. Obwohl er im Laufe seines Lebens sowohl in Kriegszeiten als auch als Polizist in der Nachkriegszeit nicht gerade wenige Leichen zu Gesicht bekommen hatte, war er über den Zustand dieser jungen zierlichen Frau mit den zahlreichen Hämatomen auf dem halbnackten Körper und dem geschwollenen, blutverschmierten Gesicht erschrocken gewesen, Verletzungen, die keinen Zweifel von dem Leiden vor ihrem gewaltsamen Tod offen ließen. Die blassen, quer über den Hals verlaufenden parallel liegenden Streifen könnten auf Erwürgen deuten, hatte der Arzt gesagt.
Sofort hatte er das Geschehen vor sich gesehen, wie ein muskulöser kräftiger Mann über das gerade mal 1,55 Meter kleine und noch nicht mal fünfzig Kilo wiegende Persönchen herfiel, das vielleicht neunzehn oder zwanzig Jahre alt sein mochte. Die heruntergerissene Kleidung ließ auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um ein Notzuchtverbrechen handelte. Der Täter hatte es allerdings auch auf ihre Barschaft und ihren Schmuck abgesehen. So verwies eine Einkerbung im linken Ringfinger darauf, dass hier offensichtlich ein Ring fehlte. Außerdem war ihr leeres Portemonnaie in unmittelbarer Nähe aufgefunden worden. Etwas weiter entfernt sammelten die Spezialisten der Spurensuche die Schuhe der Toten ein, die verstreut im Gebüsch lagen, robuste braune Schnürschuhe mit halbhohen Absätzen.
Sofort hatte am Tatort die kriminalistische Kleinarbeit begonnen. Der bullige Feller vom Erkennungsdienst war mit stoischer Miene mit seinem Maßband um die Leiche herumgegangen, kratzte beständig seinen Stiernacken und bemerkte schließlich, dass die Fußspuren was hergeben könnten. Danach hatte er die Fingerspitzen der Toten mit Pottasche, Graphit und Kohle beschmiert. Auf diese Weise erhielt man exakte Fingerabdrücke, die bereits weitergeleitet worden waren, um sie mit der deutschlandweiten Vermisstendatei abzugleichen.
Bernstein überflog das bisher Geschriebene und ergänzte es mit seinen Notizen. Nur allzu deutlich sah er wieder vor sich, wie die halb entkleidete Leiche voller Hämatome und Schürfwunden dort zwischen Moos und Farn gelegen hatte, wie hingeworfen. Als er den zerrissenen Unterrock hochhob, der voller Blutflecken war, erkannte er, dass das Blut offenbar von heftigem Nasenbluten stammte, das der Täter offensichtlich versucht hatte, mit dem Unterrock wegzuwischen. Doch es waren hauptsächlich die gebrochenen, leeren Augen der jungen Frau, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gingen.
»Wer bist du, Mädchen? Was hat man dir angetan und warum?«, murmelte er halblaut vor sich hin. Er spürte, wie eine Erregung in ihm hochkroch. Die Errgung des Jägers, der unbedingt seiner Beute habhaft werden will, um sie hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ihm war durchaus bewusst, dass er mit jedem neuen Fall, dessen Aufklärung er sich auferlegte, weiter in ein Mysterium vorstieß, sich dem Unerklärlichen ein Stück weit zu nähern, das Menschen dazu brachte, ihresgleichen zu vernichten.
So wie er einst hatte vernichtet werden sollen.
Marienthalerhof Anwesen Liebold 5. Kapitel
Nachdem sie das Geschirr gespült hatte, trocknete sie es mit einem Küchentuch ab und verstaute alles im Büffet mit den Glasfensterchen, das noch von ihrer Großmutter stammte. Über die stattliche Anzahl Marmeladengläser, die sie auf der Zwischenablage aufgereiht hatte, freute sie sich. Mamme hatte lediglich einen kurzen Blick drauf geworfen, gesagt hatte sie nichts. Gelobt schon gar nicht. Dabei hätte sich Linde so sehr ein Lob aus ihrem Mund gewünscht, doch ein solches kam ihrer Mutter so gut wie nie über die Lippen.
Linde packte die Erdbeermarmelade in einen Korb und trug ihn hinunter in den Keller, wo sie die Gläser zu den Einmachgläsern im alten Küchenschrank mit dem Fliegengitter verstaute.
Ihre Vorräte konnten sich wirklich sehen lassen, darauf war sie ein bisschen stolz. Es war schon erstaunlich, was ein Garten hergab. Oder die Natur draußen vor der Tür. Marmelade und Gelee waren ihre Spezialität. Nie wäre ihr oder ihrer Mutter in den Sinn gekommen, welche im Laden zu kaufen.
Als sie vom Keller hochkam, nahm sie den Besen und fegte den Küchenboden. Das Fenster stand weit offen, Sommerluft wehte herein. Ihr Blick schweifte hinaus in den Garten. Der Garten, das war ihr Reich und ihr ganzer Stolz. Schon so mancher hatte ihren grünen Daumen bewundert. Tante Resi sparte jedenfalls nicht mit Lob, darüber freute sie sich ganz besonders. Überhaupt war Mutters Schwester so ganz anders als Mamme und so manches Mal schon waren Linde Zweifel gekommen, ob die beiden tatsächlich leibliche Schwestern waren. Der blonde Bernhard und die ebenso blonde Anna glichen einander in gewisser Weise, während die dunkelhaarige Resi irgendwie aus der Art geschlagen schien. Dies betraf nicht nur ihr Aussehen, sondern ihr gesamtes Wesen.
Das Haus, in dem Linde seit ihrer Geburt mit der Mutter lebte, hatte ihr Vater mit eigenen Händen gebaut. Es war auf einem Grundstück errichtet, das Vaters Eltern gehörte und bestand aus Sandstein, der im Winter die Kälte draußen ließ und im Sommer die Hitze. Manchmal sagte Mutter mit traumverlorenem Blick: »Dein Babbe hockt in allen Ecken.«
Glücklicherweise waren der Marienthalerhof und auch das Dorf weitgehend von den Auswirkungen des Krieges verschont geblieben. Im Gegensatz zum nahen Kaiserslautern, wo noch immer viele Trümmergrundstücke das Stadtbild bestimmten. Das Grollen der tieffliegenden Jabos war zwar öfter zu hören gewesen, besonders im letzten Kriegsjahr, dann sind sie alle schnell rüber in Weingarts Gewölbekeller gerannt. Dort hatten sie zusammen mit den Nachbarn zwischen Kartoffeln und Einmachgläsern gesessen und gewartet, in der Hoffnung, dass bald alles vorüber war und man wieder an die Arbeit gehen konnte.
Linde ließ ihren Blick durch die Küche schweifen. Neben dem Büffet stand ein hoher Blumenständer mit einem Asparagus, von dem Mutter behauptete, er sei so alt wie sie, Linde. Seine zarten Ranken berührten fast den Boden. Links vom Herd vor dem Fenster befand sich der Spülstein. Daneben an der Wand hing das von Großmutter Katharina bestickte Tuch mit dem Spruch Ohne Fleiß kein Preis. Dahinter verbargen sich die Geschirrtücher. Auf einem kleinen Bord darüber befanden sich drei Porzellangefäße mit den Aufschriften »Soda« »Seife« »Sand«. In den Behältern war jedoch nicht das, was darauf stand, wobei Linde sich noch immer über die Aufschrift »Sand« wunderte. Wahrscheinlich war damit Scheuersand gemeint, mit dem man früher das Besteck putzte. Heute verwendete man Ata dafür, das Paket wurde unter dem Spülstein aufbewahrt.
In dem einen Gefäß war Krimskrams, Sicherheitsnadeln und Gummiringe, im anderen befanden sich Münzen. Damit man das nötige Kleingeld zum Herausgeben parat hatte, wenn Leute aus dem Dorf Eier kauften oder kuhwarme Milch.
Als sie die Haustreppe hinunterging, drehte sich ihr Kopf fast automatisch hinüber zum Nachbarhaus. Drüben spielte Marlene mit ihrem Ball. In regelmäßigen Abständen bückte sie sich, hob den roten Gummiball auf und warf ihn gegen das Scheunentor, wo er sofort zurückprallte. An der Mistkaute stand der fremde Mann, den sie schon ein paar Mal durch den Hof hatte huschen sehen und von dem sie annahm, dass das der neue Knecht der Mosbachs war. Er schien Marlene zu beobachten, dann ging er auf das Mädchen zu, das ihm freudig entgegenlief.
Linde öffnete die Tür zur Futterküche, die durch eine Holzschiebetür vom Stall getrennt war. Sofort ertönte lautes Gepiepse. Das Schwalbennest, ein kunstvoll gebautes Gebilde aus Lehm , Grashalmen und Stroh war – wie in jedem Winter – verwaist gewesen. Sie freute sich darüber, dass die Vögel auch diesmal zurückgekommen waren und sich dort wieder eingenistet hatten, um zu brüten. Inzwischen waren die Kleinen ausgeschlüpft und taten lautstark ihren Hunger kund. Gerade kam die Schwalbenmutter angeflogen, schob das mitgebrachte Futter in eines der weit geöffneten Schnäbelchen, um sofort wieder rauszufliegen. Vier Vögelchen hatte Linde gezählt. Da hatte die Mutter allerhand zu tun, ihren Nachkömmlingen die hungrigen Mäulchen zu stopfen. Das war der Lauf des Lebens: Alte zeugten Junge und zogen sie auf, bis sie imstande waren, selbst auf sich aufzupassen und ihr eigenes Leben zu leben. Nicht viel anders als bei den Menschen.
Ob in jedem Jahr dieselben Schwalben wiederkamen, wagte Linde zwar zu bezweifeln, aber woher wussten sie sonst so zielsicher, dass ihr Nest sich in der Lieboldschen Futterküche befand?
Später am Abend, als alle Arbeit getan war, sperrte sie die Hühner ein. Dabei achtete sie darauf, den Hühnerstall besonders sorgfältig zu verschließen. Es gehe ein Marder um, hatte die Mamme gesagt. Der habe bereits mehrere Hühner in den Nachbarhöfen gerissen und ein wahres Blutbad hinterlassen. Marder passten durch kleinste Öffnungen. Schon mehrmals hatte sie ein Tier in der Dämmerung ums Haus schleichen sehen. Erst hatte sie gedacht, es sei eine Katze, doch inzwischen kannte sie die Unterschiede. Der Körperbau eines Marders war länger und schlanker als der einer Katze, die Gliedmaßen verhältnismäßig kurz und sein Schwanz war lang und struppig. Der sollte keine Gelegenheit bekommen, sich an ihren Hühnern zu vergehen. Dafür würde sie sorgen.
Drüben bei den Mosbachs lief der neue Knecht mit schnellen Schritten über den Hof direkt auf den Hauseingang zu. Marlene war offenbar schon ins Haus gegangen. Ihr roter Ball lag vor dem Scheunentor. Als der fremde junge Mann die Treppe betrat, stutzte sie. War das nicht dieser Jean, den sie und Marlene am Sonntag im Wald getroffen hatten? Doch bevor sie sicher sein konnte, war er bereits in der Haustür verschwunden.