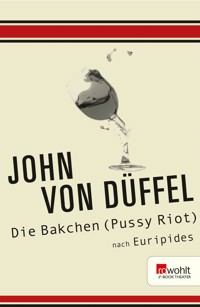12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Brust, Kraulen, Schmetterling – die Schwimmstile sind so zahlreich wie die Schwimmertypen: ob man sich eher passiv treiben lässt, heroisch die Fluten durchkämmt oder elegant durch schimmerndes Türkis gleitet. John von Düffel widmet sich nicht nur der praktischen Seite, den Techniken und der Ausrüstung, sondern auch der philosophischen Ausprägung des Sports. Er beschreibt die Ambivalenz des Wassers, die Geborgenheit, die es ausstrahlen, aber auch die Bedrohlichkeit, die ihm innewohnen kann; das Spielerische und das Kämpferische. Humorvoll und ganz in seinem Element berücksichtigt er die gesundheitlichen Aspekte und zeichnet feine Charakterstudien. Ein wunderbares Buch für ehrgeizige Sportler, Gesundheitsbewusste, Wasserratten und Genießer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wann immer du schwimmst – es gibt keinen Zweifel,
dass du das Richtige tust!
Ohne Gewähr
ISBN 978-3-492-97307-6
Mai 2016
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2016
Redaktion: Matthias Teiting, Dresden
Coverkonzept: Büro Hamburg
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Covermotiv: Alberto Guglielmi/Plainpicture (Tauchen im Meer von L'Asinara)
Datenkonvertierung: le-tex publishing servics, Leipzig
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Eintauchen
»Was fasziniert Sie eigentlich so am Wasser?«, lautet die meistgestellte Frage in meinem Leben. Inzwischen habe ich mir angewöhnt, die Gegenfrage zu stellen: »Wie viel Zeit haben Sie?« Denn die Antwort ist nicht nur abendfüllend, sondern genau genommen lebenslang. Die Faszination des Wassers hört nicht auf, sie verwandelt und verändert sich, je nachdem, auf welches Meer man schaut, mit welchem Fluss man geht, in welchem See man schwimmt. Und während ich versuche, all das zu beschreiben, verändert sich auch das Gefühl, das mich bei der Frage im ersten Moment immer beschleicht, diese leichte Beschämung, irgendwie anders zu sein als die anderen, ein Wassersüchtiger, halb Mensch, halb Fisch, ein Lungenflossler, ein »Waterholic« oder »Aqua-Nerd«. Nein, denke ich, während ich mir beim Antworten zuhöre, nicht ich bin der Außerirdische oder das seltene Tier im Zoo, sondern derjenige, der die Faszination des Wassers nicht kennt. Wir leben auf dem Blauen Planeten. Alles Leben hier gibt es, weil es Wasser gibt. Und wenn auf anderen Sternen nach Spuren von Leben gesucht wird, sucht man nach Spuren von Wasser. Unser Heimatstern trägt einen falschen Namen. Das Besondere an der Erde ist nicht die Erde, sondern das Wasser und das Leben, das daraus hervorgegangen ist. Die Erde ist ein Wasserplanet. Was kann es Faszinierenderes geben als unser Lebenselement?
»Und was«, lässt die zweitmeistgestellte Frage nicht lange auf sich warten, »was fasziniert Sie am Schwimmen?« – Etwas weniger höflich formuliert, heißt das so viel wie: »Schwimmen kostet doch eine Menge Überwindung, es ist langweilig, ungesellig, einsam und die meiste Zeit des Jahres ziemlich kalt – warum tun Sie sich das an?«
Das Problem bei dieser zweiten Frage ist, dass es viele Antworten darauf gibt, von denen keine ganz richtig und keine ganz falsch ist. Schwimmen ist gesund, vielleicht die gesündeste Sportart überhaupt, aber Kniebeugen sind auch gesund, und niemand »liebt« Kniebeugen. Schwimmen ist ein guter Ausgleich bei Stress und Ärger, eine meditative Übung, gut fürs seelische Gleichgewicht, aber bis man sich aufgerafft hat und am Wasser ist, bis man das Meer, den See, das Schwimmbad erreicht hat, in dem es eine Lust wäre loszuschwimmen, kommen wiederum allerhand Stress und Ärger zusammen. Und regelmäßig schwimmen zu gehen, täglich oder jeden zweiten Tag, hat den Nachteil aller guten Vorsätze, dass man sie nach einer Woche schleifen lässt, um sie dann sang- und klanglos wieder aufzugeben.
Körpergefühl, Gesundheit, Wohlbefinden, seelischer Ausgleich, inneres Gleichgewicht – oder neudeutsch: Wellness und Fitness, Training und Meditation –, all diese Aspekte lassen das Schwimmen als eine ideale Methode zur »Selbstoptimierung« erscheinen, als die perfekte Leistungssteigerungsstrategie. Und als solche kann man das Schwimmen auch betreiben. Allerdings hat es dann kaum mehr Charme als der Gang ins Fitness-Studio. Faszinierend ist etwas anderes. Faszinierend – wirklich faszinierend – wird das Schwimmen dadurch, dass es die sinnlichste, unmittelbarste, umfassendste Art ist, dem Wasser nahe zu sein, hautnah.
Darum wird es in dieser Gebrauchsanweisung fürs Schwimmen gehen: Es ist eine Schwimmermutigung, ein Schwimmratgeber und Erfahrungsaustausch über Tipps, Tricks und Tücken, eine Schwimmgeschichte von einem, der viele Jahre seines Lebens im Wasser verbracht hat. Doch vor allem geht es um diese Nähe: um das Gespür für Wasser, um die Faszination für dieses Lebenselement und darum, es sich zu erschwimmen und teilzuhaben an der Ursprünglichkeit und Größe, die ihm innewohnt. Es geht um eine Gebrauchsanweisung fürs Wasser.
TEIL I Das Gespür für Wasser
Wasserscheu
Wer von der Faszination des Wassers erzählt, kommt leicht ins Schwärmen. Beim Blick auf einen stillen See, beim Betrachten eines Flusses, der Wirbel und Quirle, die sich über seine Oberfläche breiten, beim Hinausschauen auf das Meer und den steten, erinnernden Gang der Wellen ist es nicht einfach, einen trockenen Ton zu wahren. Jeder Wassertext neigt zur Hommage, zur Liebeserklärung an das flüssige Element.
Doch die Liebe zum Wasser sollte nicht blind machen. Ein reines Loblied, eine Wasserhymne wäre nur die halbe Wahrheit. Denn zur Schönheit des Wassers gehört seine Gefährlichkeit, und zur Faszination des Wassers gehört die Angst vor der Tiefe, der Kälte, dem Tod. Das Wasser ist immer beides: Geborgenheit und Bedrohung, das Tragende und das Bodenlose, das Heimische und Unheimliche. Die Ambivalenz ist sein Wesen. Wasser ist immer anders, zu jeder Stunde an jedem Tag. »Man steigt nie zweimal in denselben Fluss«, dieser Satz von Heraklit darf in keinem Wassertext fehlen, nicht nur weil, wie er sagt, »alles fließt«, sondern weil das Sich-Spüren im Wasser ein Ich-Gefühl inmitten größter Ungewissheit ist. Für die alten Griechen war der Meeresgott Proteus zugleich der Gott der Verwandlung, ein Meister der Metamorphosen. Und das Wasser ist sein Element, das Element des Lebens, aber auch des Todes.
Die Scheu vor dem Wasser ist also keine Phobie oder Schwäche. Sie ist eine uralte, eine heilige Scheu im Wissen um die Macht des Wassers. Wer davor keine Angst und Ehrfurcht empfindet, hat das Element nicht verstanden. Doch das tut seiner Faszination keinen Abbruch. Manchmal glaube ich, dass ich mich vom Wasser nur deshalb nicht losreißen kann, weil bei aller Vertrautheit und Verbundenheit mit dem Element die Angst nie ganz verschwindet.
Ich schwimme seit meinem fünften Lebensjahr, seit fünfundvierzig Jahren, fast täglich – mit einer längeren Unterbrechung, als ich nach einer ambitionierten Phase des Vereins- und Leistungsschwimmens wieder lernen musste, nicht um Bestzeiten, sondern um des Wassers willen zu schwimmen. Eine gewisse Scheu ist geblieben, ein Gefühl der Unsicherheit im Moment des Wechsels von einem Element ins andere. Vielleicht schwimme ich deshalb beinahe jeden Tag, um diese Scheu nicht zu groß werden zu lassen. Denn gegen die Angst vor dem Wasser hilft am ehesten die Gewohnheit, das fraglose Immer-wieder, die Routine der Abläufe und Wege, die keine Lücke lässt für den Zweifel, fürs Zögern. Umzukehren ist keine Option, kein Gedanke. Es gibt kein Zurück.
Auch in dieser Hinsicht hat das Wasser zwei Gesichter: eines der Vertrautheit und ein anderes der Fremdheit. Manchmal liegt der See, in den ich während der wärmeren Jahreszeiten jeden Tag steige, unverwandt da. So als würden wir uns nicht kennen. So als wäre ich nie da gewesen. Doch ich gebe diesem Fremdeln nicht nach, sondern stelle mein Fahrrad genau da ab, wo ich es immer abstelle, ziehe mich genau so um, wie ich mich immer umziehe, und gehe wie in meinen eigenen Fußspuren das Ufer hinunter ins Wasser. Nicht einmal dann, wenn es sich um meine Hüften wellt und aufschwappt, halte ich inne und reiße die Arme hoch. Ich gehe weiter, tiefer hinein in den See und schwimme. Wie jeden Tag, wie immer. Wiederholung schafft Sicherheit, auch wenn diese Sicherheit eine vermeintliche, vielleicht sogar trügerische ist, denn das Wasser ist immer anders, und nur weil es mir gestern gut war, heißt das nicht, dass es auch heute so sein wird. Wir steigen nie zweimal in denselben Fluss. Aber wir kehren immer zum Wasser zurück.
Überwindung
Der Trick des Gewohnheitsschwimmers besteht darin, den Moment der Überwindung zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es ihn gar nicht. Doch es gibt ihn. Seine Realität ist nicht zu leugnen, und die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Selbstverständlich kennt auch der passionierteste Schwimmer die Annehmlichkeiten und Beharrungskräfte des An-Land-Seins, der großen irdischen Komfortzone, wo es warm ist, gemütlich und sicher. Er kennt den inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt, den Ruck, den man sich geben muss, die Schwierigkeiten, sich aufzuraffen, die beim Schwimmen größer sind als bei vielen anderen Aktivitäten. Denn man hat es nicht nur mit den üblichen Trägheitswiderständen zu tun. Wer ins Wasser geht, muss einen nicht zu unterschätzenden Übergang bewältigen, eine Transformation vom Festen ins Flüssige, vom Verlässlichen ins Unwägbare, von einer Existenzform in die andere.
Motivationshilfen sind dabei gefragt, vor allem wenn das Wetter nicht gerade zu Schwimmausflügen einlädt. Eines der wirksamsten Überwindungsmantras an den nicht so sonnigen Tagen ist für mich der Satz: »Nachher fühlt man sich immer besser.« Und das Beste an diesem Satz ist, er stimmt. So widrig die Umstände auch sein mögen und so gut die Gründe, an Land und trocken zu bleiben, wann immer ich mich überwinde und zum Schwimmen durchringe: Nachher fühle ich mich besser (oft sogar umso besser, je hartnäckiger ich mich vorher gesträubt habe).
Im Grunde spannt sich zwischen diesen zwei Momenten der gesamte Bogen eines Schwimmerschicksals, zwischen dem Stoßseufzer beim Hineingehen »Warum tu ich mir das an?« und dem Glücksgefühl danach, wenn man wieder am Ufer steht und sich wundert: »Warum machen das eigentlich nicht alle jeden Tag?« Zumindest wurde ich vom Wasser jedes Mal für die Überwindung zum Schwimmen belohnt. Manchmal habe ich danach sehr gefroren, manchmal war ich danach sehr erschöpft. Aber ich habe mich immer zutiefst besser gefühlt.
Die Kälte
Warum kostet es eigentlich so viel Überwindung, ins Wasser zu gehen? Die fühlbarste und empfindlichste Hemmschwelle beim Schwimmen ist der Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser, auf gut Deutsch: die Kälte. Zumindest in unseren Breiten ist das Wasser in der Regel kälter als die Luft und alles andere als badewannenwarm (mit Ausnahme von ein, zwei Wochen im Jahr). An heißen Hochsommertagen wirkt genau das erfrischend, an allen anderen Tagen nicht.
Das heißt: Wer schwimmt, der friert – hierzulande, hierzuwasser, früher oder später, sofern er draußen schwimmt. Wehmütig mag man an die Zeit im Herbst denken, in der die Nächte schon empfindlich kühl sind, die Wassertemperaturen aber noch sommerlich warm, sodass frühmorgens der See dampft und Wärmenebel sich über der Wasseroberfläche kräuseln wie Rauch. Man mag davon träumen, in dieses Dampfbad zu steigen, Nebelbänke zu durchschwimmen und von der Mitte des Sees aus die verhangene Uferlandschaft zu betrachten. Und bei all dem ist das Wasser so warm. Die klamme, kühle Feuchtigkeit, die einen beim Umkleiden angefasst hat, ist schnell abgestreift. Man beeilt sich, ein- und unterzutauchen, wirft sich in seine Züge und hüllt sich in den See wie in einen Mantel, während man eine verwandelte Welt durchschwimmt, in der sogar das vertraute Ufer geheimnisvoll wirkt, Bäume und Büsche sich zu Phantasiegebilden formen, bis sie allmählich ihre gewohnte Gestalt wieder annehmen. Und immer noch mag man das Wasser kaum verlassen, weil es die wärmste Stelle in dieser Herbstlandschaft ist.
Doch das sind Schwimmerlebnisse mit Seltenheitswert. Denn die Tage werden kürzer. Schon sind die Sonnenstände zu niedrig, die Sonnenstunden zu wenige, um diese verkehrte Wärmewelt aufrechtzuerhalten. Unaufhaltsam verströmt das Wasser den Sommer, den es gespeichert hat. Immer größere Kältepfützen breiten sich über die Oberfläche, und aus der Tiefe drängt kühles, lichtloses Wasser herauf. Die ersten Frostnächte ziehen die Restwärme aus dem See, und bald liegt er still und ohne Nebelfahnen da, kaltes, dunkelklares Winterwasser.
Es bleibt dabei: Wer das Schwimmen in offenen Gewässern liebt, der muss lernen, die Kälte zu lieben. Es reicht nicht, sich mit ihr auszukennen und zu wissen, an welchem Punkt im Prozess des Auskühlens und Herunterbrennens im Wasser man ist. Man muss die Kälte lieben lernen, ihre Klarheit, ihre Schärfe, ihre Unerbittlichkeit.
Darin besteht die zweite, die fortgeschrittene Methode: die Kälte dadurch zu überwinden, dass man sie umarmt. Regelmäßigkeit und Routine helfen auch hierbei, aber ihr Zweck ist nicht, den Moment der Überwindung auszublenden (das ist bei Temperaturen unter fünfzehn Grad auch gar nicht möglich). Das Umkleideritual dient zur Beruhigung vor dem Moment der ersten Kälteberührung, des Kälteschocks. Denn sosehr man auch versucht, darauf gefasst zu sein, die Begegnung mit der Kälte bleibt unberechenbar. Es ist unmöglich, sie vorher zu ermessen. Man weiß nur, dass es kalt wird, aber nie genau, wie kalt. Auch die Celsius-Skala mit ihrer für Schwimmer viel zu groben Einteilung ist kaum mehr als ein Anhaltspunkt. Grad ist nicht gleich Grad. Schon ein Eichstrich weniger auf der Quecksilbersäule kann eine andere Welt bedeuten, wenn man ins Wasser geht.
Und dann ist sie wirklich da, die Kälte, packt zu, dringt ein, nagt, beißt, sticht, schneidet. Sämtliche Alarmglocken schrillen. Jetzt kommt es darauf an, den nächsten Schritt zu tun, dem Reflex des Zurückzuckens nicht nachzugeben, in der Kälte nicht zu verkrampfen, sondern ruhig zu atmen und die Angst und den Aufruhr des Körpers zu zähmen, so als ließe sich die Kälte selbst zähmen und gnädig stimmen, so als wäre dies nur eine stürmische, etwas zu heftig geratene Begrüßung unter Freunden.
Die Kunst ist, die Kälte anzunehmen wie eine Herausforderung und sich von dem ersten Alarm nicht irre machen zu lassen. Es gilt, die Ruhe zu bewahren und immer weiter auf den Moment zuzugehen, zuzuschwimmen, in dem sich die Schockstarre löst und die Zumutungen der Kälte ihre Bedrohlichkeit verlieren. Irgendwann fächert sie sich auf in verschiedenste Schichten und Strömungen, irgendwann ist das Wasser nicht mehr »nur kalt«, nicht nur eine Front, sondern ein verblüffend vielfältiges Temperaturgemisch. Und die anfängliche Schärfe, das Schneidende der Kälte verwandelt sich in ein Gefühl der Klarheit und Frische, in ein angenehmes Prickeln auf der Haut, das man beinahe mit Wärme verwechseln könnte.
Wenn auch nur für kurze Zeit.
Es ist, wie gesagt, die Methode für Fortgeschrittene, und sie empfiehlt sich ausdrücklich nicht zur Nachahmung. Im Gegenteil. Allen, die noch nicht die Stufe des Gewohnheitsschwimmers erreicht haben, sei ganz deutlich gesagt: Bitte nicht nachmachen! Sofern man nicht mit dem Wasser durch den Sommer und Frühherbst gegangen ist und die abfallende Temperaturkurve mitvollzogen hat, ist bei fünfzehn Grad Celsius definitiv Schluss. Die Liebe zur Kälte setzt eine gewisse Abhärtung und Erfahrung voraus. Wenn man es nicht gewohnt ist, wenn der Körper die Kälte nicht kennt, nicht »lesen« und einordnen kann, schlägt die Angst um in Panik und wird total.
Das Gespür für Wasser ist zuallererst ein Gespür für Temperatur. Strömungen, Wellenbewegungen, Wirbel spielen für das Wassersensorium eine große Rolle. Auch die Wasserhärte oder Weichheit, der Salzgehalt und die Tragfähigkeit sind nicht zu vernachlässigen. Aber die wichtigste, überlebenswichtigste Frage ist die Temperatur. Wer das Wasser liebt, braucht einen ausgeprägten Kältesinn – eine genaue Einschätzung und Erfahrung, wie viel Zeit er im Wasser verbringen kann. Aufgrund der größeren Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zur Luft verbraucht der Körper im Wasser etwa fünfundzwanzigmal mehr Energie, um seine Normaltemperatur aufrechtzuerhalten. Eine Wassertemperatur von beträchtlichen siebenundzwanzig Grad Celsius verursacht denselben Wärmeverlust wie sechs Grad kalte Luft. Bei einer Wassertemperatur von zehn Grad ist ein männlicher Schwimmer im Durchschnitt etwa zehn Minuten handlungsfähig. Dann versagen Koordination und Gleichgewichtssinn. Wer die Herausforderung der Kälte annimmt und ihre klaren, kristallinen Glückszustände sucht, darf die Zeit nie vergessen.
Aus diesem Grund sind auch die Entfernungen im Wasser nie dieselben. Eine Strecke von fünfhundert Metern, von Ufer zu Ufer, die man bei Temperaturen um die zwanzig Grad mit Leichtigkeit zurücklegt, ist bei unter fünfzehn Grad um ein Vielfaches länger und zehrender. Bei zehn Grad ist sie ein Spiel mit dem Tod, auch wenn man die Kälte kaum noch empfindet. Im Zuge der Auskühlung beschränkt sich der Kreislauf immer mehr auf die lebenswichtigen Organe. Arme und Beine werden kaum noch durchblutet, fühlen sich zunehmend taub an. Es wird immer schwerer, Druck hinter die Züge zu bringen. Schnellschwimmen ist nicht mehr möglich. Es ist auch nicht ratsam, weil bei hoher Muskelbelastung sehr kaltes Blut Richtung Herz gepumpt wird. Stiche und Herzrhythmusstörungen können die Folge sein. Zunehmend sinkt die Körperkerntemperatur. Bis zu zwei Grad Temperaturverlust kann man verkraften, auch wenn man den halben Tag brauchen wird, um wieder warm zu werden. Sinkt die Kerntemperatur noch weiter, beginnt die Bewusstseinseintrübung. Bei etwa dreiunddreißig Grad Körpertemperatur spricht man von Unterkühlung, danach wird es tödlich.
Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft zählt in ihrer Statistik mit einigen Schwankungen jeweils etwa vierhundert Tote durch Ertrinken in deutschen Gewässern pro Jahr. Achtzig Prozent der Opfer sind Männer, was nicht nur an einem anderen Risikoverhalten liegt, sondern auch daran, dass Männer aufgrund ihres Körperbaus und des geringeren Unterhautfettgewebeanteils schneller auskühlen. Über die Hälfte der Toten sind Männer und Frauen jenseits der fünfzig. Vier von fünf Todesfällen ereignen sich in Binnengewässern, heimischen Seen und Flüssen, nur ein Sechstel in Nord- und Ostsee. Offenbar ist im Meer das Gefahrenbewusstsein größer, und die eigenen Kräfte werden seltener überschätzt. Mehr als fünfzig Prozent aller Todesfälle ereignen sich während der besten Badesaison in den Sommermonaten Juni, Juli, August. Die Rede vom Wasser als dem Element des Lebens und des Todes ist keine Metapher.
Die Tiefe
Die Gefahr der Kälte im Wasser ist eine sehr konkrete, körperliche. Das spürt man am deutlichsten beim Ins-Wasser-Gehen. Dafür hat jeder erfahrene Schwimmer seine Routine, sein Ritual. Ob man sich zuerst das Wasser ins Gesicht klatscht, dann Arme, Nacken und Brust abreibt, bevor die empfindliche Bauchgegend an die Reihe kommt, ist eine Frage der Gewohnheit. Doch ein ruhiger, langsamer Übergang ins Wasser ist wichtig, damit der Körper die Möglichkeit hat, sich auf den An- und Übergriff der Kälte einzustellen. Er muss die Wassertemperatur lesen können, die ihm so schnell so viel Wärme und Kraft entziehen wird. Er braucht Zeit, um sich zu akklimatisieren. Der berühmt-berüchtigte Sprung ins kalte Wasser ist bei kühleren Temperaturen keine gute Idee, weil sich dadurch die Plötzlichkeit des Kälteschocks verstärkt. Das mag eine Zahl aus dem Bereich der Ruderer und Kanuten belegen: Ein Drittel der Todesfälle beim Kentern ereignen sich unmittelbar im Moment des Eintauchens, der Immersion.
Gemessen an der Bedrohung, ist die Angst vor der Kälte unterentwickelt. Unser Kältesinn ist verführbar zur Grenzüberschreitung, zum Abenteuer, zum Extrem, und ich weiß nur zu gut, wie groß jedes Mal die Versuchung ist, nicht »vernünftig« zu sein. Wenn das Wasser wie unberührt vor einem liegt, gläsern vor Kälte, wenn man es geschafft hat, den ersten Schock zu überwinden, und bei Temperaturen schwimmt, bei denen sonst kein Mensch ins Wasser geht, dann scheint die Herausforderung unwiderstehlich, die eigenen Grenzen immer weiter zu verschieben und noch eine Minute länger zu schwimmen, noch ein paar Meter mehr. Denn entlang dieser Grenze locken Erfahrungen von außergewöhnlicher Intensität, von nahezu halluzinatorischer Herrlichkeit: die Illusion, keine Temperatur der Welt könne einem etwas anhaben und man sei – für Momente zumindest – unsterblich.
Kälte ist die im Wasser am meisten unterschätzte Gefahr. Sie ist der blinde Fleck in unserem Gespür für Wasser, und das schon von klein auf. Wie schwer lässt sich ein Kind mit blauen Lippen, bibberndem Kinn und vor der Brust verschränkten Armen davon überzeugen, dass es dringend aus dem Wasser muss, weil es friert. Und wie leicht dagegen überzeugt die Warnung vor dem Wasser, wenn man sagt, dass es sehr tief ist. Kurioserweise scheint die Spezies Mensch mehr Angst vor der Tiefe zu haben als vor der Kälte. Dabei ist sie für einen Schwimmer – im Vergleich zur Wassertemperatur – vollkommen gefahrlos.
Und dennoch sorgt der Gedanke für Gänsehaut, dass beispielsweise der Fjord, in den man steigt, nach ein paar Schritten Hunderte von Metern abfällt und sich ein bodenloser Abgrund unter einem auftut. Die Tiefe beschwört allerlei Ängste herauf: ob es die uralte Angst vorm Fallen ist oder die Vorstellung, unrettbar auf den Grund zu sinken; ob man in einer Art Wasser-Höhenangst Schwindelgefühle bekommt oder immerzu daran denken muss, was für Pflanzen, Tiere, Ungeheuer im Verborgenen lauern. Die Ängste vor der Tiefe sind Legion, und sie vermischen sich mit der Angst vor der Dunkelheit, vor dem Kontrollverlust und dem Berührtwerden in einer Situation der Schutzlosigkeit. Die Tiefe lehrt uns das Fürchten, wo uns eigentlich die Temperatur das Fürchten lehren sollte. Denn im Gegensatz zur Kälte hat die Tiefe eine phantastische Dimension, so phantastisch wie das Wesen der Angst.
Wenn wir an die Tiefe denken, hört das Wasser auf, ein sinnlich fassbares Element zu sein. Das, was uns Angst macht, ist nicht zu greifen, nicht zu hören, nicht zu sehen. Wir sind im Bereich der Fiktion, der Vorstellung, was passieren könnte. Unzählige Angstgeschichten vom Wasser kommen uns in den Sinn: von Schlinggewächsen, die sich um Arme und Beine ranken und den Schwimmer in die Tiefe ziehen, von Raubfischen, die Menschen angreifen, bis hin zum legendären Weißen Hai. Das Biotop all dieser Ängste ist die Tiefe, dort, wo das haust, wimmelt und wartet, von dem wir nichts wissen.
Das Wasser wird zu einem Gleichnis des menschlichen Bewusstseins. An der Oberfläche haben wir den Überblick. Hier meinen wir unsere Wege steuern und bestimmen zu können. Doch wie hauchdünn und unbedeutend ist diese Schicht, in der wir die Kontrolle besitzen, angesichts der dunklen, undurchschaubaren Tiefe darunter. Das Unterbewusstsein ist ein Unterwasserbewusstsein. Es erfüllt uns mit Unbehagen und Angst, allein schon, weil wir bei jeder unserer Oberflächenbewegungen spüren, um wie viel größer und gewaltiger die Welt unter Wasser ist, wo uns Strömungen lenken, Kräfte beeinflussen und Gefahren drohen, die wir kaum ermessen können. Wir sind nicht Herr im eigenen Haus, nicht Herr unserer Handlungen und unseres Schicksals, diese Wahrheit des Unterbewusstseins ist eine Wasserwahrheit.
Es waren zwei Königskinder,
Die hatten einander so lieb,
Sie konnten beisammen nicht kommen,
Das Wasser war viel zu tief.
»Ach, Liebster, kannst du nicht schwimmen,
Schwimm doch herüber zu mir!
Zwei Kerzen will ich anzünden,