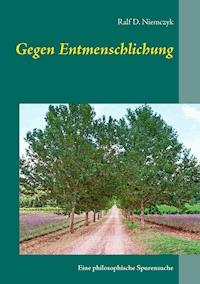
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auf seiner philosophischen Spurensuche setzt der Autor der Überzeugungskraft des Bösen einen konsequenten Humanismus entgegen, indem er grundlegende Mechanismen der Unmenschlichkeit analysiert. So werden Phänomene wie Ohnmachtserfahrung, Orientierungslosigkeit, Erniedrigung, kulturelle Verarmung und Suchtverhalten in den Blick genommen. Eine Auseinandersetzung mit Schopenhauer und Rousseau führt zu der Einsicht: Humanität ist keine Illusion. Auswege aus Angst, Wut und Hass werden gewiesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Sohn Niklas
und meine Frau Ramona
INHALT
Vorwort
Einleitung
Auf der Suche nach Halt
Abbildung:
Ordnung
Angst ist der Rohstoff von Herrschaft
Neid, Hass und Wut
Pessimismus, Idealismus und Realismus contra Humanismus?
Die amputierte Prostituierte & Hilflose Person auf der Couch
Überzeugungskraft des Bösen und Gegengifte
Abbildung:
Unter der Stadt
Der Mensch - eine Fehlentwicklung?
Rousseau und der sich selbst entfremdete Mensch
Das Paradigma der Zivilisationskritik
Vom Humanismus zum Pessimismus und zurück
Arthur Schopenhauers Menschenbild als Korrektiv eines naiven Fortschrittsglaubens
Theoretische Grundlagen der Philosophie des Pessimismus
Von der Erkenntnistheorie Kants zum Menschenbild Schopenhauers
Abbildung:
Leben
Abbildung:
Lichtbaum
Von der Möglichkeit eines erfüllten Daseins
Der Optimismus erhebt Einspruch
Abbildung:
Masken
Der neue Turmbau zu Babel
Ernährung und Heilssuche
Ein Nachruf
Abbildung:
Gift Alkohol
Abbildung:
Lichtflaschen
Man lehrt uns die Kunst zu leben
Bilanz ziehen
Erzählung:
Karma
Politische Utopien
Erzählung:
Der Riese und der Spielplatz
Vom Bedürfnis nach Religion
Erzählung:
Die Ikone
Abbildung:
Lichtkreuz
FAZIT
: Was bleibt?
VORWORT
Als Spätfolge eines Lehrauftrags der Universität Duisburg-Essen zum Thema "Zerstörung des Humanen/Entfremdung des Menschen" entstanden essayistische Texte, kurze Erzählungen und eine Reihe von Bildern, die sich zu einem Buch zusammenfanden.
Schwerpunkt dieser philosophischen Spurensuche ist es, über das Gelingen und Scheitern des Humanen nachzudenken.
Phänomene wie die Ohnmachtserfahrung des modernen Menschen, seine Fremdbestimmung, Orientierungslosigkeit, kulturelle Verarmung und Suchtverhalten werden in den Blick genommen.
Die Betrachtung der Werke Schopenhauers, Rousseaus und Canettis verhelfen zu der Einsicht: Humanität ist keine Illusion. Das Böse hat nicht das letzte Wort.
Es gilt, die Mechanismen der Unmenschlichkeit zu durchschauen und Angst, Wut, Neid und Hass als konstituierende Elemente von Herrschaft nachzuweisen.
Es gilt überdies, Auswege aus Zerstörung und Entfremdung zu zeigen und Hoffnungsbilder des Lebens zu entfalten.
EINLEITUNG
Der Mensch - eine Fehlentwicklung:
ins Gelingen verliebt, zum Scheitern verdammt.
Der Sehnsucht nach dem Glück verfallen -
sich dabei das Leid bereitend,
müht er sich ab in der Zeit.
Für Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Welt und Mensch ertragen und mittragen.
Aus den Illusionen der Kindheit
und Jugend treten wir hinaus,
den Traum vom besseren Leben dennoch im Herzen,
und begegnen Finsternis und Licht.
Für Ernst Bloch (1885-1977)
Zwei Gedanken, gewidmet zwei Philosophen aus verschiedenen Jahrhunderten, bezeichnen die beiden Pole, zwischen denen sich die vorliegenden Betrachtungen bewegen: Auf der einen Seite der Scharfblick Schopenhauers gepaart mit dessen Pessimismus; auf der anderen Seite Ernst Blochs Hoffen auf ein Glücken des Experimentes Mensch.
Der Mensch - eine Fehlentwicklung, Irrtum, Irrweg, Fehlkonstruktion gar? Ein zum Scheitern verurteiltes Glied in der Kette der Evolution?
Oder: Betreffen die Irrwege, Irrtümer und das Scheitern lediglich die vom Menschen selbst initiierten "allzu menschlichen" Fehlentwicklungen?
Zwei Fragen, die uns auf unserer Suche nach den Spuren des Humanen begleiten werden.
Gläsernes Labyrinth:
Die Vorstellung eines gläsernen Labyrinths, dessen Transparenz die Begegnung zwischen Menschen erleichtert, eine letztliche Annäherung jedoch verhindert.
Man sieht sein Gegenüber, nähert sich mühevoll, indem man die zahlreichen Glaswände, die fast unsichtbaren Barrieren, umgeht. Dann allerdings lassen die Meisten noch eine letzte Glasscheibe, eine unsichtbare Wand, zwischen sich und dem Gegenüber.
Wie selten fallen alle Barrieren.
Was bleibt, ist das Wandeln inmitten gläserner Labyrinthe, das Ausspähen, Erkunden und Durchschreiten vermuteter Pfade, auf einander zu und voneinander weg.
Damit ist ein Anfang gemacht:
Ein Bild der Begegnung und der Suche nach Vereinigung, die in letzter Konsequenz unmöglich gemacht wird. Ein Bild des Unfertigen. Es mag stehen für das Scheitern des Humanen, zugleich aber auch für die Suche nach geglücktem Menschsein, zumindest für die Sehnsucht danach.
Auf der Suche im gläsernen Labyrinth hinterlässt man Spuren und Erinnerungen an Begegnungen, versuchte Annäherungen. Solchen Spuren der Menschlichkeit gilt es nachzugehen.
Die literarische Form für dieses Auffinden, Nachgehen und Fortsetzen von Spuren ist die des Fragments. Das Fragment entspricht als Gestaltungsprinzip einer unübersichtlich gewordenen Welt besser als ein geschlossenes System. Es gleicht hierin dem Tagebuch, geführt von einem Suchenden, der sich über seine gelegentlichen Funde Rechenschaft ablegt.
Auf diese Weise ist eine Sammlung von essayistischen Texten, Bildern, plakativen Thesen und kurzen Erzählungen entstanden - lose geordnet nach thematischen Schwerpunkten. Es sind Betrachtungen eines Suchenden, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Letztgültigkeit erheben. Vielmehr wollen sie den Leser zu eigenen Betrachtungen anregen.
1. Auf der Suche nach Halt
Orientierungslosigkeit gehört zu den Grunderfahrungen des Individuums der Gegenwart. Es ist eine schmerzliche Erfahrung.
Halt suchen inmitten des Wandels und endlich zu einer Haltung gelangen, das ist viel und weitaus mehr als den meisten gelingt.
Wenn Sicherheiten wegbrechen, der Boden wankt und Lichter verlöschen, ist ein jeder auf sich selbst zurückgeworfen. Traditionen verwandeln sich in museale Kulissen, inmitten derer ein neues Stück aufgeführt wird. Die Rede der Gottheit ist längst verstummt und räumt das Feld den Ideologen jeglicher Couleur.
Hier sich zu einer Haltung durchringen ist dem Individuum aufgetragen. Albert Camus bleibt in dieser Hinsicht viel zu verdanken, doch zeichnet sich das Problem der Orientierungslosigkeit in der Moderne bereits ein Jahrhundert vor dem französischen Existentialisten ab: bei Schopenhauer und Nietzsche. Auch bei ihnen geht es darum, in einer des Sinnes beraubten Welt ("Gott ist tot") zumindest eine Haltung einzunehmen oder gar eigenen Sinn zu stiften.
Bequemer hingegen ist die unreflektierte Rückkehr zu den Traditionen. In ihren Sesseln, abgewetzt von Generationen und Generationen, lässt man sich gerne nieder und gibt sich der Illusion von Sicherheit hin. Das Comeback der Religionen zu Beginn des 21. Jahrhunderts legt hiervon Zeugnis ab.
Sittliche, kulturelle und religiöse Überlieferungen geben Orientierung, gewähren Halt, zumindest so lange, bis Zweifel sich einstellen. Daher die Erfolgsgeschichte des Fundamentalismus. Letzterer reißt die Zweifel gleich mit den Menschen heraus:
"Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Tod den Ungläubigen."
Die Tradition öffnet dem bourgeoisen Kirchgänger die Tore des Himmels wie sie den islamistischen Terroristen ins Paradies begleitet. Doch sind dies Umwege, Abwege, Irrwege, bevor das Individuum wieder am Ausgangspunkt seiner Odyssee angelangt ist: bei der Tatsache, dass ein Jeder auf sich selbst zurückgeworfen ist in einer Welt ohne höheren Sinn.
Existiert ein Etwas, eine Eigenschaft, eine Tendenz oder gar Kraft, den Institutionen und Kollektiven, welche das Individuum absorbieren, entgegenzutreten? - Bei der Suche nach einer Antwort bietet uns die Philosophie Arthur Schopenhauers eine Hilfestellung: Der "Wille zum Leben" reißt nach dessen Theorie alle mit sich - Individuen und Kollektive. Der blinde, unbändige, sich stets erneuernde Wille zum Leben liegt in der Natur der Welt selbst, als ihr Kernbestandteil, als ihre spermatische, drängende Potenz. Die Identität von Leiblichkeit und Menschsein, jene unauflösliche Einheit von Körper und Geist zeigt uns in Hunger, Schmerz, Krankheit und geschlechtlichem Verlangen unsere Rückbindung an die Natur trotz aller Kulturleistungen.
So viel zur biologischen Verfasstheit der Spezies Mensch.
Orientierung sucht das auf sich selbst zurückgeworfene Individuum in den religiösen, politischen, kulturellen, moralischen, ökonomischen und bürokratischen Systemen sowie im Konsum der Wohlstandsgesellschaften. Besonders religiöse und politische Ideologien treten hinsichtlich ihrer Orientierungsfunktion für den verwirrten Einzelnen rigide und mit einem Absolutheitsanspruch ausgestattet auf. Hier gilt: Unterwerfung geht der Rettung, geht der Erlösung, geht dem Heil voraus.
Diese inzwischen durch die Katastrophen der letzten Jahrhunderte diskreditierten Ideologeme sind nach wie vor wirksam, erstaunlicherweise bei der Mehrzahl der Menschen sogar unvermindert.
Benötigt wird ein Kompass, welcher die Sachzwänge der Kollektive sowie die Ansprüche der Ideologien gleichermaßen transzendiert. Hier stoßen wir - wieder in Anlehnung an Schopenhauer - auf sechs Grundkräfte oder, um es vorsichtiger zu formulieren, auf sechs Tendenzen innerhalb der Spezies Mensch, die allen Kulturen und Ethnien zu allen Zeiten gemeinsam sind:
der Wille zu Überleben
das Mitgefühl
die Liebe
die Frage nach dem Mitmenschen, also das "Gewissen"
die Hoffnung, sich von Begierde, Hass, Neid und Furcht zu befreien
die Idee bzw. die Vorstellung von Gerechtigkeit
Die aufgeführten sechs Tendenzen finden sich in den meisten religiösen Systemen, in politischen Ideologemen und Ethiken der Völker mehr oder minder fragmentiert wieder. Oftmals wird ihre humanisierende Wirkkraft abgeschwächt oder gar in ihr Gegenteil verkehrt. Missbrauch ist hier an der Tagesordnung, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass jene positiven, dem menschlichen Leben und seiner Würde zuträglichen Grundkräfte existieren und als Potentia des Widerstands gegen Zerstörung, Inhumanität und kollektive Fehlentwicklungen ins Feld geführt werden können, um eine etwas martialische Wendung zu gebrauchen.
Um zur Eingangsfrage zurückzukehren: Es existiert also eine Ansammlung von positiven Eigenschaften und Tendenzen innerhalb der Spezies, um Fehlentwicklungen, Verheerungen und humanitären Katastrophen im Großen wie im Kleinen korrigierend zu begegnen. Dies freilich bei steter Gefahr einer Instrumentalisierung eben dieser von ihrer Anlage her positiven Kräfte durch die vorherrschenden Kollektive ("gerechter Krieg" etc.).
ORDNUNG
Ordnung statt Chaos. Das gibt Sicherheit.
Kreise, Quadrate, Dreiecke zu Formationen angeordnet. Eine Analogie zur Arbeitsweise der Natur: Sie schafft in Zeit und Raum Modelle.
Das Stiften von Ordnung als Prozess - eine Hilfe auf der Suche nach Halt.
2. Angst ist der Rohstoff von Herrschaft
Angst ist der Rohstoff, aus welchem angepasstes Verhalten produziert wird. Bisweilen kommen weitere Bestandteile hinzu: Eitelkeit, Ehrgeiz, Mitgefühl, Hass, Neid, Verzweiflung und Gewohnheit werden beigemischt.
Über Angst spricht man nicht gern. Und doch trifft man im zwischenmenschlichen Verkehr überall auf sie. Die Angst ist eine wesentliche Triebkraft, etwas zu tun oder zu unterlassen. Da ist die Angst, den eigenen Ansprüchen und denen Anderer nicht zu genügen: die Versagensangst. Da ist die Angst vor dem Vorgesetzten oder dem Kollegen. Die Angst vor sozialem Abstieg, die Angst, ausgeschlossen zu werden: die Angst um den Arbeitsplatz.
Angst vor Krankheit, Angst vor dem Älterwerden, vor dem Tod. Angst vor dem Verlust von Mitmenschen, Angst vor der Einsamkeit. Diese Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. Die Angst ist allgegenwärtig.
Aus Sicht der Psychoanalyse ist Angst das Resultat einer realen oder fiktiven Bedrohung oder Gefahr. Bedroht wird nach Freud der Mensch mit dem Verlust der Bindung und dem Verlust des Selbst1.
Dieses Gefühl der Unsicherheit aufgrund von Bedrohung wurzelt in letzter Konsequenz in der Konfrontation mit dem Tod. Der Ursprung menschlicher Ängste soll hier auf zwei archetypische Situationen zurückgeführt werden. Elias Canetti weist in „Masse und Macht“ auf die elementare Bedrohungssituation des Menschen in vorgeschichtlicher Zeit hin: Es ist die sehr reale Gefahr, von Raubtieren ergriffen, getötet und verschlungen zu werden2. Diesem Schicksal waren Menschen Jahrhunderttausende lang ausgesetzt. Die Gefahr, Opfer von Raubtieren zu werden, gepackt, zerrissen und verdaut zu werden, hat sich dem kollektiven Unbewussten der Gattung tief eingegraben. Canetti weist nach, wie diese archaische Grundbedrohung im Verlauf der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung überformt, symbolisch überhöht und dennoch erhalten geblieben ist. So umgibt sich der Mächtige mit den Requisiten des Raubtieres: Löwe, Bär oder Adler schmücken sein Wappen. Die Zähne der Bestie mutieren zu den Reihen der Lanzen und Schwerter, welche seine Krieger präsentieren. So wie das Raubtier seine Beute ergreift und bewegungsunfähig macht, lässt der Mächtige seine Opfer auf einen Fingerzeig hin in Ketten legen und einsperren: oft die Vorstufe zum Tod. Er degradiert die nun Ohnmächtigen zu Nutztieren3. Sie werden Sklaven, Zwangsarbeiter, Menschenmaterial. Ihr Leben liegt buchstäblich in der Hand des Machthabers, wie das Beutetier in den Klauen des Jägers, stets in der Erwartung zermalmt zu werden.
Machtausübung, das verdeutlicht dieser Rekurs auf die archetypische Situation, ist wesentlich untrennbar mit der Möglichkeit verbunden, einem Menschen das Leben zu nehmen4.
Die zweite archetypische Situation im Zusammenhang mit Angst und Herrschaft besteht im Ausschluss von der Primärgruppe, im Ausschluss von der Futter-, Schutz-, und Fortpflanzungsgemeinschaft der ersten Jäger und Sammler.
Dieser Ausschluss war gleichbedeutend mit dem Tod des Individuums. Angstbesetzte Bedrohungen des Individuums heute sind dieser Ursituation gegenüber Transformationen, Abwandlungen, Differenzierungen und Spielarten mit dem Ziel, den Einzelnen zwangsweise in bestehende Ordnungsstrukturen zu integrieren. Die Abmahnung, die Kündigung, der Ausschluss aus einem Verein oder Verband sind späte Nachwehen dieser Ursituation und Urbedrohung.
Angst dient hier mehr oder weniger offensichtlich als ein Mechanismus von Herrschaft.
Bilder der Gier:
Das Klammern, Ankrallen, Kleben an Menschen, an Dingen.
Das Verschlingen, Herunterwürgen, begleitet von einem Keuchen.
Das Anstarren.
Das Aufreißen einer Zigarettenpackung, danach das Einsaugen des Giftqualms mit dem sich anschließenden Seufzen.
Das Zerren, Reißen, Raffen.
Danach das Behalten, durchzittert mit Furcht vor Verlust.
Das Sich-Verzehren, hohlwangig, glühenden Auges.
Weltenverschlinger.
1 Vgl. Sturm, G. u. Pritz, A. (Hrsg.) Wörterbuch der Psychotherapie, Wien 2000, S. 31-32. Freud verlegt den Ursprung der Angst in die Erfahrung des für das Kind bedrohlichen Geburtsvorgangs. Freud, Sigmund: Studienausgabe, Frankfurt a.M. 2000, Bd VI, S. 299.
2 Canetti, Elias: Masse und Macht, Frankfurt a.M. 1980, S. 237-263.
3 Ebd., S. 246.
4 Ebd., S. 257, 333 ff
3. Neid, Hass und Wut
Im Menschen kann ein ungeheures Aggressionspotential entstehen, welches nicht direkt dem Bösen zuzuschlagen ist. Die dabei akkumulierte Energie könnte aus entwicklungsgeschichtlicher Perspektive das Überleben der Gattung begünstigt haben. Aggression diente ursprünglich dem Bestehen von Gefahren und dem Überwinden von Hindernissen. Neben Hunger, Angst und Geschlechtstrieb könnten aggressive Energien als Antrieb gedient haben, die der menschlichen Natur eigene Trägheit zu überwinden und mit Schwierigkeiten fertigzuwerden, Ziele zu erreichen und handfeste Probleme zu lösen. Die Verteidigung von Leib und Leben der eigenen Person, des Nachwuchses oder der Primärgruppe vor Feinden bedarf der instinktiven Angriffs- bzw. Abwehrbereitschaft.
Ein solches Energiepotential kann durchaus positiv besetzt sein: Man freut sich auf eine mit körperlicher Anstrengung verbundene Unternehmung, etwa eine längere Wanderung, eine Bergbesteigung oder auf einen sportlichen Wettkampf.
Was geschieht jedoch, wenn Abwehrhandlungen, das Lösen von Problemen, das Überwinden von Hindernissen wieder und wieder scheitern?
Das vergebliche Tun, die gescheiterte Unternehmung, die fehlgeschlagene und damit ihres Ziels und Sinnes beraubte Anstrengung löst die Entstehung einer andersartigen, qualitativ verschiedenen, negativ besetzten Energie aus. Die Rede ist hier von der aus der Enttäuschung geborenen Wut. Sie stellt dem Enttäuschten ein Reservepotential an Energie kurzzeitig zur Verfügung, mit dessen Hilfe er vielleicht doch, in einer abermaligen, jetzt verstärkten, Anstrengung, sein Ziel erreicht. Die Wut wäre folglich ein dem Überleben dienlicher Antriebsmechanismus. Auch hier gilt: Dieses Energiepotential kann konstruktiv und destruktiv gleichermaßen wirken.
Hass geht über die Wut hinaus. Er ist, anders als die Wut, kein momentanes Geschehen. Hass dauert an. Er ist, auch hierin von der Wut verschieden, unbegrenzt steigerbar und kann im Kern nie befriedigt werden. Mit zunehmender Betätigung wächst er.5
Das vielfältige, über längere Zeiträume hinweg sich ziehende Scheitern vermag den Hass zu generieren. Die Ahnung, dass die eigene Person gescheitert ist aufgrund persönlichen Unvermögens oder der eigenen Hybris, wird nicht zu einer Einsicht in die eigenen Grenzen, zur Selbsterkenntnis also, was fruchtbar wäre.
Das Scheitern wird auf außenstehende Mächte, Feinde, Schädlinge, Konkurrenten zurückgeführt. Jenes Energiepotential, welches der Bewältigung von Lebensaufgaben bzw. zunächst nur der Überwindung der Trägheit diente, wird nach und nach fokussiert auf den Feind, dem der somit schleichend entstehende Hass gilt.6
Die Wut auf sich selbst aufgrund des oft langjährigen Scheiterns führt mitunter zur masochistischen Selbstreglementierung und endet in Apathie, Burnout und Depression. Immer häufiger jedoch richtet sich diese Wut über die eigene Unfähigkeit gegen die „Anderen“, gegen jene, die schuld sind am vermeintlich defizitären Zustand der Welt. Ihnen gelten die wütenden Vergeltungsaktionen, ausgeführt von Einzeltätern7 oder von einem durch die Massenmedien und Massenorganisationen aufgebrachten Mob. Hitlers Lebens- und Seelenweg ist Paradigma für diesen Vorgang. Gleiches gilt für einen Teil der aus dem Hass heraus agierenden islamistischfundamentalistischen Terroristen.
Eine neben dem Scheitern zusätzliche Quelle entspringt und nährt den Hass: das ohnmächtige Empfangen und Ausführen von Befehlen.
Hier lässt sich auf Elias Canettis Paradigma vom „Befehlsstachel“ verweisen. Es handelt sich dabei um einen sozialpsychologischen Mechanismus, der, ähnlich wie die Angst, auf eine archaische Grunderfahrung der Gattung Mensch in vorgeschichtlicher Zeit zurückgeht. So reagiert der frühe Mensch auf das Brüllen des Raubtieres mit Flucht. In dieser Ursituation wurzelt die Genese des Befehls. Es ist in letzter Konsequenz eine Todesdrohung. Der Befehl stellt nach Canetti eine zivilisierte Ausgestaltung, eine Domestikation8des Machtanspruchs über Leben und Tod dar9.
Die Ausführung des Befehls steht nicht zur Disposition. Er wird vom Mächtigen erteilt. Das Problematische im Zusammenhang mit der Entstehung des Hasses liegt in folgendem:
„Die Handlung, die unter Befehl ausgeführt ist, ist von allen anderen Handlungen verschieden. Sie wird als etwas Fremdes empfunden;“10





























