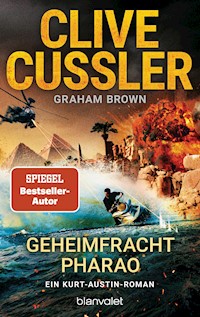
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Der 17. Roman um Kurt Austin, dem besten Mann für Unterwassereinsätze der amerikanischen Meeresbehörde NUMA.
1074 v. Chr. verschwinden riesige Schätze aus den Gräbern der ägyptischen Pharaonen. 1927 verschwindet ein waghalsiger amerikanischer Flieger bei einem Versuch eines transkontinentalen Flugs. Und heute sinkt vor der Küste Schottlands ein Trawler mitsamt einer mysteriösen Fracht. Wie hängen diese drei Ereignisse zusammen? Und, was noch wichtiger ist, was bedeuten sie für Kurt Austin und sein NUMA-Team?
Auf der Suche nach Antworten schließt er sich mit seinen Leuten den Agenten des britischen MI5 an, um sich einem neuen Feind zu stellen: den brutalen Waffenschiebern von der Bloodstone Group.
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein New-York-Times-Bestseller. Auch auf der deutschen Spiegel-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Die Kurt-Austin-Romane bei Blanvalet
1. Tödliche Beute
2. Brennendes Wasser
3. Das Todeswrack
4. Killeralgen
5. Packeis
6. Höllenschlund
7. Flammendes Eis
8. Eiskalte Brandung
9. Teufelstor
10. Höllensturm
11. Codename Tartarus
12. Todeshandel
13. Das Osiris-Komplott
14. Projekt Nighthawk
15. Die zweite Sintflut
16. Das Jericho-Programm
17. Geheimfracht Pharao
Weitere Bände in Vorbereitung
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Clive Cussler
& Graham Brown
GEHEIMFRACHT
PHARAO
Ein Kurt-Austin-Roman
Aus dem Englischen
von Michael Kubiak
Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Journey of the Pharaohs (KA 17)« bei Putnam, New York.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2020 by Sandecker RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Blanvalet Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(Smeilov Sergey; e-leet; Studio 37; Ivan Cholakov; klptgrph;
Tasawer; Waj; YummyBuum; NeoStocks)
Redaktion: Jörn Rauser
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-27691-1V003
www.blanvalet.de
HISTORISCHE RÜCKBLENDE
ÄGYPTEN, 1074 V. CHR.
Khemet – Ehemaliges Mitglied einer Gruppe, deren Aufgabe darin bestand, das Tal der Könige zu bewachen.
Qsn – Waisenjunge, der Khemet als Spion und Informant dient. Sein Name bedeutet Sperling und Unglücksbringer.
Herihor – Militärischer Kommandeur, der für einige Zeit als Pharao in Oberägypten herrschte und dann verschwand.
NEW YORK CITY, 1927
Jake Melbourne – Flugzeugpilot, Luftakrobat und im Ersten Weltkrieg hoch dekorierter Jagdflieger, der den Orteig Prize für die erste Nonstop-Atlantiküberquerung von New York nach Paris erringen will.
Carlo Granzini – Oberhaupt des kriminellen Granzini-Clans.
Stefano Cordova – Granzinis Neffe und zugleich Melbournes Freund und Mechaniker
HANDELNDE PERSONEN
GEGENWART
NATIONAL UNDERWATER AND MARINE AGENCY (NUMA)
Kurt Austin – Direktor der Abteilung für Sonderprojekte, Bergungsexperte und Hochleistungstaucher.
Joe Zavala – Kurts bester Freund und als technisches Genie verantwortlich für die Konstruktion eines Großteils der exotischen technischen Ausrüstung der NUMA.
Rudi Gunn – Stellvertretender Direktor der NUMA und Absolvent der Naval Academy.
Hiram Yaeger – Technologie-Chef der NUMA und Konstrukteur von Max, dem Supercomputer der NUMA.
Paul Trout – Geologe, promovierter Meereswissenschaftler, mit Gamay verheiratet.
Gamay Trout – Meeresbiologin, mit Paul verheiratet, innerhalb der Gruppe geradezu berüchtigt für ihre bissigen kritischen Anmerkungen – mit denen sie jedoch meistens genau ins Schwarze trifft.
SCHOTTLAND
Vincennes – Mysteriöser Passagier des Fischtrawlers.
Slocum – Schmuggler und Mitglied der Bloodstone Group.
UNITED KINGDOM SECURITY SERVICE, SECTION 5 (MI5)
Oliver Pembroke-Smythe – Ehemaliges Mitglied des SAS, derzeit Direktor der Abteilung für Anti-Terror-Operationen innerhalb des MI5.
Morgan Manning – Spezialagentin des MI5 und angesetzt auf die Bloodstone Group.
Henry Cross– Altertumsforscher und Professor für Ägyptologie an der Universität von Cambridge. Er hilft dem MI5 beim Identifizieren geschmuggelter archäologischer Fundstücke.
DIE BLOODSTONE GROUP
Solomon Barlow – Ehemaliger Söldner, mittlerweile Waffenhändler und Chef der Bloodstone Group.
Kappa – Waffenexperte und Barlows Stellvertreter.
Robson – Ehemaliger Straßenräuber in einem Gangsterviertel Londons, mittlerweile einer von Barlows Befehlsempfängern.
Daly – Robsons Komplize, macht Robson für seine Verhaftung verantwortlich.
Gus – Robsons Komplize und Dalys Halbbruder.
Fingers – Mitglied der ehemaligen Straßenbande Robsons.
Snipe – Mitglied von Robsons Straßenbande.
UNTERSTÜTZER DER BLOODSTONE GROUP
Xandra and Fydor – Geschwisterpaar, das auf die Ausführung von Attentaten spezialisiert ist und regelmäßig gemeinsam unter dem Pseudonym Toymaker operiert.
Omar Kai – Söldner, der von der Bloodstone Group engagiert wird, nachdem sie in die USA einreist.
FRANKREICH
Francisco Demars – Enkel des Mannes, der die Schriften des Qsn entdeckte, wohnt in einem Chateau in Frankreich.
SPANIEN
Pater Torres – Katholischer Priester in der Villa Ducal de Lerma in San Sebastián de las Montañas.
Sofia – Junges Mädchen, das Gamay und Paul Trout mit Pater Torres bekannt macht.
VEREINIGTE STAATEN
James Sandecker – Ehemaliger Direktor der NUMA, mittlerweile Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Miranda Abigail Curtis – Leitende Archivarin des FBI.
Morris – Chef von Sandeckers Sicherheitskommando.
NAVAJO NATION
Eddie Toh-Yah – Alter Freund von Kurt Austin, Mitglied der Stammesadministration der Navajos.
Eddies Großvater – Führer der örtlichen Ratsversammlung der Navajos, Bewahrer der Flamme.
PROLOG
Tal der Könige, Ägypten
1074 v. Chr., während der 18. Dynastie
Aufgeheizt von der unbarmherzigen Sonne, die den Wüstensand zu solidem Ton brannte, flimmerte die Luft im Tal der Könige.
Hoch oben über dem Tal, an der Kante eines Steilabbruchs, lag ein bärtiger Mann namens Khemet auf dem Bauch, schwitzte unter den Strahlen der Mittagssonne heftig und hielt nach Anzeichen für irgendwelche Tätigkeiten Ausschau. Schweißtropfen tropften an seinen Wangen herab, eine Fliege summte um seine Ohren, aber unten im Tal rührte sich nichts.
Still und verlassen brütete es in der Sonne – ganz so, wie man es von der Ruhestätte der in ihren Felsengräbern bestatteten Pharaonen erwarten sollte. Lediglich der Wirbel eines kleinen Staubteufels tanzte am südlichen Ende der tiefen Senke über den Sand.
Khemet zog sich kriechend vom Rand der Klippe zurück. Mehrere Männer in leinenen Gewändern kauerten dort. Ein Junge stand neben ihnen. Khemet winkte ihn zu sich. »Weshalb sind wir hier? Was wolltest du uns zeigen?«
In Theben wurde der Junge Qsn genannt, was Sperling bedeutete. Den Spitznamen verdankte er nicht der Tatsache, dass er für sein Alter eher klein gewachsen war und seine Stimme an das Zwitschern eines Vogels erinnerte, sondern er war ein Ausdruck der Verachtung. Für die Ägypter galt der Sperling als Plage: dreist, allgegenwärtig und ständig auf der Suche nach Nahrung, die zu stehlen er jede Gelegenheit nutzte. Genauso lästig und störend empfanden die Stadtbewohner den Waisenjungen.
Khemet jedoch sah ihn in einem anderen Licht. Er mochte ein Bettler sein, aber kein Dieb. Tatsächlich verdiente er sich die kleinen Münzen, die ihm zugesteckt wurden, mit harter Arbeit und sammelte Informationen, indem er alles, was um ihn herum vorging, aufmerksam beobachtete und sich einprägte. Dank seiner Größe und seines Alters war er dabei häufig so gut wie unsichtbar und wurde von den Passanten gar nicht wahrgenommen.
Der Junge krabbelte zur Felskante, blickte ins Tal hinunter und zupfte an Khemets Ärmel. Er streckte einen mageren Finger aus und deutete auf einen Punkt in den gegenüberliegenden Felsen. »Das Grab des Pharao ist geöffnet worden. Jemand hat die Steinplatte entfernt.«
Von der grellen Sonne geblendet, kniff Khemet die Augen zusammen und lenkte den Blick an dem prachtvollen dreistöckigen Tempel der Hatschepsut mit seinem langen zentralen Treppenaufgang und den imposanten Säulenreihen vorbei. Er ignorierte die Geröllhaufen, mit denen die Eingänge zu den Gräbern weniger prominenter Verstorbener verschlossen waren, und konzentrierte sich auf einige glatte Kalksteinblöcke, zwischen denen ein Spalt klaffte und den Einlass zum Grab des Horemheb markierte. Dies war einer der Pharaonen, die erst in jüngerer Vergangenheit bestattet worden waren.
Seine Augen waren zwar nicht so scharf wie die des Kindes, aber als er sie mit einer Hand vor den Sonnenstrahlen abschirmte, konnte er in den Schatten doch noch mehr Einzelheiten erkennen. Die mit weißer Farbe bedeckte Platte, mit der das Grabmal verschlossen worden war, lag in zwei Hälften geborsten auf dem staubigen Untergrund. Der Weg, der zum Grabeingang führte, wirkte, als sei er von Karrenrädern zerfurcht und von den Hufen der Ochsen, die sie zogen, zertrampelt.
»Der Junge hat recht«, stellte Khemet fest. »Das Grab ist aufgebrochen worden.«
»Und was denkt er, was wir jetzt tun sollen?«, fragte einer der anderen Männer.
Der Junge hatte keine Scheu, den Erwachsenen seine Meinung kundzutun. »Ihr seid die Medjai«, sagte er mit seiner hohen Zwitscherstimme. »Ihr dient Ramses XI. von Memphis und müsst die Ruhestätte der Söhne Amuns bewachen.«
Khemet lächelte. Bei den Medjai – einer Schar von Kriegern, denen von den Pharaonen die Aufgabe zugewiesen worden war, die Gräber ihrer Vorfahren zu beschützen – hatte er früher den Rang eines Hauptmanns bekleidet, nun jedoch im Laufe der politischen Unruhen, die eine Teilung Ägyptens herbeiführten, hatte er seinen Posten verloren.
»Vielleicht hört der Sperling nicht mehr so gut«, sagte einer der Männer. »Wir werden von den Söhnen Amuns nicht länger gebraucht.«
»Aber Ramses …«
»Ramses herrscht in Memphis und Alexandria«, erklärte Khemet geduldig, »wir aber sind hier in Oberägypten, und Herihor hat sich selbst zum Herrn des Hohen Throns ernannt.«
Das Gesicht des Jungen verzog sich voller Geringschätzung. »Herihor ist nicht nur der Hohepriester, er ist auch …«
»Hier ist er ein König«, schnitt ihm Khemet in scharfem Ton das Wort ab. »Nimm dich in Acht. Hier gibt es einige, die dir die Zunge herausschneiden würden, wenn du etwas anderes behauptest.«
Erschrocken zog der Junge den Kopf ein.
Khemet wartete, bis er sicher sein konnte, dass der Junge verstanden hatte, was dies bedeutete, ehe er hinzufügte: »Glücklicherweise gehören wir nicht zu diesen Leuten.«
Die Männer hinter ihnen lachten. Der Junge entspannte sich und war sichtlich erleichtert.
»Ägypten ist nicht mehr, was es früher einmal war«, meinte einer seiner Männer. »Je schwächer es wird, desto mehr Pharaonen sind nötig, um es zu regieren. Nicht mehr lange, und jede Region hat ihren eigenen.«
Diese Prognose quittierten die Männer mit weiterem Gelächter, in das der Junge nicht einstimmen konnte. Er war noch jung genug, um Tugenden wie Pflichtbewusstsein und Ehrenhaftigkeit ernst zu nehmen und als erstrebenswert zu betrachten, und außerdem wurde die Königswürde von den Göttern vergeben. Dies zu vergessen, konnte schmerzhafte Folgen haben.
Khemets Blick kehrte zu dem offenen Grabmal zurück. »Wir sollten das Grab gründlich untersuchen und nachschauen, was gestohlen wurde.«
Er verließ seinen Aussichtspunkt auf den Klippen und führte die Gruppe zu einem geheimen Kletterpfad, auf dem sie ins Tal hinunter gelangten. Es war einer der versteckten Wege, die nur die Medjai kannten.
Als sie ihr Ziel erreichten, war die Umgebung viel heller und gleißender, so als befänden sie sich auf einem Weg, der geradewegs in den Himmel führte. Im Gegensatz zu den gelbbraunen Felswänden ringsum war der Talgrund mit zermahlenem Kalkstein und weißem Staub bedeckt, mit den Überresten der Gesteinstrümmer, die sich in den letzten tausend Jahren angesammelt hatten, wann immer neue Grabstätten geschaffen worden waren.
Das grelle, vom weißen Kalkstein reflektierte Licht veranlasste Khemet, seinen Kopf mit einem Schal zu verhüllen, sodass lediglich ein schmaler Schlitz übrig blieb, durch den er seine Umgebung beobachten konnte, und so sah er wie ein Bandit aus, als er das Grabmal Horemhebs betrat.
Sobald er sich in seinem Innern befand, nahm er den Schal ab und blieb im Felsenkorridor hinter dem Eingang stehen. Die kühle Luft umfächelte seinen Körper, während sich seine Augen auf das herrschende Dämmerlicht einstellten. Seine Pupillen weiteten sich allmählich, und die gesamte Pracht des von den Künstlern ausgeführten Grabschmucks bot sich seinem Blick dar. Alles wurde von dem Licht erhellt, das durch den Grabeingang hereinsickerte und zusätzlich von den Fackeln erzeugt wurde, deren rauchlose Flammen von einer Mischung aus Rizinusöl und Natron gespeist wurden.
Khemet griff nach einer der Fackeln, die in Eisenringen steckten, die an den Korridorwänden befestigt waren, und drang weiter vor. Der Junge hielt sich an seiner Seite, und seine Männer folgten dichtauf.
Sie passierten einen zweiten Durchgang und betraten die Grabkammer, die für weniger bedeutende Ehefrauen und gemeines Dienstpersonal reserviert war.
Khemet blieb stehen und schob den Jungen in eine Nische in der Felswand. »Ganz still jetzt«, sagte er leise. »Wir sind nicht allein.« Er griff in sein weites Gewand, zog ein Kurzschwert hervor und gab seinen Männern ein Zeichen, zu ihm aufzuschließen. »Haltet euch bereit.«
Geräuschlos trat Khemet durch die nächste Eingangsöffnung. Sie wurde von zwei Anubis-Statuen flankiert. Das flackernde Licht der Fackel in Khemets Hand riss die starren Schakalgestalten aus dem Dunkel und warf ihre Schatten auf die gegenüberliegende Wand.
»Nutzlose Wächter«, flüsterte einer der Männer und deutete mit einem Kopfnicken auf das Schakalpaar, »die nichts anderes zu tun haben, als untätig dazuhocken, während sich Räuber an den Gaben, die dem Pharao das Leben im Jenseits erleichtern sollen, schadlos halten.«
Das klirrende Geräusch eines Werkzeugs, das auf Stein prallte, erklang in einiger Entfernung vor ihnen. Als er die Grabkammer des Pharaos betrat, entdeckte Khemet die Quelle des Geräuschs. Vor der hinteren Wand der Kammer standen ein Priester und neben ihm ein Steinmetz, der eine Inschrift in den Fels meißelte. Zwischen ihnen befand sich der Steinsarg Horemhebs. Sein schwerer Deckel lag auf dem Boden neben dem Sarkophag. Der goldene Innensarg, die Totenmaske und die Mumie des Pharaos waren verschwunden.
Jetzt bemerkten der Priester und der Steinmetz das flackernde Licht der Fackel. »Höchste Zeit, dass ihr zurückkommt«, sagte der Priester, ohne sich umzudrehen und zur Tür zu schauen. »Hier ist noch einiges, das abtransportiert werden muss.«
»Du meinst, was gestohlen werden muss«, sagte Khemet.
Erst in diesem Augenblick wandte der Priester sich um. »Wer bist du?«, fragte er in herrischem Tonfall.
»Ich bin Khemet, Hauptmann der Wache. Und du bist ein Dieb.«
Der Priester machte nicht den Eindruck, bei etwas Verbotenem ertappt worden zu sein. »Ich bin der Helfer des Hohen Throns. Diener des Pharaos Herihor. Ich erledige die Arbeit des Pharaos. Ihr jedoch seid unbefugte Eindringlinge und Deserteure.«
Und ich werde ein Held sein, wenn ich Ramses deinen Kopf zu Füßen lege, dachte Khemet.
Er machte einen Schritt vorwärts und hob sein Schwert. »Was hast du mit dem Pharao gemacht? Wo sind seine Grabgeschenke?«
»Sie wurden an einen anderen Ort geschafft«, antwortete der Priester, »um sie vor Plünderern wie dir in Sicherheit zu bringen.«
Die Stimme des Priesters hatte einen höhnischen Tonfall angenommen und klang für einen schmächtigen Mann, der von einem Soldaten mit gezücktem Schwert zur Rede gestellt wurde, erstaunlich drohend. Als er hinter sich eine Bewegung wahrnahm, wusste Khemet auch, weshalb.
Ein Pfeil flog durch den Korridor und durchbohrte einen seiner Begleiter von hinten. Ohne einen Laut von sich zu geben, brach der Mann zusammen und rührte sich nicht mehr.
Ein Speer folgte und traf einen der anderen Männer, während er sich umwandte.
Khemet drückte sich gegen die Korridorwand, als ein zweiter Pfeil die Luft durchschnitt. Dieser erreichte die Grabkammer und erwischte den Steinmetz in Magenhöhe. Der Handwerker rutschte vom Mauervorsprung und stürzte auf den Felsboden, wo er sich vor Schmerzen wand.
Instinkt und Reflexe eines erfahrenen Kriegers ließen Khemet blitzartig auf Tauchstation gehen. Er griff den Bogenschützen im Korridor an und holte ihn von den Füßen, noch bevor er einen zweiten Pfeil einlegen konnte. Khemet rammte dem Mann sein Schwert zwischen die Rippen, drehte die Klinge und riss sie mit einem kraftvollen Ruck wieder heraus.
Als er mit ansehen musste, wie der letzte seiner Männer von einem weiteren Speer niedergestreckt wurde, warf Khemet sein Schwert und spießte den Angreifer auf. Der Mann sank auf die Knie und kippte zur Seite. Nur der Priester und Khemet waren noch übrig, aber der Priester hatte das Geschehen im Vorraum der Grabkammer bereits zu seinem Vorteil genutzt.
Während sich Khemet noch seiner Haut wehrte, hatte der Priester einen Dolch, dessen Griff wie der Kopf einer Kobra geformt war, aus den Falten seines grellbunten Gewandes gezogen. Er stürzte sich auf Khemet und bohrte ihm den Dolch in die Seite.
Khemet drehte sich zu ihm, zückte ebenfalls einen Dolch, während seine Knie schon nachgaben. Nur eine Handbreit näher bei seinem Gegner, und die Klinge hätte ihn erreicht und aufgeschlitzt, aber der Priester war rechtzeitig zurückgewichen.
Zu Boden sinkend, griff Khemet nach dem Messer, das aus seiner Seite ragte. Er konnte es nicht herausziehen. Zu tief war die Klinge eingedrungen, und von der Wunde strahlte ein brennender Schmerz in seinen Körper aus.
Rasend vor Wut bäumte er sich auf, kam auf die Füße und holte mit seiner Waffe drohend aus. Der Priester ging weiter auf Distanz, machte jedoch merkwürdigerweise keinerlei Anstalten zu fliehen.
»Stell dich«, forderte Khemet, »damit ich dich ins Jenseits schicken kann, in das dereinst einzugehen du dir so sehnlich wünschst.«
Er machte einen Schritt vorwärts, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. Der Boden unter seinen Füßen schien nachzugeben. Khemet schwankte und stützte sich mit einer Hand an der Felswand ab. Zwar bewahrte er seine aufrechte Haltung, aber schon drehte sich alles um ihn.
Das ist seltsam, dachte er. Er war mindestens ein Dutzend Mal im Kampf verwundet worden und wäre einmal sogar fast verblutet, aber noch nie hatte er etwas wie dies gespürt. Er tastete nach dem Dolch, zog ihn aus der Wunde und bemerkte eine winzige Vertiefung in der Klinge.
»Das Gift war für den Steinmetz bestimmt«, erklärte der Priester. »Um sicherzugehen, dass er schweigt, nachdem er seine Arbeit beendet hat. Doch in deinem Körper wird es den gleichen Zweck erfüllen.«
Khemet rutschte der schlangenköpfige Griff des Dolchs aus der Hand. Der Grabwächter schüttelte heftig den Kopf, um die Benommenheit zu vertreiben, die mehr und mehr von ihm Besitz ergriff. Aber seine Augen spielten ihm einen Streich. Die schattenhaften Gebilde neben dem Grabmal erwachten zum Leben. Die Anubis-Statuen und das Krokodil, das die Grabplatte verzierte, bewegten sich und gaben Laute von sich, als redeten sie miteinander.
Die Grabkammer begann sich um Khemet zu drehen. Sein eigener Dolch rutschte klirrend über den Felsboden. Sich an die Wand lehnend, raffte er seine letzten Kraftreserven zusammen, stieß sich ab und streckte beide Hände nach dem Priester aus. Er wollte seinen Mantel packen, ihn zu sich heranreißen, aber seine Hände griffen ins Leere.
Khemet stürzte vornüber auf den Boden und rollte sich auf die Seite. Er hörte Musik. Stimmen. Sah jedoch nur verschwommen das Gesicht des verräterischen Priesters. Der Mann beugte sich über ihn. Seine Lippen bewegten sich, als er offenbar einen Fluch aussprach, dann richtete er sich wieder auf, ergriff einen Felsbrocken und holte aus, um Khemets Schädel zu zerschmettern.
Ehe er zuschlagen konnte, verzerrte sich jedoch das Gesicht des Priesters vor Schmerzen, während die Spitze einer Schwertklinge aus seinem Leib drang. Der Stein fiel hinter ihm herab, und der Priester brach zusammen. Er war auf der Stelle tot. Und über alle Maßen überrascht, wie seine Miene zeigte.
Der Junge tauchte hinter dem Toten auf.
»Es tut mir leid«, klagte er und sank neben Khemet auf die Knie. »Ich hätte nichts sagen sollen. Ich bin Qsn – der Unglücksbote.«
Khemet richtete den Blick auf das Kind. Von seinem Gesicht konnte er nicht viel erkennen, aber hinter Qsn entstand ein Wirbel aus Licht und Schatten, der sich wie ein Paar Schwingen ausbreitete. In seinem Todeskampf erschien Khemet der Junge plötzlich wie ein Raubvogel, gar nicht mehr klein und schwach. »Du bist der Falke«, sagte Khemet. »Du bist Horus, der letzte Beschützer der Pharaonen …«
Er streckte eine Hand aus und legte sie auf die Schulter des Jungen. Und dann verwandelte sich die Welt um ihn herum in gleißendes Gold. Und alles, was er sah und wusste, verschwand ins Nichts.
Hilflos musste er zusehen, wie Khemets Hand herabsank und eine kleine Staubwolke aufwirbelte, als sie leblos auf den Boden fiel. Die Kälte in dem Grabmal ließ ihn frösteln, es war totenstill und roch nach Tod. Von der Würde und Erhabenheit des Pharaos war nichts mehr übrig. Er hatte keine Vorstellung, was er tun sollte, wohin er sich wenden sollte, aber er wusste, dass er getötet werden würde, wenn er sich noch länger in dem Grab aufhielt.
Er sprang auf, rannte durch den engen Felskorridor zum Grabeingang und hinaus ins grelle Sonnenlicht. Die Wagenspuren und Hufabdrücke in dem hart gebackenen Untergrund führten nach Süden. Sie zeigten ihm, welchen Weg die Diebe genommen hatten. Ohne lange nachzudenken, folgte er ihnen.
Gegen Sonnenuntergang holte er eine langsam dahinziehende Karawane ein, deren schwer beladene Ochsenkarren sich dem Nilufer näherten. Dort, in einer Flussbiegung, befand sich ein natürlicher Hafen, in dem mehr Schiffe lagen, als Qsn je zuvor in seinem Leben an einem einzigen Ort gesehen hatte. Große Schiffe mit langen Rudern und hohen Segelmasten.
Einige waren am Uferkai festgemacht, andere ankerten im ruhigen Wasser, wo sie noch darauf warteten, am Kai anzulegen, sobald dort ein Platz frei wurde, und wieder andere lagen draußen im Kanal und trieben langsam stromabwärts.
Der Junge beobachtete, wie die Schätze, die den Toten den Übergang ins Jenseits erleichtern sollten, in die Schiffe eingeladen wurden. Ziegen und andere Tiere wurden ebenfalls an Bord getrieben. Nahrungsvorräte, mit Wein gefüllte Amphoren und Säcke voller Datteln und anderer Früchte stapelten sich auf den Decks. Das hektische Treiben erlaubte dem Jungen, unbemerkt an Bord eines Schiffes zu gelangen und sich zwischen den Tieren einen sicheren Platz zu suchen, wo er schon bald von Müdigkeit übermannt wurde und einschlief.
Als er aufwachte, stellte er fest, dass die Flotte, zu der auch sein Schiff gehörte, von einem stetigen Wind angetrieben nach Norden segelte. Im Dunkel der Nacht passierten sie Memphis, die Stadt, in der Ramses residierte. Am nächsten Tag durchquerten sie das zum großen Teil überschwemmte Flussdelta. Und danach gelangten sie auf das offene Meer hinaus.
Als Qsn schließlich entdeckt und von der Besatzung seines Schiffes gefangen genommen wurde, hatte die kleine Flotte die Nilmündung weit hinter sich gelassen und drang in eine Welt vor, die dem Jungen vollkommen unbekannt war.
1
Roosevelt Field, New York.
12. Mai 1927
Am Nachmittag eines sonnigen Tages Mitte Mai hatte sich eine kleine Menschenmenge am Rand eines Flugplatzes auf Long Island versammelt. Ein durch Seile abgesperrter Bereich war für Vertreter der Presse reserviert, während sich weiter hinten sensationshungriges Fußvolk drängte und um die besten Aussichtsplätze kämpfte. Auf einer kleinen erhöhten Plattform in der Nähe spielte eine Blaskapelle.
Ein Reporter schoss ein Foto von den Schaulustigen und der Kapelle. »Eins muss man Jake Melbourne lassen«, sagte der Mann mit der Kamera. »Wie man eine gute Show abzieht, das weiß er.«
Jake Melbourne, ein Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg, war ein weithin bekannter Luftakrobat und, wie der Fotograf bereits bemerkt hatte, ein ausgezeichneter Entertainer und Publikumsmagnet. Während die Berufskleidung anderer Piloten gewöhnlich aus braunen Lederjacken und langweiligen Wollhosen als Schutz vor der Kälte bestand, trug Jake eine leuchtend rote Lederkombination mit reich verzierten Epauletten. Um den Hals hatte er einen golden schimmernden Seidenschal geschlungen, seine Füße steckten in Stiefeln aus Straußenleder. Im Laufe der Jahre war er zu einer Berühmtheit geworden, da er mehrere spektakuläre Wettflüge gewonnen hatte. Jetzt wollte er sich die wertvollste Trophäe auf dem Gebiet der Fliegerei sichern: den Orteig Prize, der neben einer Medaille auch noch aus einem Preisgeld von fünfundzwanzigtausend Dollar bestand und für den Piloten bestimmt war, der den ersten Nonstopflug von New York nach Paris absolvierte. Oder in umgekehrter Richtung. Dazu musste der Atlantische Ozean in einer einzigen Etappe überwunden werden, was gewiss nicht zu schaffen sei, wie viele Menschen glaubten.
»Was hat er davon, wenn er dabei den Tod findet?«, fragte ein Reporter.
»Mindestens eine große Schlagzeile«, meinte ein zweiter Reporter.
»Sie wäre noch größer, wenn er den Preis gewinnt«, sagte ein anderer Reporter. »Wenn man es jemandem zutrauen kann, dann ihm.«
»Glaubst du wirklich, dass Melbourne es schafft?«, fragte der Fotograf. »Dass er den Preis abräumt? Was ist mit diesem Lindbergh?«
»Wen meinst du?«
»Den Typen mit dem silbernen Flugzeug. Er hat seine Maschine nebenan auf dem Curtiss Field geparkt. Er ist vergangene Woche von San Diego hierhergekommen. Und hat nebenbei einen Rekord für den schnellsten Überlandflug aufgestellt.«
»Ach, du meinst Slim«, sagte der Reporter geringschätzig. »Keine Chance. Seine Kiste hat nur einen Motor. Melbournes Maschine hat zwei und kann mehr Benzin laden.«
»Wenn ihr mich fragt – das schafft keiner«, warf ein anderer Reporter ein. »Vier Männer sind doch schon auf der Strecke geblieben. Drei andere Flugzeuge sind abgestürzt. Und das französische Team mit seinem White Bird wird noch immer vermisst. Und das schon seit einer ganzen Woche. Egal wo die jetzt sind, fliegen werden sie wohl nicht mehr.«
White Bird war die englische Übersetzung für L’Oiseau Blanc. Auf diesen Namen hatten Charles Nungesser und Françoise Coli ihr Flugzeug getauft. Sie waren am 8. Mai spektakulär in Paris gestartet, aber dann hatte man, seitdem sie die Küste der Normandie überquert hatten, nichts mehr von ihnen gehört. Die Suche nach der Maschine und ihrer Mannschaft war auf beiden Seiten des Atlantiks noch in vollem Gang, während sich Melbourne und andere auf ihre eigenen Versuche vorbereiteten.
»Hast du dich schon mal gefragt, woher er das Geld für dieses Abenteuer bekommt?«, fuhr der skeptische Fotograf fort. »Byrd hat die Wanamakers, und von Fonck wurde von Sikorski unterstützt.«
»Ich hab gehört, dass Melbourne den Flug aus eigener Tasche finanziert«, sagte der Fotograf.
»Und mir ist zu Ohren gekommen, dass er total pleite ist und dringend das Preisgeld braucht«, erwiderte der Reporter. »Er ist ein leidenschaftlicher Zocker.«
Der Fotograf zuckte die Achseln. »Na ja, es gibt wohl kaum einen höheren Einsatz als das eigene Leben. Man fragt sich doch, warum jemand überhaupt bereit ist, ein solches Risiko einzugehen.«
In einem Planungsbüro im hinteren Teil des Hangars führten Jake Melbourne und seine Geldgeber ein Gespräch über das gleiche Thema.
Melbourne mit seinen Straußenlederstiefeln, das von Pomade glänzende Haar zurückgekämmt, die rote Lederjacke halb offen und den goldenen Schal lässig um den Hals drapiert, beherrschte mit seiner imposanten Erscheinung den ganzen Raum. Sein sorgfältig gestutzter Schnurrbart verlieh ihm eine flüchtige Ähnlichkeit mit Errol Flynn. Er hatte ausgiebig geschlafen, um für den langen Alleinflug hinreichend ausgeruht zu sein, aber seine Haltung und seine Miene ließen keinen Zweifel daran, dass er genervt und wütend war. »Ich werde nicht fliegen«, verkündete er ungehalten. »Nicht mit diesem Ding an Bord.«
Er deutete auf einen kompakten Überseekoffer, der – obgleich eher klein, was seine Abmessungen betraf – außerordentlich schwer war.
Die Männer, die ihm gegenüberstanden, waren von seinem Zornesausbruch nicht im Mindesten beeindruckt. Sie waren zu dritt und von unterschiedlicher äußerer Erscheinung, aber die Familienähnlichkeit ihrer Mimik und Gestik war nicht zu übersehen.
Der ältere Mann in der Mitte – mager, bebrillt und mit schütterem Haar – verschwand fast in seinem schweren zweireihigen Wollmantel. Neben ihm stand ein Schlägertyp, der aussah, als hätte er soeben einen Bareknuckle-Kampf in einem Boxring oder auf einem Gefängnishof überstanden. Seine Nase war platt, ein Auge dunkel verfärbt, und seine Ohren waren von unzähligen Kopftreffern vollständig verformt.
Das dritte Mitglied des Trios war deutlich jünger, von mittelgroßer Statur und betrachtete sich als Jakes Freund. Aber das war in diesem Moment kaum von Bedeutung.
Es war der ältere Mann mit Brille, der reagierte. »Hör mir zu, Jake. Wir sind alle hier, um uns zu helfen. Du erinnerst dich doch sicher noch daran, dass dir die Iren beinahe die Arme gebrochen hätten, als du ihnen die dreitausend Riesen nicht zahlen wolltest, die du ihnen schuldig warst, oder? Wir haben das dann für dich erledigt. Und nicht nur das, wir haben auch deine anderen Verpflichtungen übernommen und dir geholfen, dieses Flugzeug zu kaufen. Und jetzt brauchen wir deine Hilfe.«
»Ich wollte diese Schuldscheine mit dem Preisgeld einlösen«, sagte Jake, »das war unsere Abmachung. Ihr bekommt die Hälfte, und wir verkaufen das Flugzeug. Den Rest behalte ich.«
»Das war die Abmachung«, bestätigte der ältere Mann. »Jetzt haben wir allerdings etwas anderes im Sinn. Bei diesem Geschäft kriegst du das gesamte Preisgeld. Du brauchst dafür nicht anderes zu tun, als diesen Koffer einem unserer Freunde auf dem Kontinent zu übergeben. Er meldet sich bei dir, nachdem du in Paris gelandet bist.«
Melbourne schüttelte den Kopf. »Wenn ich dieses Ding in mein Flugzeug einlade, muss ich fünfzig Gallonen Benzin zurücklassen. Dann reicht schon eine Schlechtwetterfront, und ich schaffe es nicht mehr bis nach Paris. Sollte auch noch leichter Gegenwind hinzukommen, erreiche ich noch nicht mal die Küste.«
»Du hast doch gesagt, wenn du in östlicher Richtung fliegst anstatt nach Westen, hättest du den Wind ständig im Rücken«, hielt ihm der ältere Mann entgegen.
»Ich brauche trotzdem das Benzin.«
»Vielleicht können wir irgendeins der anderen Geräte ausbauen«, sagte der Jüngste des Trios. »Wie ich gehört habe, benutzt Lindbergh kein Funkgerät. Und er soll auch auf einen Fallschirm verzichten. Er meint, beides sei zu schwer und ohnehin unzuverlässig.« Der junge Mann wandte sich zu Jake um. »Du hast mir beigebracht, wie man die Position per Koppelnavigation berechnet«, sagte er. »Dazu brauchst du nur einen Kompass und deine Uhr.«
»Lindbergh ist verrückt«, erwiderte Melbourne. »Sobald er gestartet ist, wird er genauso verschwinden wie die Franzosen. Ich brauche diese Geräte. Und ich brauche jede Gallone Benzin. Warum schickt ihr den Koffer nicht mit einem Dampfer auf die Reise? Dann treffe ich mich mit euerm Freund in Paris und sage ihm, von welchem Schiff er den Koffer abholen kann.«
Der Schlägertyp schüttelte den Kopf. »Hoovers Leute sitzen uns im Nacken, und im Hafen wimmelt es von Plattfüßen, die nach uns Ausschau halten. Außerdem, wem können wir schon trauen?«
»Hoover?«, platzte Melbourne heraus. »Soll das etwa heißen, dass sich das FBI für das Ding interessiert?«
Der ältere Mann nickte. »Es hat in der letzten Zeit ein kleines Missverständnis zwischen uns gegeben«, gab er zu. »Was meinst du, weshalb wir dich in aller Heimlichkeit unterstützt haben?«
Melbourne massierte seine Schläfen und fuhr sich mit der Hand durch sein kräftiges blondes Haar. Er trat vor, bückte sich nach dem Koffer, hatte Mühe, ihn hochzuheben, und stellte ihn wieder auf den Boden. »Viel zu schwer«, sagte er. Ob aus einem Instinkt heraus, aus Neugier oder aus reiner Dummheit oder Naivität öffnete er ihn, um nachzuschauen, was sich darin befand. »Was um alles in der Welt …«
Ein Fuß krachte auf den Kofferdeckel und schloss ihn so abrupt, dass Melbourne beinahe die Finger verloren hätte.
»Ich wünschte, das hättest du nicht getan, Jakey.« Diesmal sprach wieder der ältere Mann. Sein Fuß stand auf dem Kofferdeckel, und er hatte einen Revolver in der Hand.
»Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte Melbourne.
»Was sonst?«, sagte der Schläger. »Diese Steine sind der Beweis dafür, dass wir an allem beteiligt waren. Die Typen, die wir auf dem Bahnhof plattgemacht haben, hatten sie bei sich. Wenn wir geschnappt werden, landen wir auf dem Stuhl.«
»Ich habe nichts gesehen«, stammelte Melbourne. »Nur einen Haufen …«
Ohne seinen Satz zu beenden, holte Melbourne zu einem Schwinger aus und schlug dem alten Mann den Revolver aus der Hand. Als die Waffe klappernd über den Hangarboden rutschte, wirbelte Jake herum und sprintete zur Tür, aber der Schläger vollführte einen Hechtsprung, schlang die Arme um seine Taille, brachte ihn zu Fall und landete wie ein Sack Zement auf ihm.
Melbourne wand sich hin und her, um sich zu befreien, und schaffte es, den Absatz eines Straußenlederstiefels gegen die platte Nase des Mannes zu rammen. Blut spritzte aus den Nasenlöchern, und der Mann ließ Melbourne los und presste die Hände auf sein Gesicht.
Melbourne sprang auf und blieb wie angewurzelt stehen. Der Jüngste des Trios versperrte ihm den Weg und hielt jetzt ebenfalls eine Pistole in der Hand.
»Du musst den Koffer mitnehmen«, sagte der junge Mann. »Sonst gehen wir alle den Bach runter. Und das heißt, du genauso.«
Melbourne war in diesem Augenblick alles egal. Er zog die obere Schublade seines Schreibtisches auf und griff nach dem Derringer, der darin lag.
»Nein!«, rief der junge Mann.
Doch es war zu spät für Erklärungen. Melbourne packte die Pistole und kreiselte herum. Der Kampf endete mit zwei dicht aufeinander folgenden Pistolenschüssen.
Die Menschen, die sich am Rand des Flugfelds drängten, bekamen von den Schüssen kaum etwas mit. Gedämpft von den hohen Wänden des Hangars und überdeckt von der Musik der Blaskapelle, konnte niemand entscheiden, ob der Doppelknall von Champagnerkorken verursacht wurde oder ob der Schlagzeuger auf seiner Trommel ein markantes Break intoniert hatte oder ob es sich um Fehlzündungen eines Auto- oder Flugzeugsmotors in der Nähe gehandelt hatte.
Niemand interessierte sich mehr für die Herkunft der Knalllaute, als die Torflügel des Hangars aufschwangen und die Bodencrew Melbournes Maschine in den Sonnenschein hinausschob.
Das Flugzeug war eine echte Schönheit. Es war hellrot lackiert und trug Melbournes Namen in großen Lettern auf dem Heck. Auf der Seitenfläche der Pilotenkanzel prangte sein persönliches Wahrzeichen, ein auf Hochglanz poliertes Messingrelief eines Widderkopfs.
Abgesehen von seiner bestechenden Optik war das Flugzeug ein technisches Wunderwerk und ganz auf der Höhe seiner Zeit. Ausgestattet mit einem Ganzmetallrumpf und in Mitteldeckerposition angebrachten Tragflächen, war es ein absolutes Unikat mit Konstruktionselementen, die andeuteten, in welche Richtung sich die Flugtechnik in naher und ferner Zukunft weiterentwickeln würde. Es hatte zwei Motoren, die ihre Kraft aus Zwölf-Zylinder-Reihentriebwerken bezogen, die mit Wasser gekühlt wurden und jeweils 450 PS leisteten. Sein stromlinienförmiges Äußeres und die hohe Motorleistung verhalfen ihm zu der fast doppelt so hohen Geschwindigkeit eines gewöhnlichen Flugzeugs. Seine einzige Schwäche bestand darin, dass seine Motoren enorme Benzinmengen verbrauchten. Melbourne plante, einen Motor auszuschalten, sobald er die maximale Flughöhe erreicht hatte, dann eine Stunde lang stetig und so minimal wie möglich an Flughöhe zu verlieren, danach den ruhenden Motor wieder zu starten und erneut zur ursprünglichen Flughöhe aufzusteigen. Es war ein riskantes Unterfangen, da zweimotorige Maschinen sehr schlechte Flugeigenschaften hatten, wenn sie von nur einem Propeller angetrieben wurden. Sie präzise zu lenken, war auch bei günstigen Wetterbedingungen schwierig, und Motoren während des Fluges zu starten, glich nicht selten einem reinen Glücksspiel. Aber Melbourne nahm für sich in Anspruch, diesen Vorgang ausreichend oft geübt zu haben, und war überzeugt, den Marathonflug erfolgreich beenden zu können.
Es war genau diese Portion draufgängerischen Selbstvertrauens, die ihn zum Liebling der Massen machte. Und als er in seiner roten Jacke sowie mit Helm, Fliegerbrille und goldenem Schal hinter der Maschine hervorkam, brachen die Schaulustigen am Rand des Flugfeldes in lauten Jubel aus. Er verbeugte sich, winkte ihnen zu und kletterte auf die Tragfläche des Flugzeugs.
Auf seinem Standort hinter der Absperrung hob der Fotograf seine Ansco Memo Box Camera, um ein Foto zu schießen. Aber als er sie auf die Maschine richtete und Jake genau im Visier hatte, drückte der Reporter neben ihm die Kamera nach unten, der Verschluss klickte, und der Fotograf wusste, dass auf dem entwickelten Foto später nur verschwommene Schemen zu erkennen wären.
»Was soll das?«, fragte er verärgert.
»Fotografiere niemals einen Piloten vor seinem Flug«, erklärte ihm der Reporter. »Das bringt Unglück.«
Enttäuscht seufzte der Fotograf. »Kann ich eine Aufnahme von dem Flugzeug machen?«
»Klar, aber erst wenn es rollt.«
Während der Fotograf wartete, stimmte die Kapelle die bekannte Komposition »Grand Old Flag« von George M. Cohan an. Die Zuschauer sangen aus vollem Hals mit, während sich Melbourne in den Pilotensitz zwängte. Es dauerte nur Minuten, bis beide Motoren ansprangen, rundliefen und die Golden Ram sich zum fernen Ende der Rollbahn in Bewegung setzte. Es gab keine Vorflug-Checks und auch keine weiteren Verzögerungen, die zur Folge hätten, dass das Flugzeug auf dem Boden ausharrte und sinnlos Benzin verbrauchte. Es rollte zur Startbahn, drehte sich in den Wind und beschleunigte.
Der Fotograf machte ein Foto und ließ die Kamera sinken.
Trotz ihrer beiden Motoren nahm die Maschine nur langsam Tempo auf. Etwa nach der Hälfte der Startbahn kam das Heckrad hoch. Dann – nur noch das letzte Viertel der Startbahn lag vor ihr – löste sich die Maschine vom Boden und kletterte in die Luft, wobei sie um jeden Zentimeter Höhe zu kämpfen schien.
Jeder der Zuschauer hielt die Luft an. Viele von ihnen hatten miterlebt, wie René Foncks überladenes Flugzeug vor einem Jahr am gleichen Ort abgestürzt und in Flammen aufgegangen war. Sie würden alles daransetzen, die Golden Ram allein mit der Kraft ihres gebündelten Willens in den Himmel zu katapultieren.
Kurz vor Ende der Rollbahn warf das Flugzeug das Fahrgestell ab, da man zu der Überzeugung gelangt war, dass es wenig Sinn ergab, zweihundert Pfund Metall nach Paris mitzuschleppen, wenn die Maschine auf der Kufe unter ihrem Rumpf landen konnte.
Vom Fahrwerk befreit, stieg die Maschine schneller und schwang sich elegant über die Telefondrähte hinweg, die sich entlang der Straße am Ende der Startbahn von Mast zu Mast spannten. Erst jetzt machte der Fotograf seine letzte Aufnahme. Er erwischte das rote Flugzeug in dem Augenblick, als es nach Osten schwenkte, Kurs auf die Küste nahm und die Sonnenstrahlen dem polierten Widderkopf zu goldenem Glanz verhalfen. Der Atlantische Ozean winkte, und auf der anderen Seite lockten Paris, Ruhm und Reichtum.
Am nächsten Morgen entwickelte der Fotograf seine Aufnahmen. Seine Bilder von der Golden Ram würden während des nächsten Monats häufig abgedruckt werden, zuerst in Verbindung mit Artikeln, in denen von der großen Hoffnung am Tag des Starts zu dem Flug die Rede war, dann während der ergebnislosen Suche nach der Maschine, die noch einige Wochen lang nach dem Verschwinden der Golden Ram andauern sollte.
Trotz der Möglichkeit, es für eine hohe Summe verkaufen zu können, würde der Fotograf den leicht verschwommenen Schnappschuss von Jake Melbourne, während er auf die Tragfläche seiner Maschine kletterte, niemals zur Veröffentlichung freigeben.
»Es bringt Unglück«, hatte der Reporter über einen solchen Schritt gesagt. Und für den Rest seines Lebens sollte er überzeugt sein, dass genau dies geschehen war.
2
Nordatlantik, vor der Küste Schottlands
Gegenwart
Sturmböen fegten über einen Hundert-Fuß-Trawler hinweg und pfiffen um die Masten und Kranausleger herum, die von dem Deck aufragten. Regen und Gischt umtosten das Schiff und peitschten gegen die Fenster der Kommandobrücke, während sich die See ringsum unter dem düsteren grauen Himmel in ein weites Feld schaumgekrönter Brecher verwandelte.
Ein schwerer atlantischer Sturm, der sich für kurze Zeit zu einem Orkan gesteigert hatte, zog nach Norden in Richtung Neufundland und kehrte schließlich zurück, um Irland anzusteuern. Es war das seit zwanzig Jahren zweitstärkste Unwetter, das die Britischen Inseln heimsuchte, und es war schneller in diese Breiten vorgedrungen, als von den Meteorologen vorhergesagt worden war.
Auf dem Trawler besetzten drei Männer die Kommandobrücke. Einer klammerte sich an das Ruder des Schiffes, während die beiden anderen sich an allem festhielten, das ihnen half, auf den Füßen zu bleiben.
»Halt das Schiff frontal zum Wellengang«, rief der Kapitän dem Steuermann zu.
»Ich gebe mir alle Mühe«, erwiderte der Rudergänger. »Aber der Wind dreht ständig, Käpt’n. Über kurz oder lang werden wir außer Kurs geweht.«
Beide Männer hatten einen ausgeprägten schottischen Akzent, unüberhörbares Zeugnis ihrer nördlichen Herkunft. Aber trotz ihrer Bemühungen musste der Trawler kämpfen, um den Naturgewalten zu trotzen.
Als es auf den Gipfelpunkt einer langen Dünung gehoben wurde und auf der Rückseite der Welle seitlich steil abwärts sank, neigte sich das Schiff weit nach Steuerbord und drohte zu kentern. Der Rudergänger hatte keine andere Wahl, als den Abwärtskurs beizubehalten und das Schiff dem Spiel der Welle zu überlassen.
Doch auch in diesem Augenblick schien es, als ob das Schiff in jedem Moment ins Rollen geriet, bis sein Bug auf den tiefsten Punkt des Wellentals sackte. Der Rumpf ächzte gequält, und die Nase des Trawlers richtete sich steil auf und schüttelte die Wassermassen ab, die ihn beinahe überspült und verschluckt hätten.
Indem er seine Schritte den Bewegungen des Schiffes anpasste, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, tastete sich der Kapitän zum Navigationscomputer vor. Sich am Rand der Konsole abstützend, warf er einen Blick auf den Bildschirm. Der Radarstrahl zeigte eine zweite – noch solidere – Regenfront im Norden, aber nichts dahinter. Im Osten ertastete er eine kleine Anzahl von Hindernissen und die felsige Küste der Isle of Skye.
Während sie auf den nächsten Wellenkamm gehievt wurden, hüllte sie eine Wolke Sprühnebel ein, versteckte ihre Umgebung hinter einem Schlierenvorhang auf den Scheiben und klang wie ein Hagelsturm. »Das sieht nicht gut aus«, sagte der Kapitän. »Um die Landspitze ist es nicht zu schaffen. Wir sollten uns eine sichere Zuflucht vor dem Unwetter suchen.«
Dagegen hatte der dritte Mann auf der Brücke – sein Name lautete Vincennes – etwas einzuwenden. Klein von Wuchs, schmale Schultern und mit einem runden, weichen Gesicht, sah er nicht so aus, als sei er daran gewöhnt, Befehle zu erteilen. Der harte Glanz und strenge Ausdruck seiner Augen ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass diese Einschätzung keinesfalls zutraf. »Keine Umwege«, erklärte er mit Nachdruck, trat neben den Kapitän und tippte mit dem Finger auf den Radarschirm. »Wir bleiben auf Kurs nach Dunvegan.«
Vincennes war zwar weder Schiffsoffizier noch gehörte er zur Schiffscrew, aber er hatte diese Überfahrt bezahlt und war entschlossen, sein Ziel unter allen Umständen zu erreichen.
»Hören Sie«, sagte der Kapitän. »Der Sturm ist mittlerweile weitergezogen, sodass der Wind jetzt von Nordosten kommt. Momentan liegt die Isle of Skye zwischen uns und dem Zentrum des Unwetters. Aber sobald wir den Leuchtturm am Neist Point passieren, dürften die Wellen doppelt so hoch sein, und das Boot wird dem Wind ungeschützt ausgesetzt sein. Die Böen werden das ein oder andere abreißen. Darunter Dinge, die wir dringend brauchen wie Antennen, Radarmasten und Rettungsinseln. Ein schwerer Brecher, und wir verlieren eine Luke oder ein Fenster, und dann dringt Wasser ein. Verstehen Sie?«
Vincennes starrte ihn wortlos an.
Für den Fall, dass er sich nicht verständlich genug ausgedrückt hatte, fasste der Kapitän es für ihn noch einmal zusammen. »Wir werden es heute nicht mehr bis nach Dunvegan schaffen. Das Einzige, worüber wir jetzt entscheiden können, ist, ob wir die Nacht geschützt in einer Bucht verbringen oder ob wir hier draußen absaufen.«
Der Steuermann bot eine Lösung ein. »Wenn wir uns ins Loch Harport flüchten können, sind wir vor dem Sturm in Sicherheit. Das Loch wird auf drei Seiten abgeschirmt. Und von dort sind es nicht mehr als zwanzig Kilometer Straße bis nach Dunvegan.«
Nachdem er seinen Vorschlag beendet hatte, war das Boot auf den nächsten Wellenkamm gehoben worden und tauchte nun ins nächste Wellental hinab. Die drei auf der Kommandobrücke und die restliche Schiffsbesatzung wappneten sich für den Absturz und den unausweichlichen rasanten Aufstieg, der darauf folgte.
Diesmal bohrte sich der Bug in die anrollende Welle und tauchte nur für einen kurzen Moment in die Wasserwand ein. Der Wellenkamm stürzte sich mit beängstigendem Tempo auf die Kommandobrücke. Wie ein gigantischer Hammer krachte er gegen den Aufbau, verursachte einen Sprung in einer der sturmsicheren Fensterscheiben und schüttelte das gesamte Schiff bis zum Kiel kräftig durch.
Der Aufprall der Wassermassen erschreckte Vincennes. Er zuckte zusammen, duckte sich und richtete sich anschließend langsam wieder auf. Offensichtlich war er überrascht, vollkommen trocken zu sein. »In Ordnung«, sagte er mit einem Kopfnicken zum Kapitän. »Suchen Sie Schutz in der Bucht. Aber keine Funksprüche. Niemand darf erfahren, dass wir hier sind.«
Der Kapitän gab dem Steuermann ein Zeichen. Er war bereits im Begriff, den Kurs entsprechend zu ändern.
Von Windböen attackiert, schwenkte der Trawler schwerfällig nach Nordosten. Damit geriet das Schiff auf einen Kurs nahezu frontal zum Wellengang. Das unkontrollierbare heftige Rollen und Schlingern, das sie fast den halben Tag hatten ertragen müssen, nahm spürbar ab.
Nach einer weiteren Stunde kam die äußere Bucht des Lochs in Sicht. Die Einfahrt war breit, wies jedoch zahlreiche kleine Felsinseln und schwierig zu ortende Untiefen auf.
»Achte auf die Strömung«, warnte der Kapitän den Steuermann. Er spürte, wie sie auf den Trawler einwirkte, ihn hin und her schob und vom eingeschlagenen Kurs ablenkte.
Die Wellen selbst entpuppten sich als weiterer erheblicher Störfaktor. Draußen im Kanal folgte ihr Kreislauf einem regelmäßigen und vorhersagbaren Muster, aber je näher das Boot der Küste kam, desto chaotischer wurde das Muster, als die Wellen auf Hindernisse trafen und von den Wänden der Felsformationen zurückgeworfen wurden. Wurde der Trawler soeben noch von hinten angeschoben, traf ihn im nächsten Moment eine Querwelle in Höhe des Bugs.
Es dauerte nicht lange, bis sie mit ernsten Problemen zu kämpfen hatten. »Wir sind nicht mehr in der Fahrrinne«, rief der Kapitän, während er ihre aktuelle Position mit den Angaben auf dem Display des Navigationscomputers verglich. »Hart nach Steuerbord.«
»Wir sind weit draußen«, meldete der Steuermann.
Abgedrängt von der Strömung, mussten sie jetzt auch noch gegen den Wind kämpfen. Beides war zu viel. Der Trawler ließ die Fahrrinne immer weiter hinter sich und wurde in Richtung einer Untiefe geschoben.
Das grässliche Geräusch von knirschendem Stahl hallte durch den Schiffsrumpf.
Der Rudergänger versuchte, den Schaden in Grenzen zu halten. Bei dem Geräusch der ersten Grundberührung nahm er Fahrt zurück, kurbelte am Ruder und wartete auf das Aufbuckeln der nächsten Dünung, ehe er wieder auf volle Kraft voraus ging.
Die durchlaufende Welle hob sie hoch und befreite sie, aber der Trawler reagierte nur zögernd und war soeben erst im Begriff, Fahrt aufzunehmen, als das Wellental das Schiff erreichte und der Rumpf abrupt absackte.
Die zweite Grundberührung war noch heftiger als die erste. Der Kapitän und Vincennes verloren das Gleichgewicht und stürzten aufs Deck. Der Rudergänger konnte sich zwar gerade so auf den Füßen halten, wurde jedoch gegen die Steuerkonsole geschleudert. Er nahm abermals Fahrt zurück, als ein Bilgenalarm ertönte.
»Was ist das?«, fragte Vincennes.
»Wasser dringt ein«, antwortete der Kapitän. »Wir haben ein Loch im Rumpf.«
»Heißt das, wir sinken?«
Der Kapitän ignorierte die Frage. »Volle Kraft«, befahl er. »Nutz die Strömung, bis wir die Felsen hinter uns haben, dann nimm Kurs auf den nächsten Uferabschnitt. Unsere einzige Hoffnung ist, den Strand zu erreichen.«
Der Steuermann führte den Befehl aus, aber der Trawler verhielt sich wie ein Spielzeugschiff im Sturm. Selbst bei voller Kraft rührten sie sich nicht vom Fleck. »Der Propeller entwickelt keinen Vortrieb, Käpt’n. Durchaus möglich, dass er sich an den Felsen selbst zerlegt hat.«
»In diesem Fall sind wir geliefert«, erwiderte der Kapitän.
Eine weitere Welle traf sie von der Seite, drückte sie herum und schob sie auf die Felsen unter der Wasseroberfläche. Knirschend kamen sie zur Ruhe und hingen auf den Felsen fest. Der Ruck beim Aufsetzen warf den Kapitän und Vincennes abermals aufs Deck.
»Was nun?«, fragte Vincennes und versuchte aufzustehen.
Der Kapitän war vor ihm auf den Beinen und blickte durch das nächste Fenster auf einen Ausschnitt der tobenden See, der vom Scheinwerfer des Trawlers beleuchtet wurde. In seinem Licht sah er die Felsenfalle, in der sie gefangen waren. Er wusste, wie es jetzt weitergehen würde. Die Brecher würden sie attackieren, während die Felsen sein Schiff auseinanderrissen. »Wir werden sterben.«
Die Anfahrt des Trawlers war von den Gästen der McCloud Tavern, die sich zwanzig Meter über dem Strand erhob, der mit von der Brandung glatt geschliffenen Steinen bedeckt war, interessiert beobachtet worden. Gespannt hatten sie verfolgt, wie sich das Schiff mit voller Festbeleuchtung der Einfahrt zum Loch näherte.
Eine lebhafte Diskussion teilte den Gastraum in zwei Lager. Während die eine Hälfte der Gäste den Mut und die Tapferkeit der Schiffscrew bewunderte, staunte die andere Hälfte über die unglaubliche Dummheit der Schiffsbesatzung, sich bei diesem Wetter überhaupt auf die See hinausgewagt zu haben.
»Dieser Sturm wurde doch schon vor drei Tagen angekündigt«, sagte ein Mann.
»Aye«, pflichtete ihm eine Frau bei. »Und er hat nicht lange auf sich warten lassen. Außerdem ist er um einiges heftiger, als es im Fernsehen vorhergesagt wurde.«
»Recht hast du«, sagte der Mann und prostete der Frau mit seinem Bierkrug zu. »Diesem Verein kann man sowieso nicht über den Weg trauen. Und selbst wenn, muss man schon ganz schön bescheuert sein, bei diesem Wetter auf See zu bleiben.«
Die Argumente flogen so schnell hin und her wie die Punsch- und Biergläser zwischen den Tischen und der Theke. In der Hoffnung, dass es die Männer auf dem Schiff heil an Land schafften, hielt der Barkeeper eine besondere Flasche Scotch bereit, um mit ihnen auf ihre Gesundheit anzustoßen. Aber der Spaß hatte ein Ende, und die launige Diskussion verstummte, als klar wurde, dass der Trawler in ernsten Schwierigkeiten steckte.
»Sie sind auf Grund gelaufen«, sagte einer der älteren Männer, als das Schiff stecken blieb und sich nicht mehr vom Fleck rührte. »Ich bin selbst mal beinahe auf diesen Felsen hängen geblieben. Die sind scharf und spitz wie Drachenzähne.«
»Es hat gar keinen Notruf gegeben«, meinte der Barkeeper.
Wie in vielen kleinen Küstenorten ging auch hier die Hälfte der erwachsenen männlichen Bevölkerung dem Beruf des Fischers nach. Seefunkgeräte waren reichlich vorhanden. Und während eines Unwetters hatte fast jeder den Notrufkanal eingeschaltet.
Der Barkeeper griff zum Telefonhörer, um die Küstenwache zu benachrichtigen.
»Sie werden es niemals schaffen, mit einem Hubschrauber rechtzeitig hier zu sein«, sagte der alte Mann. »Und ein einziger Seenotrettungskreuzer reicht nicht aus. Nicht bei diesem Wetter.«
Trotz des Kommentars des Mannes entfernte sich der Barkeeper, um zu telefonieren. Als er seinen Platz am Fenster verließ, trat ein weiterer Mann vor und suchte sich einen Platz zwischen den anderen, die den Kampf des Trawlers verfolgten.
Sie musterten ihn von der Seite. Er war hochgewachsen, schlank und hatte silbergraues Haar. Seine ebenmäßigen energischen Gesichtszüge waren vom Wetter gegerbt. Er war kein Einheimischer, wirkte jedoch wie jemand, der eng mit der See verwachsen war.
Der Fremde betrachtete den Trawler einige Sekunden lang durch ein kompaktes Fernglas. »Wie weit draußen liegen diese Felsen?«
»Von hier aus ist das weniger als eine Meile entfernt«, sagte der alte Mann.
Der Fremde setzte das Fernglas abermals an die Augen, richtete es jedoch diesmal auf einen anderen, seitlich versetzten Uferbereich, wo eine zerklüftete schmale Landzunge in die Bucht hinausragte. »Und vom nächsten Punkt auf diesen Streifen Festland?«
»Eine Viertelmeile«, schätzte der alte Mann. »Vielleicht auch etwas weiter. Weshalb?«
Der Fremde ließ das Fernglas sinken. Er wandte sich zu dem alten Mann um und sah ihn an. Seine tiefblauen Augen leuchteten geradezu in dem trüben grauen Licht, das im Gastraum der Dorfkneipe herrschte. »Weil Sie recht haben. Bei diesem Wetter reicht ein Rettungsboot nicht aus.«
Nach diesen Worten wandte sich der Fremde um und durchquerte den Pub. Er gab seinem Freund, der in der Nähe der Theke saß, ein Zeichen, und gemeinsam verließen sie den Gastraum und verschwanden nach draußen.
Die Frau wechselte mit dem alten Mann einen fragenden Blick. »Wer sind die?«
Der Mann zuckte die Achseln. »Fremde.«
3
An Bord des Trawlers hatte sich die Lage von gefährlich zu verzweifelt verschlimmert. Das Schiff lag mit zehn Grad Schlagseite auf den Felsen, nahm durch ein Leck in Kielnähe Wasser auf, während das Unwetter mit unverminderter Wucht weitertobte und nichts darauf hinwies, dass mit einem baldigen Nachlassen des Sturms gerechnet werden konnte.
Der Steuermann, der sich schuldig fühlte und glaubte, für die Havarie des Schiffes verantwortlich zu sein, wandte sich an den Kapitän. »Es tut mir leid, ich hätte vielleicht einen weiteren Bogen beschreiben sollen.«
»Es gab nichts, was du hättest tun können«, sagte der Kapitän, schaltete die Gegensprechanlage ein und rief den Chefingenieur. »Wie schlecht sieht es aus?«
»In der Bilge stehen drei Fuß Wasser. Sie füllt sich rasant. Wir müssen das Schiff verlassen, solange es noch halbwegs aufrecht im Wasser liegt.«
Dies hörte Vincennes und schüttelte heftig den Kopf. »Nein«, schnappte er, »wir können das Schiff nicht verlassen. Wir müssen es irgendwie von diesen Felsen herunterbekommen und wieder flottmachen.«
»Allein den Felsen ist zu verdanken, dass wir noch nicht untergegangen sind«, schoss der Kapitän zurück. Er drückte wieder auf den Sprechknopf des Intercoms. »Trommle deine Leute zusammen und komm mit ihnen nach oben an Deck. Wir lassen die Rettungsinseln zu Wasser.«
Der Befehl zum Evakuieren des Schiffes war kaum verklungen, als Vincennes vor Wut rot anlief. Drohend richtete er einen Finger auf den Kapitän. »Wenn das irgendein mieser Trick ist …«
Was immer er noch weiter gesagt hatte, ging in einem Donnerschlag unter, als ein riesiger Brecher gegen das Schiff anrollte, es breitseits erwischte und weiter auf die Steuerbordseite kippte.
»Wenn Sie an Bord bleiben wollen, nur zu. Tun Sie, was Sie nicht lassen können«, rief der Kapitän. »Meine Männer und ich empfehlen uns.«
Vincennes verfolgte mit einem Ausdruck ohnmächtiger Wut, wie Männer aus dem Schiffsrumpf die Treppe heraufkamen. Da er erkennen musste, dass er den Kapitän nicht umstimmen konnte, wartete er, bis der letzte Matrose an Deck erschienen war, schlug die entgegengesetzte Richtung ein, kehrte zum Ruderhaus zurück und stürmte die dortige Treppe hinunter.
Der Rudergänger machte Anstalten, ihm zu folgen, aber der Kapitän hielt ihn zurück. »Er ist mein Problem, Kumpel. Bleib an Deck und sorg dafür, dass die Männer zusammenbleiben. Lasst die Rettungsinseln zu Wasser, wenn die Wellen am höchsten sind, nicht vorher oder nachher, sonst habt ihr keine Chance. Verstanden?«
Der Steuermann nickte, schlüpfte in seine Schwimmweste und zwängte sich durch die Steuerbordtür. Sobald er ins Freie trat, drohte ihn der Wind umzuwehen. Er hielt sich an der Reling fest und kämpfte, um auf dem schrägen Deck auf den Füßen zu bleiben.
Viel schlimmer hätte ihre Lage gar nicht sein können. Die Schlagseite betrug mittlerweile fast zwanzig Grad, und sie lagen schräg auf den Felsen. Die Backbordseite des Schiffes stand hoch, bildete einen Schutzwall vor dem Sturm und verhinderte, dass das Schiffsdeck von jedem Brecher überspült wurde. Aber jedes Boot, das auf dieser Seite ins Wasser abgelassen wurde, würde gegen den Rumpf des Trawlers geschmettert werden, ehe es sich weit genug von dem Havaristen entfernen könnte.
Die Steuerbordseite des Decks bot anscheinend weitaus bessere Chancen auf eine Rettung. Der Trawler neigte sich auf diese Seite, und der Rand des Decks wurde bereits von der aufgewühlten See überspült. Das Schiff an dieser Stelle zu verlassen, erschien um einiges einfacher, aber jenseits der Reling lauerte dicht unter der Wasseroberfläche ein Wald messerscharfer Felsnadeln.
Die Felsen verschwanden jedes Mal, wenn sich eine Welle aufbuckelte, nur um gleich wieder aufzutauchen, kaum dass sie sich verlaufen hatte. Sie kamen ihm wie die Reißzähne eines hungrigen Raubtiers vor. Dennoch, so entschied er, war eine kleine Chance allemal besser als gar keine.
Er stieg die Leiter hinunter, überquerte das Deck und gelangte zur mittschiffs gelegenen Musterstation, wo die Schwimmwesten und Rettungsinseln bereitlagen. Als er dort eintraf, hatten mehrere Männer bereits damit begonnen, eine der Rettungsinseln aufzublasen.
Die mit Gas gefüllten Druckflaschen füllten das Floß in Sekundenschnelle, aber der Wind und das schwankende Deck machten es nahezu unmöglich, das Floß unter Kontrolle zu halten.
»Sichert die Leinen!«, rief der Steuermann.
Noch während er seine Anweisungen gab, erzitterte der angeschlagene Trawler unter dem Aufprall eines weiteren Brechers. Eine Gischtwolke flog über sie hinweg, während sich eine dreißig Zentimeter hohe Wasserflut die erhöhte Backbordseite herab ergoss. Sie riss zwei Männer von den Füßen und schwemmte das Floß ins Meer.
Durch ein zwanzig Meter langes Seil mit dem Trawler verbunden, war die Insel noch nicht verloren.
Der Steuermann rannte über das Deck. »Packt die Leine«, rief er und ergriff mit beiden Händen das Nylonseil. Nachdem ihm zwei Mannschaftsmitglieder zu Hilfe gekommen waren, zogen sie mit aller Kraft, konnten das Floß jedoch nur ein kurzes Stück zu sich heranhieven, ehe die nächste Welle das Deck erreichte.
Sie ergoss sich über das Schiff und über alles, was ihr im Weg war, indem sie es sowohl vom Heck als auch vom Bug her überflutete. Sie erwischte das Rettungsfloß, riss den Männern die Leine aus den wunden Händen und kippte es auf den Rücken, während sie es den felsigen Reißzähnen in den schäumenden Fluten zum Fraß vorwarf.
Eine Seite der aufblasbaren Rettungsinsel wurde aufgerissen, als sie über die Felsnadeln schrammte. Das orangefarbene Boot verlor seine Form und wurde vom Meerwasser überspült. Die nächste Welle machte ein schnelles Ende mit der Insel und wickelte ihre schlaffe Kunststoffhaut um eine der Felsspitzen.
Die Schiffscrew hatte das Zerstörungswerk aus nächster Nähe verfolgen können. Alle wussten, welche Bedeutung es für sie hatte.
»Wir sitzen in der Falle«, rief einer der Männer. »Selbst wenn wir es schaffen sollten, ein zweites Rettungsfloß startklar zu machen, kommen wir hier nicht mehr lebend weg.«
»Dieser Sturm hat ein Zentrum – ein Auge, in dem es vollkommen ruhig ist«, gab ein anderer Mann zu bedenken. »Wenn wir abwarten und diese kurze Pause nutzen, haben wir vielleicht eine Chance.«
»Das Auge des Sturms ist einige Stunden weit entfernt«, meinte ein Dritter. »Bis dahin ist das Schiff nur noch ein Haufen Schrott.«
»Seid mal still«, rief der Steuermann. Er glaubte über dem Wind das Geräusch eines Motors gehört zu haben, legte den Kopf in den Nacken und suchte den Himmel ab – in der Hoffnung, einen Helikopter der Royal Navy zu entdecken. Doch alles, was er sah, war eine dichte graue Wolkendecke.
»Dort – seht mal«, rief einer der Männer. Er deutete auf den Kanal.
Der Steuermann fuhr herum, kniff zum Schutz vor Wind und Regen die Augen zusammen und entdeckte schließlich ein torpedoförmiges Boot, das mit hohem Tempo durch die Wellen schoss. Was auch immer dieses Vehikel sein mochte, es beschrieb einen weiten Bogen, verschwand hinter dem Buckel einer schweren Dünung und tauchte wieder auf, als die Welle weiterrollte.
»Seht ihr das?«
Bestätigendes Murmeln beantwortete seine Frage.
»Das kann nur ein total Geisteskranker sein.«
Der total Geisteskranke war ein Mann auf einem Hochgeschwindigkeitswasserfahrzeug, das starke Ähnlichkeit mit einem Jet-Ski hatte. Es war jedoch länger und breiter, mit einer plattformähnlichen Verlängerung hinter den Passagiersitzen, einer dicken runden Nase und einer deutlich breiteren Basis.
Das Vehikel war mit hohem Tempo unterwegs und offenbar extrem wendig, und sein Lenker kannte anscheinend keine Furcht, als er auf einem Wellenkamm balancierte, sich dahinter ins Wellental hinabstürzte und direkt auf den manövrierunfähigen Trawler zuhielt.
»An den Felsen kommt er nicht vorbei. Keine Chance.«
Dem konnte der Steuermann nicht widersprechen. Aber als eine knochenbrechende Kollision unausweichlich schien, rollte die nächste Dünung durch. Das Wasser stieg, bedeckte die Felsnadeln und hob die heranfliegende Maschine über sie hinweg.
Der Lenker überquerte nicht nur das gefährliche Hindernis, sondern gelangte sogar bis auf das geneigte Deck des Trawlers, wo er seinen Ritt mit einer Art kontrollierter Kollision beendete.
Die Schiffscrew kam eilig bei dem exotischen Verkehrsmittel zusammen, von dem der Mann abstieg, um es mit einem soliden bruchsicheren Karabinerhaken an der zweiten Sprosse einer Leiter in der Nähe des Deckaufbaus zu sichern.
»Sind Sie okay?«, rief der Steuermann.
Vor sich sah er einen hochgewachsenen Mann in einem Nasstauchanzug, der ein Allwetter-Headset über einem von Seewasser triefenden silbergrauen Haarschopf trug. Das Gesicht des Mannes hatte seit mindestens einer Woche keinen Rasierapparat mehr gesehen, aber unter den Bartstoppeln schien er fröhlich zu grinsen.
»Dies ist aber kein geeigneter Ort, um mit einem Schiff anzulegen«, sagte der Neuankömmling.
Der Steuermann lachte und vergaß für einen kurzen Moment, wie angespannt ihre Lage war. »Jetzt einen besseren Liegeplatz zu finden, dürfte schwierig sein. Besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Rettungsfloß an ihren Renner hängen und ihn ins freie Wasser schleppen können?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Zu schwer. Wir kommen niemals an den Felsnadeln vorbei, ehe sich der nächste Brecher formiert.«
»Vielleicht können Sie uns einzeln herausholen? Als Beifahrer sozusagen.«
»Das wäre möglich, würde aber zu lange dauern«, sagte der Fremde. »Nein, wir bringen Sie auf die altbewährte Methode in Sicherheit.«
Der Steuermann beobachtete, wie der Mann ein schlankes Kabel vom Heck seines Wasserfahrzeugs löste. Er packte es fester und zog kräftig daran, sodass es zum Teil hinter ihm aus dem Wasser auftauchte. Offenbar sollte es sich über der vom Sturm aufgewühlten Meeresbucht spannen.
Der Fremde trug ein Ende des Kabels zum nächsten Kranausleger, den die Mannschaft gewöhnlich benutzte, um die Fischnetze auszubringen. Er kletterte einige Stahlsprossen hinauf, die an dem Ausleger angeschweißt waren. An einem Punkt, höher als jede Vernunft bei diesem Wetter erlaubte, schlang er das Kabel um eine Strebe des Auslegers und fixierte es mit einem Spezialknoten.
Nachdem er das Kabel auf diese Weise gesichert hatte, drückte er das Mikrofon näher an seinen Mund und sprach zu jemandem am anderen Ende der Verbindung.
Irgendwo in der Ferne begann eine Winde das durchhängende Kabel zu straffen. Gleichzeitig stieg das Kabel in seiner gesamten Länge aus den Fluten auf. Erst jetzt begriff der Steuermann, was der Fremde im Sinn hatte. »Eine Hosenboje«, rief er entgeistert.
»Eine was?«, fragte eines der Mannschaftsmitglieder.
»Betrachte sie als eine Seilrutsche«, sagte der Steuermann. »Sie trägt uns über das Wasser ans Ufer.«
Der Fremde kletterte vom Kranausleger herab, nahm den Rucksack von der Schulter und holte mehrere Gurtgeschirre heraus, die jeweils an einer Laufkatze mit Rollen befestigt waren.





























