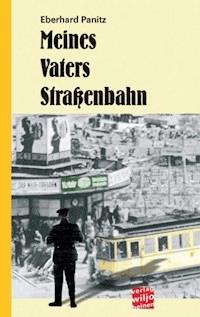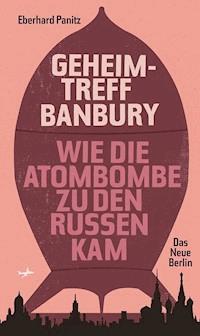
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Wunderwaffe, die Atombombe, an der amerikanische und britische Wissenschaftler seit 1940 bauten, sollte die Vormachtstellung der USA sichern. Was Truman und Churchill nicht ahnten: Die Sowjets waren bestens informiert. Ein Mann aus dem Forschungsteam und eine russische Agentin spielten ihnen die Formel in die Hände. 60 Jahre nach den Ereignissen reiste Eberhard Panitz nach Banbury, wo einst Klaus und Sonja, als Liebespaar getarnt, durch die Gässchen schlenderten und dabei die hochbrisanten Informationen austauschten. Wer war Sonja? Wer war Klaus Fuchs? Anhand persönlicher Briefe, Tagebuchaufzeichnungen und Berichten von Zeitzeugen rekonstruiert Panitz zwei bemerkenswerte Lebenswege.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
ISBN eBook 978-3-3v60-50049-6
ISBN Print 978-3-360-01977-6
© 2009 (2003) Verlag Das Neue Berlin, Berlin
2., erweiterte Auflage
Illustration und Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Das Neue Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Neue Grünstr. 18, 10179 Berlin
Die Bücher des Verlags Das Neue Berlin
erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de
Der Verlag bedankt sich für die freundliche Genehmigung des Pahl-Rugenstein Verlags Nf., Bonn, zum Abdruck zweier Wochenberichte von Emil Fuchs.
Die Quelle lautet: Erwin Eckert/Emil Fuchs: Blick in den Abgrund. Das Ende der Weimarer Republik im Spiegel zeitgenössischer Berichte und Interpretationen. Herausgegeben und eingeleitet von Friedrich-Martin Balzer und Manfred Weißbecker. Bonn 2002, S. 493–497, S. 510–511
Eberhard Panitz
Geheimtreff Banbury
Wie die Atombombe zu den Russen kam
Das Neue Berlin
Inhalt
Der Weg nach Banbury
Die frühen zwanziger Jahre
In China
Antifaschist und Kommunist
Mukden, Warschau, Danzig und in der Schweiz
Physikerkarriere in England
Liebesbriefe aus Oxford
Entscheidung in Birmingham
Banbury
Familie
Los Alamos
Great Rollright
Nachkrieg in Harwell
Beginn der Legenden
Gegenwärtige Vergangenheit
Nachwort des Verfassers
Literatur
Der Weg nach Banbury
An einem sonnigen Septembermorgen des Jahres 1942 stieg Sonja, eine Frau von fünfunddreißig Jahren mit kurzem schwarzen Haar, in Oxford-Summertown aufs Fahrrad und fuhr zu einem kurzfristig vereinbarten Treffen nach Banbury. »Es ist eine heiße Sache«, hatte Jürgen, ihr Bruder, zu ihr gesagt. Sie solle sich in der High Street, vorm Schaufenster eines kleinen Buchladens, mit einem Deutschen namens Klaus Fuchs treffen. Er sei ein guter Genosse, ein prachtvoller Mensch und ein tüchtiger Wissenschaftler, der Einblick in wichtige militärisch-technische Entwicklungen habe. Genaueres über seine Herkunft und Tätigkeit wusste sie nicht, als sie sich auf den Weg machte, auch nicht, dass er zum engsten Kreis der Kernphysiker gehörte, die am Bau der Atombombe Englands und der USA arbeiteten. Aber noch ehe dieser Tag vorüber war, ahnte sie, welche Bedeutung den Auskünften zukam, die dieser Mann ihr an jenem Tag anvertraute und für weitere Treffen zusicherte.
Fast fünfzig Jahre bewahrte Sonja – mit Geburtsnamen Ursula Kuczynski, in erster Ehe Ursula Hamburger, in zweiter Ehe Ursula Beurton, als Schriftstellerin Ruth Werner – striktes Schweigen über diese Begegnung in Banbury und spätere Kontakte und die Konsequenzen, die sich bis heute für unser aller Schicksal kaum ermessen lassen. Kein Zweifel, dass sie die Erinnerung daran nie losließ, obwohl sie selbst mit den nächsten Angehörigen und Freunden bis kurz vor ihrem Tod so gut wie nie darüber sprach und auch in ihren Büchern diese folgenreichste Begegnung ihres Lebens verschwieg. Nicht einmal in »Sonjas Rapport«, ihrem Lebensbericht, der 1977 erschien, werden die Treffen mit Klaus Fuchs erwähnt. Liest man mit dem heutigen Wissen jedoch das Buch, findet sich immerhin eine beiläufige, verräterische Andeutung, die auf das Fahrrad verweist, das ihr Len, ihr Mann, kurz vor dieser Fahrt nach Banbury geschenkt hatte: »Ein neues, wunderschönes Rad. Ich benutzte es viel, es kam mir auch für illegale Treffs zustatten. Als ich später in die DDR umsiedelte, zerlegte Len das Rad, es reiste im Flugzeug mit. Tochter Nina ist in der ersten Zeit in Berlin noch damit zur Schule geradelt. Jetzt steht es im Keller. Niemand hat das Herz, es der Gerümpelsammlung zu übergeben.«
Im Sommer des Jahres 1980 überraschte sie ihre Leser und auch mich mit dem Buch »Gedanken auf dem Fahrrad«. In der Titelgeschichte, die im Grunde ein lapidarer, über die Zeiten und Grenzen wechselnder Fahrtenbericht ist, erzählt sie, dass sie als Achtjährige auf dem viel zu großen Rad ihres drei Jahre älteren Bruders Jürgen Radfahren gelernt habe: »Da der Sattel unerreichbar war, mit den Füßen auf den Pedalen stehend, die ersten atemberaubenden Meter allein.« Mit vierzehn Jahren besaß sie ein eigenes Rad: »Ich liebte die Bewegung, den Duft der Linden im vorbeirauschenden Wind, die Kälte eines Wintertages bei schneller Fahrt. Als ich 1924 in den Kommunistischen Jugendverband eintrat, wurden auch das Rad und sein Tempo politisch. Wenn ich von den Sitzungen in der Kneipe nach Hause radelte, standen am dunklen Park die Gymnasiasten mit ihren Rädern und nahmen unter Schimpfworten die Verfolgung auf; damals noch nicht, um tätlich zu werden, sondern nur um zu erschrecken und zu bedrohen.« In Schanghai, wo sie dann mit dem legendären sowjetischen Kundschafter Richard Sorge zusammentraf, besaß sie wieder ein neues Rad. »Vor der Lenkstange hing ein kleiner Korbsitz aus Stroh für meinen Sohn. Doch die Genossen im China Tschiang Kai-sheks, wo jedem Kommunisten die Todesstrafe drohte, verlangten, ich solle ein rascheres Verkehrsmittel beherrschen lernen, so lernte ich Auto fahren.« Nach dem Einfall der Japaner in die Mandschurei, den blutigen Metzeleien und der Ermordung eines ihrer nächststehenden Kampfgefährten musste sie das Land verlassen, »ohne Rad oder Auto«. Ein polnischer Frachter nahm sie und ihren Sohn mit, Warschau und Krakau waren ihre nächsten Stationen. »Kommunisten werden oft dort gebraucht, wo sie am wenigsten gern gesehen waren. 1937 fuhr ich von Polen nach Danzig. Meine Fahrerlaubnis aus Schanghai war hier nicht gültig, und wieder bestanden die Genossen auf der Prüfung.« Der Nazibeamte, an den sie dabei geriet, taxierte sie sogleich als Jüdin, gar als »mongolid« und bolschewistisch, und dirigierte sie dann mit dem Auto pausenlos, oft im Rückwärtsgang, durch die schmalen Gassen Danzigs. »Ich wollte mich nicht vom Faschismus besiegen lassen. Noch fünf Minuten – noch zehn Minuten – da beging ich den ersten Fehler. ›Steigen Sie aus, Sie haben nicht bestanden – Heil Hitler!‹ …« Hier bricht die Rückschau ab, England bleibt ausgespart und somit das englische, wahrlich historische Fahrrad. Noch immer wahrte sie strikte Verschwiegenheit über die Fahrten nach Banbury.
Die kleine Stadt Banbury, die wegen des Siegs Warwicks über Eduard IV. im Jahre 1469 in die Geschichtsbücher einging und weithin für ihre Pfefferkuchen, die Textil- und Plüschfabrikation, den guten Käse und ihre Ale-Brauereien berühmt war, liegt etwa vierzig Kilometer von Oxford entfernt. Sie war gut erreichbar für die junge Frau auf der Straße, die parallel zum Cherwell-River und durch einige kleinere Ortschaften führte, an sanften Hügeln, Baumreihen und schmalen Äckern vorbei, zumeist jedoch an eingezäunten Wiesen und von Mauern umgebenen Schafweiden, wo sie kaum einem Menschen begegnete. Manche der schmalen, sich durch die Landschaft windenden Straßen stammten noch aus der Römerzeit. Eingewanderte flandrische Weber hatten dann hier im 16. und 17. Jahrhundert eine florierende Wollindustrie begründet, noch sah man den schmucken kleinen Städten und sogar den Dörfern mit den adretten Häuschen aus gelblichem Kalkstein die einstige Wohlhabenheit an. Viele Londoner waren in der Kriegszeit vor den Luftangriffen hierher geflüchtet, kein Haus stand leer, jeder Flecken in den Gärten wurde zum Anbau von Gemüse, Kartoffeln, Weizen und Hafer benutzt.
Sonja mag damals nur wenig für die anmutige Landschaft empfänglich gewesen sein. Unterwegs sah sie Soldaten und Militärfahrzeuge, selten überholte sie ein ziviles Auto oder Motorrad, ab und zu jagten Flugzeuge über sie hinweg. Gerade in dieser Gegend waren zahlreiche Flugzeuge abgestürzt, deutsche und auch englische. Ihr Mann, gebürtiger Engländer, einstiger Spanienkämpfer, hatte sich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet. Kontakt zu den deutschen Genossen verbot sich wegen ihrer konspirativen Tätigkeit. Vom Treffen mit Klaus Fuchs wussten nur ihr Bruder Jürgen und der sowjetische Verbindungsmann. Ihre Eltern und zwei Schwestern lebten in London. Selbst ihnen gegenüber musste sie schweigen und sich in Ausreden flüchten, wenn sie bei ihnen übernachtete oder wegen der Kinder ihre Hilfe in Anspruch nahm. Ihr Bruder war als Ökonom, Publizist und leitender KPD-Funktionär mit Arbeit und Verpflichtungen überhäuft, zumal er als Sachkenner der Nazi-Kriegswirtschaft auch von englischen Politikern und Forschungsdiensten zu Rate gezogen wurde. Fast ganz Europa war von der deutschen Wehrmacht überrannt: Polen, Frankreich, Belgien, Nieder- lande, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Jugoslawien, Griechenland und die Sowjetunion bis vor Moskau und Leningrad, im Süden bis zum Don und zur Wolga. Stalingrad wurde bereits umkämpft. Die Vernichtung des Bolschewismus und der »minderwertigen Rassen«, die Deportation und Ermordung von Millionen Menschen waren beschlossene Sache, aus den Verbrennungsöfen stieg der Rauch auf. Sonja, wie sie Richard Sorge genannt hatte, die an jenem Septembermorgen durch die Cotswold-Landschaft nahe dem schmalen Fluss dahinradelte, war als Kommunistin, Jüdin und Kundschafterin des Aufklärungsdienstes der Roten Armee im kriegerischen Asien und Europa vielfach tödlicher Gefahr ausgesetzt gewesen. Aber nichts war mit der Last und der Verantwortung vergleichbar, die sie mit den Formeln und Berechnungen übernahm, die Klaus Fuchs für sie an diesem Tag und bei späteren Treffen zur Weitervermittlung nach Moskau bereithielt.
Sechzig Jahre danach, im April 2002, war ich mit Sonjas jüngerem Sohn Peter auf der Fahrt nach Banbury. Alles war anders, keine Kriegsstimmung, kein Kalter Krieg mehr, dennoch allenthalben wieder Kriege nah und fern. Lediglich den Pass hatten wir bei der Einreise in England kurz vorzeigen müssen, im Hotel nicht einmal das, nur unsere heimatlichen Telefonnummern bat man uns sicherheitshalber zu hinterlassen, falls uns etwas zustoßen sollte. Wir hatten geplant, wie Sonja mit dem Fahrrad die Strecke von vierzig Kilometern zu fahren, doch angesichts der engen Straßen ohne Rad- oder Fußwege und des heute so dichten und rasanten Autoverkehrs darauf verzichtet und uns für eine Bustour entschieden. Nun saßen wir oben im Doppelstockbus und hatten einen weiten Blick auf die hüglige Landschaft mit der viel früheren Baumblüte als im deutschen Osten. Auffällig die Schaf- und Rinderherden auf den großen Weideflächen, umgeben von Mauern aus gelben und ockerfarbenen Kalksteinen. Kaum Wald, nur hier und dort ein Streifen von Laubbäumen oder Sträuchern und der für uns erstaunliche Anblick alter, windgekrümmter Zedern.
Durch Summertown waren wir hindurchgefahren. Es ist keine Vorortsiedlung mehr, sondern mit der Universitätsstadt Oxford verwachsen. Das Haus, in dem Sonja bis 1945 mit ihrer Familie gewohnt hatte, wurde längst abgerissen und wich einem der ortsüblichen Reihenhäuser. Zehn, fünfzehn Kilometer weiter, dicht an der Straße bei Woodstock, steht protzig wie eh und je Blenheim Palace, Geburtsort Winston Churchills. Bei einem kurzen Aufenthalt gingen wir durch die monumentale Eingangshalle, zwanzig Meter hoch, alle Säulen, Bögen, Wände und der barocke Zierat aus dem Kalkstein der nahen Cotswold-Hügel. 850 Hektar umfasst der Park mit Wildgehegen, exotischen Bäumen und Gewächsen sowie einem Triumphbogen und einer Siegessäule zum Ruhme der Familie, umgeben von exakt gepflanzten Baumgruppen, die verschiedene Stellungen der Armeen des Herzogs Marlborough, des Stammvaters der Churchills, bei dem Sieg zu Hochstädt gegen die Franzosen und Bayern 1704 darstellen sollten. Wie wir erfuhren, war wegen der deutschen Bombenangriffe die Zentrale des britischen Geheimdienstes MI 5 hierher evakuiert worden – etwa zu der Zeit, als Sonja auf der Landstraße A 44 daran mehrmals vorbeiradelte.
Gespannt näherten wir uns Banbury. Umgeben von Gärten, Feldern und Weideland, streng abgeteilt und eingezäunt, ist die Gegend heute kaum durchgängig für Wanderer oder jemanden, der querfeldein per Fahrrad von Oxford-Summertown herüberkäme. Dann Neu- und Industriebauten, auch hier Reihenhäuserzeilen, ehe wir die alte, behutsam konservierte High Street mit den eng aneinandergeschachtelten Häusern und dem früheren Viehmarkt erreichten, wo sich in Shops und Pubs und in Supermärkten die Kauflustigen und Touristen drängten. An der Kreuzung zur Horsefair, deren einst holpriges Pflaster mit bestem Asphalt zugedeckt war, stiegen wir aus und kamen nach ein paar Schritten zum Banbury-Kreuz. Dieses Wahrzeichen der Stadt, eine neogotische Säule mit einem vergoldeten Kreuz auf der Spitze, erinnerte an die Hochzeit von Queen Viktorias ältester Tochter mit dem preußischen Kronprinzen im Jahr 1859. Auf einem Sockel daneben war in güldenen Lettern ein Vers zu lesen – ein Kinderreim, nachweislich älter als das Banbury Cross, weil es zuvor hier schon andere, christliche wie heidnische Kreuze als Wahr- und Wegzeichen gegeben hatte:
Aufs Steckenpferd, hopp! nach
Banbury Cross,
Dort siehst du ne Lady auf
schneeweißem Ross,
Hat Ringlein am Finger und
Glöcklein am Zeh,
Das klingelt und bimmelt
hindurch die Allee.v
Ich kannte diesen Vers schon aus einem englischen Spionageroman, der sich recht freizügig des Zusammentreffens von Klaus Fuchs und Sonja in Banbury annahm. Sehr überzeugend war diese historisch-poetische Parallele zwar nicht, doch denkwürdig immerhin, dass ich nun mit Sonjas Sohn an diesem Kreuz stand und dann die Wege mit ihm abschritt, die damals die junge, dunkelhaarige Frau mit dem etwas jüngeren Mann Arm in Arm gegangen war, um als harmloses Liebespaar angesehen zu werden. An dem kleinen Buchladen der östlichen High Street, wo sie ihr Fahrrad abgestellt hatte, waren sie über den Markplatz, vorbei an Häusern aus dem 15. und 16. Jahrhundert, auf kürzestem Weg aus der Stadt gelangt. Nachdem sie die Cherwell-Brücke überquert hatten, kamen sie auf Feldwegen bis zu einer baumumwachsenen Niederung, wo Sonja die Informationen und schriftlichen Notizen von Klaus Fuchs entgegennahm und weitere Zusammenkünfte mit ihm verabredete.
Ihr Sohn Peter war in den letzten Jahrzehnten mehrmals in England gewesen, in London, Oxford, Chipping Norton, wo er zur Schule gegangen war, und Great Rollright, dem letzten Wohnsitz der Familie vor der Flucht 1950. In Banbury war er, wie er glaubte, nicht gewesen, er hatte jedenfalls keine Erinnerung daran, wurde er doch erst im September 1943 geboren. Aber Len Beurton, sein Vater, hatte hier nach dem Krieg zeitweise in einer Aluminiumfabrik gearbeitet und nach einem Motorradunfall im Banbury-Hospital gelegen. Und da die Treffen Sonjas mit Klaus Fuchs erst im Winter des Jahres 1943, wegen dessen Abreise in die USA, ihr Ende fanden, war Peter Beurton tatsächlich schon leibhaftig und mehr als einmal hier – mindestens während der Schwangerschaft seiner Mutter.
Wir fuhren weiter nach Chipping Norton und trafen dort Peters alte Lehrerin, die in einem schmalen Häuschen gegenüber der Kirche und der Schule wohnte, die keine Schule mehr war, sondern die Villa eines Privatiers. Das Haus der Beurtons in den Nachkriegsjahren in Great Rollright, wo wir freundlich von der jetzigen Besitzerin empfangen und durch die sieben, acht Zimmer der beiden Etagen geführt wurden, befand sich noch fast in dem Zustand, wie er in »Sonjas Rapport« geschildert wird. Nur ein Teil des Anwesens mit den einstigen Ställen und Schuppen wurde abgetrennt, ein neues Haus ragt bis dicht an den neuen Zaun heran. Bald soll auch das alte Haus zum Verkauf stehen, teilte uns die Besitzerin, Diana Davenport, die viele Jahre behinderte Kinder hier im Haus und Garten betreut hatte, gar nicht frohen Herzens mit. Sie wusste, wer die Beurtons waren, sie hatte Peter bei unserem Kommen umarmt; er war schon mehrmals, 1991 auch mit seiner Mutter, hier gewesen. Nicht Wenige in diesem Ort kannten die Geschichte von Sonja und Klaus Fuchs und dem Treffen am Banbury Cross. Auf dem kleinen Friedhof bei der mittelalterlichen Kirche liegen die Eltern begraben, René und Berta Kuczynski, beide 1947 verstorben. Auf einem verwitterten Kalkstein sind ihre Namen und dazu die der sechs Kinder eingehauen, kaum noch lesbar auch: Ursula.
Einem Leben nachzugehen bedeutet nach Spuren zu suchen, die ein Mensch hinterlassen hat. Diese Frau, die im Geheimen Sonja hieß, war fast ihr ganzes Leben dazu angehalten, die Spuren ihrer Taten zu verwischen und zu verleugnen. Sie war weit um die Welt gekommen und hatte sich immer wieder zum Handeln im Verborgenen verpflichtet gesehen, zum Versteckspiel, zum Schweigen, zur Täuschung und zur spurlosen Flucht. Eine Seltenheit, in dem kleinem Ort Great Rollright auf den Wegen und sogar durch die kaum veränderten Gemächer gehen zu können, wo sie vor einem halben Jahrhundert mit ihrer Familie gelebt und nächtlich ihre verschlüsselten Funksprüche ausgesandt hatte. Es war noch ein von ihr angebrachtes Küchenbord an der Wand über dem alten Herd zu finden, da und dort ein Packen Bücher aus der Kriegszeit, vielleicht von ihr. Hier wurde mir bezeugt, dass sie bei vielen, deren Weg sie kreuzte, in guter Erinnerung blieb – trotz allem, was damals und seither geschah.
Wie kam es dazu und was brachte sie auf diesen Weg? Und was bewog den einunddreißigjährigen Dr. Klaus Fuchs dazu, sich fern vom Birminghamer Labor und dem streng geheimen Forschungsprojekt Tube Alloys, bei dem er zu den wichtigsten und befähigtesten Wissenschaftlern zählte, verstohlen in Banbury, auf hügligen Viehweiden und Waldwegen mit Sonja zu treffen? Von ihr kannte er nur diesen Decknamen, wusste wohl nicht einmal, dass sie die Schwester seines Parteifreundes Jürgen Kuczynski, des Leiters der englischen KPD-Gruppe, war. Was bestimmte ihre und seine Entscheidung? Welche Spuren hat ihr Handeln hinterlassen, welche Folgen hat es für uns alle gehabt?
Die frühen zwanziger Jahre
Nach Sonjas Tod – sie starb am 7. Juli 2000 im Alter von 93 Jahren – fanden sich in ihrem Nachlass neben fast tausend Briefen auch Tagebücher aus ihrer Jugendzeit, die sie in akkurater Handschrift geführt und über all die Wechselfälle, Wander- und Kriegsjahre, Fluchten, Verfolgungen und Illegalität aufbewahrt hatte. Die Familie lebte in Berlin-Schlachtensee, der Vater war »ein fortschrittlicher Wissenschaftler und Politiker, der beste Statistiker seiner Zeit« – wie ihn nicht nur Sohn Jürgen überschwänglich lobte. Walther Rathenau sagte über ihn: »Kuczynski bildet immer eine Einmannpartei und steht auf derem linken Flügel.« Er war führend an den Aktionen der Internationalen Arbeiterhilfe beteiligt und wurde im Januar 1926 Vorsitzender des Ausschusses, der die entschädigungslose Enteignung der Fürsten zum Ziel hatte – und seither nur Kuzcynski-Ausschuss hieß. Der Name war damals in aller Munde, von den Konservativen verschrien, bei den Arbeitern und vielen linksstehenden Bürgern hoch geschätzt. So war es ein Zwiespalt, der auch in den frühen Tagebüchern erkennbar wird, dass man zwar in einer noblen Villa am Schlachtensee wohnte, doch dort keinesfalls komfortabel und vornehm abgekapselt lebte. Das väterliche Einkommen war für die große Familie – sechs Geschwister, dazu noch Hausmädchen, Kinderfrau und Gärtner – nicht übermäßig hoch. Die Jahre der Inflation verschärften die Situation. Die Kinder kannten zwar keine Not, lebten vergnügt, doch recht normal und bescheiden.
»Über Mutters Sparsamkeit amüsierten wir sorglosen Kinder uns häufig«, so urteilte die Tochter später. »1924 begann meine Lehre in der Buchhandlung für Rechts- und Staatswissenschaften R. L. Prager, Berlin NW, Mittelstraße. Seit zwei Jahren las ich fast ausschließlich fortschrittliche Literatur, sah bewusst den Reichtum der Wenigen, die Armut der Vielen, die bettelnden Arbeitslosen an den Straßenecken, dachte über die Ungerechtigkeit dieser Welt nach und wie man sie beseitigen könnte. Nun kam der krasse Gegensatz zwischen dem Zuhause und der Lehrstelle hinzu. Die Furcht erwachsener Menschen, die an jedem Monatsende vor der Entlassung zitterten. Meine Freundin Marthe war das erste Opfer. Ebenfalls Lehrling in der Buchhandlung war Heinz Altmann, Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes. Er gab mir den letzten Anstoß, ich trat in den Kommunistischen Jugendverband ein.«
Das Tagebuch, das in ihrem autobiografisch geprägten Erstlingsbuch »Ein ungewöhnliches Mädchen« aus dem Jahr 1957 erwähnt wird, war ein Geschenk ihrer Mutter – »mit blauem Lederdeckel und eingelegtem silbernen Kleeblattmuster und verschließbar«. Den Schlüssel trug sie an einer Schnur um den Hals, schon ehe sie ihre erste Eintragung hineinschrieb: »Geliebtes Tagebuch, ich will Dir immer alles Wichtige, was passiert, mitteilen. Besonders meine Gedanken, die ich anderen nicht sage …«
Januar 1924
Was bin ich für ein gesunder Mensch! Was freue ich mich aufs Leben. Wie ist das Jungsein doch schön. Es ist schon so. Wenn ich gegen die Strafreden der Familie Stillschweigen setze, so gibt das eine gewisse Kraft und Überlegenheit vor mir selber. Ich heuchle mir vor, dass ich mir zu gut bin, darauf zu antworten und dass ich zu sehr über den Dingen stehe. Das tu ich gar nicht. Es ist nur eine gewisse Schlaffheit und Gleichgültigkeit, die ich mir durch häufige Wiederholung der Fälle angeeignet habe.
März 1924
Vom März ab will ich den Frühling zwingen. Das heißt, ich schreib ins Buch, jauchze bei jedem Hahneskrähen, ich lasse die Fenster weit auf, ich stehe früh auf, ich bin lebenstoll und vergnügt. Und ich bin so froh, dass ich noch niemals einen Jungen geküsst hab, oder besser, dass ich nun erst einen Jungen küssen werde, den ich wirklich lieb hab. Das ist zum Blödsinnigwerden. Ich bin zu der weisen Einsicht gekommen, dass, wenn man mit allen und jedem Menschen Krach hat, es doch schließlich an einem selber liegen muss. Ich bin schlechter Laune und mürrisch und knurrig, und bespucken könnt ich mich! Aber dann ein blauer Himmel, Sonne, die wärmt, Tautropfen an den Tannen und ein Atmen in der Luft, dass man wandern möchte, immerfort springen und laufen muss und jeden Menschen liebhaben will.
Ich alter Querkopf, ich Mischlingsgebräu mit schwarzer Strubbelmähne, Judennase und unbeholfenen Gliedern, sitze hier dumpf und verkniffen, zanke mich, unke, brüte. Ich widerliches Geschöpf. Ein Mensch, der weint, sollte seine Tränen nicht fortwischen, denn es ist etwas klares Lebendiges, gleichsam Beruhigendes in Tränen, die übers Gesicht rinnen. Je mehr ein Mensch seine Unnatur empfindet, desto gezwungener und befangener wird er. – Nein, das ist auch Unnatur. So oft finde ich draußen etwas kitschig. Sei es der Mond, der durch die Wolken schaut oder ähnliches. Nicht, dass ich mir sage: »Dieses ist ein Bild, das so und so oft kitschig gemalt worden ist«, sondern ganz an sich, wie es da ist, empfinde ich es als kitschig und nicht »natürlich« – da irre ich mich doch dann!
Wenn ein Mensch, so wie unser Chef Prager, neun Stunden lang hintereinander schimpft mit uns, so bedaure ich ihn ja vielmehr als die, die er abkanzelt. Man fühlt sich von allen Dingen viel mehr getroffen und gekränkt, wenn man sich nicht verteidigt. Ich sollte nicht in das Buch schreiben, es erleichtert mich nämlich, und das ist des Öfteren gar nicht gut. Wenn ich meine Fehler und Dummheiten hier hineinschreibe, fühle ich sie dann schon zu einem Teilchen behoben.
Es ist so merkwürdig. Wenn ein lieber Mensch, von dem ich es mir gewünscht habe, dass er sich um mich kümmert, sich nun wirklich meiner annimmt, so entziehe ich mich ihm sofort. Sage ihm nichts aus einem wirklich natürlichen Grund heraus, und doch denke ich die ganze Zeit über, wenn er doch meine Hände festhielte, wenn er doch weiter fragte! Es ist höchst unschön: Menschen, die mir immer etwas Verkehrtes, aber Schmeichelhaftes sagen, mag ich gern, aber solche, die mir Richtiges und zwar weniger Gutes über mich sagen, sind mir unsympathisch. Herrlich, wenn ein Mensch so lachen muss, dass er gezwungen ist, mitten auf dem Potsdamer Platz drei Minuten stehen zu bleiben, weil er nicht die Kraft hat, auch nur einen Schritt weiter zu gehen.
Es ist sechs ein halb Uhr morgens und draußen ein Regen, wie ich ihn gern mag. Ich meine, eine Frühlingsluft, dass man sich immer nur die Lungen füllen möchte, und Regen, Regen, Regen, der immerhin vergnügt macht. Jawohl, ihr Dummköpfe! Vergnügt! Denn die Vögel singen nichtsdestotrotz, die Kastanie hat grüne Blätterspitzen, und an den feinen Ästen und Zweiglein der Birke hängen viele, über tausend kleine klare, runde, vergnügte und was noch alles Regentropfen und Tröpfchen. Jawohl! Es gibt Dinge und Anschauungen, von denen ich so viel verstehe und weiß, dass ich gerade sagen kann, meine Meinung ist das nicht. Aber mein Wissen und Verstehen geht nicht so weit, dass ich für die Abweichung meiner Ansicht eintreten kann. Jürgen sagt zu mir: »Du hast immer nur eine Güte deswegen – nie trotzdem.«
Es ist nämlich Sonntag, und es regnet, nicht sehr, aber man weiß, es wird den ganzen Tag über nicht aufhören. Gleich in der Frühe, das heißt am Regensonntag ist acht Uhr auch noch in der Früh, da höre ich den Gärtner unten an der Heizung rumoren, bis zu mir oben im Zimmer kann ich’s deutlich durch die Heizungsrohre hören, wie er eine Schaufel und dann die zweite in den dickbäuchigen Schlund des Ofens schiebt. Ich bin noch im Bett, gerade habe ich die Lampe ausgemacht. Ich habe sie gern. Die sechseckige Form des Schirmes ausgefüllt mit schwarzumrandeten Transparenten aus Seidenpapier. Wenn die Birne brennt, leuchten die bunten Farben dunkel auf, und das Licht schimmert gedämpft. Einen Meter davon entfernt liegt das Zimmer im Schatten. Wenn ich im Bett lese, muss ich sie immer überm Schreibtisch abmachen und zum Bett hängen. Ja, jetzt mache ich sie also aus, und nun fängt der Morgen an. Es ist doch noch ein wenig zu trübe, so zu lesen, und das matte Tageslicht ist kühl. Ich döse, stehe auf, renne mit bloßen Füßen, hole meinen bunten Teller noch von Weihnachten und kuschele mich frierend wieder ins Bett und mache in Gemütlichkeit. Ein bisschen muss ich mich vorbeugen, dass die Pfefferkuchenkrümel nicht ins Bett fallen. Dann lege ich mich in die Mitte des breiten Bauernbettes. Einen Deckenzipfel lege ich mir, wie wir es als Kinder immer getan haben, um den Hals und lese. Es ist ja jetzt der »Helianth«.
Draußen regnet es eintönig, rieselnd. Hell schlagen die Tropfen auf den Dachsims unterm Fenster. Mir Zeit und Stunde unbewusst, lese ich in den Vormittag hinein. Ein langer Atemzug, ich lege das Buch fort, und auf einmal höre ich, dass die Kleinen schon lange unten schreien und spielen. Reni weint, Türen schlagen, das Telefon klingelt. Ich bin wach. Ein paar Minuten liege ich völlig gedankenlos da. Ein Erschlaffen und Abspannen, das immer eintritt, nachdem ich mit allem Fühlen und Denken in einem Buch gelesen habe.
Aufstehen! Hm! Meine Pantoffeln liegen ganz, ganz weit unterm Bett, ein paar gestopfte Strümpfe hab ich nicht. Herrgott, bin ich wirklich vor zehn Minuten noch in Schaeffers »Helianth« gewesen? Also auf denn! Unten die Kinder sind bereits angezogen, gestern war große Kopfwäsche. Sie laufen also heute alle mit aufgeplusterten, zu trockenen Löwenmähnen herum. Ollo füttert Reni: »Guten Morgen, Jungferchen, ausgeschlafen?« Uff ja, ganz ausgezeichnet, ich dehne mich, ich recke mich und freue mich, dass alles so ist, wie es ist. Das Leben ist schön!
Vor mir auf der Fensterscheibe läuft eine Fliege herauf. Scharf umrissen stelzt sie über das helle Glas. Was ist darüber zu sagen? Verstehst Du nicht? Das ist schön. Heut musste ich wie so oft für Prager zur Bank. An der Dresdner Bank wird gebaut. Oben auf dem Dach steht ein Arbeiter, ich glaube, er sorgt für die richtige Stellung des Kranes, na, ich versteh davon nichts. Also ich komm unten vorbei, er legt seine Hand an den Mund, und dünn wie ein Hauch tönt es: »Bubikopf!« Alle Leute drehen sich nach mir um. Nachdem ich etliche Kusshände von ihm erhalten habe, breitet er weit die Arme aus. Grell hebt er sich gegen den blauen Himmel ab. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, unterhalten wir uns, und die entrüsteten Spießer verziehen ihre Gesichter. Dann geht es weiter. Hinterm Schinkelplatz stell ich mich an den Kanal. Er ist bevölkert mit Enten. Viele Menschen stehen am Ufer. Boten ketten ihre Räder fest, Schuljungen halten an im Weg. Mädchen mit Einholkörben, Mütter mit Umschlagtüchern und Kindern am Rockzipfel. Zille hätt’s malen können. Und auf allem liegt die Sonne. Unten schnappen die Vögel nach den Brotkrumen, in der Luft hacken sie danach. Gibt es mehr Rhythmus, mehr Schönheit und Ruhe als in dem Flug eines Vogels? Einer sitzt ruhig auf dem dunkelbraunen, rissigen Pfahl, zwei Schritt von mir, ganz still.
Unter den Linden treffe ich den Irrsinnigen, den ich Tag für Tag sehe. Er bettelt sich seine Bedürfnisse zusammen. Das Haar fällt lang herunter. Den Hut ein wenig zu tief ins Gesicht, tiefe Falten sind an merkwürdigsten Stellen in sein Gesicht eingeschnitten, die Augen ruhelos, der Mund ewig redend, läuft zackig hin und her. Ich weiß – nein, ich weiß nicht, ich fühle nur, dass er nicht immer irrsinnig war.
Ist das Leben schön?
Weihnachten 1924
Mutter hatte entzückend alles gemacht. Ganz allein, für uns zehn Personen. Sie war rot und jung und freute sich mit uns. Jürgen rührend in seiner Freude, Vati und Mutti zusammen fabelhaft. Wie man nach fünfundzwanzig Jahren Kennen noch so verliebt sein kann! Bärbchen und Brigitte verlegen, lebhaft und nett. Binchen außer sich. Als alles still war, piepste sie entsetzt, auf ein schwarzes Hundescheusal aus Pappe vom Weihnachtsmarkt hinweisend: »Kinder (sie redete alle im Haus mit ›Kinder‹ an), Kinder, ich glaube er hat Würmer.« Dann auf einmal sehr still, etwas hilflos, alle Sachen fasst sie an, nichts nimmt sie richtig in die Hand: »Ich bin böse auf euch wegen der Verwöhnung.« Dann nach einem Stoßseufzer: »Was soll ich bloß mit all den Sachen anfangen?«
Unsere Ollo, die seit dreizehn Jahren für uns sorgt, die nie je- mand zum Lieben hat und nur alles, was sie an Umsorgen und Lieben in sich trägt, uns schenkt. Ollo, das hysterische graue, kleine Wesen, das mit fast jedem von uns Mädchen Krach hat, immer unzufrieden ist. Ollo, die für uns durchs Feuer geht, alles für uns tut, nur für uns lebt, nichts auf der Welt kennt als ihre sechs. Ollo, von deren Prügel alle sechs schon gehörig bekommen haben, die seufzend Muttis grünseidenen Kasak betrachtet: »Ach, ich sehe schon die Flecke drauf, Frau Doktor.« Die ermahnend zu mir sagt: »Ursula, die Nachthemden darfst du nur tragen, wenn du krank bist!« Die für ihren »Kronsohn« Jürgen, auf den sie so stolz ist, die teuersten Zigarren kauft, die es gibt, und die sich doch jedes Mal ärgert, wenn sein Zimmer verraucht ist.
Alle Kinder springen jetzt herum. Jürgen streichelt Mutter über Stirn und Haar: Vielen Dank, herrlich ist alles! Vater sagt leise: »Na, Gutes!« Mutti freut sich. Dann Vater zu Jürgen wegen irgendwas strahlend und stolz: »Aber Kerlchen.« Dann ich an meinem Tisch so froh über alles und doch immer erwägend, wie ich um den Weihnachtskuss für Mutter herumkomme, halb in Gedanken bei H., halb bei einem Bettler, den ich heut zusammenbrechen sah, bei Proletariern, dann wieder bei H., dann einmal voll und ganz bei den Gardinen, die ich für mein Zimmer gekriegt habe – und so fort. Um den Kuss für Mutti habe ich mich nun glücklich gedrückt.
Auf der Erde, zwischen all den Großen, ein kleiner Krümel mit feuerroten Backen, Armen, die wie Windmühlen gehen, Augen, in denen sich die Weihnachtskerzen widerspiegeln, Haarschopfwald, durch den zum ersten Mal eine Schleife, eine blaue, große Schleife leuchtet. Das Ganze voll herauspurzelnder, berstender, platzender Silben, Laute, die alle: Lebensfreude, Lebensfreude! heißen sollen. Unsere Renate …
Jetzt kniet Bärbchen vor diesem strampelnden Etwas. Bärbchen, mit dem weißen Gesicht, die immer rast, Türen zuschlagen kann, dauernd fällt und stolpert, immerfort etwas hinwirft, die sich mit fast aufreizender Güte und Demut von Binchen und Reni tyrannisieren lässt, die nichts Schöneres kennt, als Menschen etwas zu holen, zu helfen und zu erleichtern. Einen trockenen Humor hat sie. Elf Jahre alt. Von ihrem fünfzehnjährigen Tanzstundenherrn hat sie per Post einen Schokoladenweihnachtsmann geschenkt gekriegt. Jetzt Brigittes etwas aufgeregte, schrille Stimme, immer fragend, immer wissen wollend, nie ruhig. Jürgen nun neben mir. Was soll ich über ihn sagen, der mir der beste und klügste Mensch ist, den ich kenne. Von einer Güte und Tiefe, Duldsamkeit und Jungenhaftigkeit, Witz und Reinheit, dann wieder Frechheit, so alles durchschauend und darüber, und doch dann wieder so kleiner Junge voller Lust und Verstehen und – ach ein einziger liebster Bruder.
Jetzt sehr viel später kommt der Gärtner durch die Küche herein. »Heinz!«, jubelt Bärbchen und fliegt ihm um den Hals, (wie sie ja überhaupt Freundschaft mit allen Kellnern, Dienern, Gärtnern, Schauspielern und jeder Sorte Mensch zwischen siebzehn bis dreißig pflegt). Jetzt springt sie herunter, und er nimmt sie an die Hand, riesig lang ist er, und Binchen klammert sich unten irgendwo an seine Beine.
»Der Gärtner sieht heut ja ganz mächtig froh aus«, sage ich. Sein blonder Haarschopf fällt ihm vornüber ins Gesicht, seine Augen strahlen mich an. »Das ist seit langem mein schönstes Weihnachten«, sagt er und reicht mir die Hand. Trotz seiner Freude ist irgendwie etwas Bitteres an ihm – nie kann er das ganz loswerden. Kleiner Heinz Krauter, denk ich auf einmal sehr mütterlich. Ich habe Ollo, Mariechen und dem Gärtner je einen Becher geschenkt, sie haben die geschweifte Form von Nachttöpfen, braun, grün und schwarz sind sie. Jürgen hat sie mit Kaffeebohnen gefüllt. Mercedes jüngste Schwester hat für jeden ein Päckchen herübergebracht. Mariechen schimpft zwar immer, dass sie bei uns die Läufer dreckig macht. Ollo, dass sie so viel zerreißt, Mutti, dass sie so verwöhnt wird zu Hause, aber alle haben sie gern. Sie gehört dazu. Mit Jürgen steht sie ganz entzückend. In ein Buch von Jean Paul, das er ihr geschenkt hat, schrieb er hinein: »Eine Frau kann keinen besseren Freund finden als den Geliebten einer anderen.« Hans hat mir Fotografien vom See geschenkt. Hans graue Augen gucken einen immer so an. Jürgen und ich sind oft zusammen drüben. – Weihnachten 1924!
Januar 1925
Es ist Anfang der Nacht. Ich komme von der K.J.-Versammlung. Auf dem Potsdamer Platz arbeiten zwei Proleten Nachtschicht an den Telefondrähten unter der Erde. Sie sind vielleicht zwanzig Jahre – die Mütze weit zurückgeschoben, das Haar fällt in die arbeitsheißen Gesichter. Sie sind kräftig, und beim Heben spannen sich die Muskeln. Ab und zu fällt der Schein einer roten Lampe auf ihre Gesichter. Ein paar Bürger stehen herum, ich schau mir auch ihr Arbeiten an. Da tritt ein Mensch ganz dicht hinter mich, so dicht, dass es mich heiß überläuft und ich beiseite gehe – wieder ist er hinter mir. Mit einem Ruck bin ich zwei Schritte fort – ich dreh mich um. Da steht ein Mensch, Mitte zwanzig, gut gewachsen, einen weichen Schlapphut auf, ein kluges, fast schönes Gesicht. Er sieht mich an. Er sieht mich gerade so direkt an, wie er vorher hinter mir gestanden hat. Die Augen werden weit, das braune Dunkel – er ist Jude. Ich hatte mich ja nur Sekunden umgeblickt. Immerfort sehe ich nun die beiden Arbeiter und diesen. Es kreiste mir im Kopf herum, der gehört zu Dir, das ist Blut von Deinem Blut, und doch kämpfst Du mit und für die anderen. Nein, zu denen gehörst du. Es ist so schwer, sich allein zurechtzufinden.
Wir saßen alle am Radio. Nach einem guten Abendbrot sind wir in die warme gemütliche Zimmerecke gegangen. Wir hörten bayrische Lieder, von einem Geschwisterpaar entzückend gesungen. Dann nach einigen anderen ein Lied mit frohen Jodlern hinter jeder Strophe. Riadi-ha-ha-ha-riadi-hahaha. Jetzt gab es den Riss bei mir. – Eine Woche vorher. Wir sitzen bei Prager in der Buchhandlung und arbeiten. Da wird draußen eine Geige gestimmt. Ich steige auf einen Stuhl, das Fenster ist so hoch, und man muss immer auf einen Stuhl steigen, wenn man auf den Hof sehen will. Da steht ein älterer Arbeiter, verhungert und verbraucht. Um ihn sind fünf Kinder, drei Mädchen, zwei Jungen, keines über vierzehn Jahre, nicht alle haben Schuhwerk an, die Kleider hängen in Fetzen, die Gesichter grau, die Augen ohne Licht, fahl und verhungert die Gesichter. Kleine ausgemergelte Körper. Der Vater beginnt, die Kinder stehen um ihn und fallen singend ein. Die Blicke hängen an den Fenstern, stumpf gläsern. Riadi ha-ha-ha! Und sie schauen nur immer zu den Fenstern hinauf. Ich habe nicht weiter Radio gehört, weil mein Badewasser oben einlief und ich müde war und schlafen wollte. Die Kinder haben auch nicht zu Ende gesungen, weil der Diener vom Hotel nebenan kam und sagte, dass die Hotelgäste noch schliefen – es war elf Uhr – und dass sie nicht gestört werden dürften. Geduckt schlichen die Kinder davon. Auf dem nächsten Hof lachten sie nun wieder ihre Jodler heraus. Hah-hah-hah! Zum Kotzen! Aber wenn man’s doch könnte, mal müsste man ja damit fertig werden. Das Kotzgefühl ist das Elende.
Man weiß genau: So und so viele Hungernde, so und so viele Bettler gibt es in den Straßen; aber heute geht man zu Hilbrich in die Konditorei; das vorige Mal stand vor der Tür ein Bettler. Auf einmal hat man den Gedanken: Wenn heut doch keiner dastände! Man merkt zwar gleich: Halt, da machst du dir was vor, das ist eine unklare Linie. Für dich darf absolut nichts anders sein, dadurch, dass dieser Bettler jetzt vielleicht an der nächsten Ecke, wo du ihn nicht siehst, steht. Du musst genauso wissen, dass er da ist und nicht nur dieser Einzelne, sondern dass sie alle da sind, auch wenn du sie nicht siehst und im Augenblick keiner an deine Gefühle appelliert.
November 1926
Bußtag im November. Endlich mal wieder Zeit, bei Rudi zu sein. Man freut sich kaum darauf, weil ja andere dabei sind. Gott sei Dank, jetzt ist Zeit, Tee zu kochen. Er hilft mir dabei. Das Schaf merkt gar nicht, warum ich mit Absicht das Gas nicht ganz toll auf groß gedreht habe und stellt es selbst nun auf Hochdruck. Abends fuhr ich nach Hause. November und draußen Frühlingswärme. Auch nicht nur Wärme, es ist etwas vom März in der Luft. Bußtag! Wohin man sieht, bringen Männer ihre Frauen nach Hause, und man empfindet, dass heute alle verliebter zueinander gehören als sonst an Winterabenden.
Ich hatte Freude daran und musste lachen. Die sahen alle nicht nach Buße aus! Dienstmädchen mit Arbeitern, Angestellte mit Tippsen, Latscher mit Mädels. Bei jedem Küssen und Hand in Hand der anderen blieb etwas von meinem Lächeln haften, so dass ich es immer weniger besaß, erst ernst, dann traurig wurde, und als ich im Dunkel allein ging, ganz unerfüllt, sehnsüchtig und keinen anderen Gedanken empfand, als den, dass der Junge nicht da war. So schwer war es mir lange nicht angekommen. Ich fand es selbst dumm von mir, aber alles ringsum und ich waren so unbegreiflich frühlingsverrückt.
Wir stehen in der Elektrischen und stellen fest, dass mein Wintermantel nichts taugt. Rudi stellt – mit Recht – weiter fest: Ich laufe überhaupt schlecht angezogen herum. Er will versuchen, mich etwas eitel zu machen. Natürlich bloß eine äußere Kleinigkeit und gerade deshalb leicht zu ändern. Er hat mehr Freude daran, mit Frauen, die gut angezogen sind, auf die Straße zu gehen. Es tut ihm leid, mich oft so gekleidet zu sehen. Dass das andere unbequem ist und viel Arbeit macht, sind nur Vorurteile. Ich höre mir das an, und jetzt kommt das Lächerliche, ich bin tief unglücklich. Überlege: Ja, mit den anderen kannst du auch nicht so rumtoben wie mit mir. Mit denen musst du deine Schritte mäßigen und deine Kraft, weil sie nicht mitkönnen. Ich weiß schon, dass es unbequem und unnatürlich sein wird, aber ich weiß auch schon, dass ich es tun werde, weil er es will. Dabei bin ich ja eitel. Ich wäre traurig, wenn ich vorne einen Zahn verlöre oder statt erfreulicher Augen und guter Farbe trübe Augen hätte und blass wäre. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn mein Mund plötzlich eine vernünftige Form kriegte. Ich bin eitel.
Dass ich nun todunglücklich bin, richtig außer mir, bloß weil dem Herrn Rudi etwas nicht an mir gefällt, das ist schon eine Läppigkeit, um die ich mich selber auslache. Plötzlich fühle ich mich vor Gedanken darüber bereits in dem anständigen Mantel, in dem hübschen engen Kleid aus Stoff, der nicht geknautscht werden darf, mit dem gut aussehenden breitrandigen Hut – da kommt mir alles doch besser vor, wie es früher war – nein, jetzt ist es ja auch noch so. Ach, ich weiß nicht, und ich sehe mich im Winter mit der schwarzen Pelzmütze, so warm-mollig, spitz zulaufend wie eine Großvaterkappe, mit grellbuntem Schal, mit hoher geschlossener Jacke, mit festen Trampelschuhen zu den Genossen stürzen, ich höre sie mit netter Betonung: »Steppenpferd« sagen. Ich sehe mich im Sommer mit ihnen barfuß im weißen Kittel ungebunden sein, wir toben zusammen, denn man passt auch außerhalb der KJ zusammen, und so brauche ich mich nicht zu scheuen, mit ihnen zu ringen, zu schreien, mich zu freuen.
Nun denke ich plötzlich bitter, wie alt mich Rudi macht! Und habe Sehnsucht nach den Genossen. Die kriege ich immer, ganz gleich, in welchem Zusammenhang er etwas anders haben will oder nicht versteht. Auf dem Heimweg beschloss ich, mir vom Zwei-Monate-Taschengeld einen Mantel zu kaufen. Plötzlich habe ich Visionen: Der Genosse Hans läuft, weil er kein Fahrgeld hat, nach dem Gruppenabend anderthalb Stunden bis Wannsee heim. Da sehe ich seinen betrunkenen Vater mit erhobener Axt im Hausflur stehen, weil der Junge so spät kommt. Wenn er fährt, ist er in zwanzig Minuten zu Hause. Der Genossin W. stirbt ihr Jüngstes weg, weil sie ihm nicht Milch kaufen kann. Sehr lieb hat sie es. Verrückt, vielleicht hätte ich ihr gar nichts gegeben. Außerdem, nur eine kleine Weichheit, allen Millionen hätte ich doch nicht helfen können. Außerdem brauche ich den Mantel. Nun liege ich im Bett und heule vor mich hin. Soll ich oder soll ich nicht? Und habe abwechselnd Sehnsucht nach Rudi und nach allen Arbeitermädeln und Jungen der KJ. Und dann packt mich die Wut, dass so einer mir den Kopf verdrehen kann. Und dass ich ihn so sehr brauche. Und dann schlafe ich doch unter Heulen ein. Das ist alles ein bisschen reichlich Tiefstand.
Gestern Abend war es nachher noch scheußlich. Er war draußen bei uns. Wir saßen mit allen zusammen im geheizten Esszimmer und waren riesig vergnügt. Lärmten, tollten! Ich wusste, dass ich abends mit zur Bahn gehen würde. Zum Gute-Nacht-Sagen küsst er mich dann – das war so schön zu denken! Ich ging mit, wir schritten die einsame Straße herunter. Plötzlich hört man den Zug heranrattern. Natürlich tut man es nicht rasch in Eile. Und wenn man es hundertmal macht. Nie in Hast! Wir rennen, geben uns die Hand, und Rudi ist auf dem Bahnsteig. Ich kehrte um, nach Hause. Wir hatten uns getäuscht, der Zug fuhr erst fünf Minuten später an mir vorbei. Ich war traurig, weil meine Lippen so trocken waren. Ich ärgerte mich ja selber, dass ich nicht los davon kann. So eine Kleinigkeit. Aber wenn man den ganzen Nachmittag mit leisem Freuen daran gedacht hatte und es nun doch unerfüllt blieb …
Im Mai 1926 wurde Ursula Mitglied der Kommunistischen Partei. In den ersten Wochen und Monaten war sie fast jeden Abend wegen des Volksentscheids für die Fürstenenteignung unterwegs. Als ihr der Vater, von der Mutter zu einem »ernsten Wörtchen« aufgefordert, deshalb Vorwürfe machte, entgegnete sie ihm: »Vati, das ist alles für deinen Volksentscheid.« Da sahen sie sich an und lachten.
Anfang April 1927 fand sie eine Anstellung beim Ullstein Verlag im Archiv der Zeitschriften- und Propagandaabteilung. Auch dort ließ sie die Parteiarbeit nicht ruhen und engagierte sich vom ersten Tag an in der Betriebszelle der Kommunistischen Partei. Sie wurde Verantwortliche für Landagitation und schrieb Artikel für die »Rote Fahne«. Als sie schließlich in einem Kommentar die Ullstein-Firma selbst aufs Korn nahm – die Zeitung mit dem Artikel wurde in mehr als tausend Exemplaren an den Verlagstoren gratis verteilt –, war allerdings ihre Berufskarriere wieder zu Ende. Einer der Ullstein-Herren machte ihr unmissverständlich klar, dass »in einem demokratischen Betrieb keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten für Kommunisten vorhanden sind«. Ursula reagierte kühl, sachlich und nutzbringend darauf und gründete mit anderen Genossen die Marxistische Arbeiterbibliothek, MAB Berlin, in der früheren Grenadierstraße (jetzt: Almstadtstraße, nahe Rosa-Luxemburg-Platz).
Als Ende 1927 ihr Vater mit der Mutter, wie schon mehrfach zuvor, sechs Monate wegen seiner Forschungsarbeiten über das Finanzkapital in die USA reiste, nahm sie den Vorschlag an, die Eltern zu begleiten. In New York gelang es ihr, für die Zeit ihres Aufenthalts in einer Buchhandlung Arbeit zu finden: Es war der Proshit Bookshop Uptown – eine Adresse, an die sie sich anderthalb Jahrzehnte später erinnerte, als sie für Klaus Fuchs einen geheimen Treff mit einem sowjetischen Kontaktmann in New York ausmachen sollte. An dergleichen hätte sie damals noch nicht zu denken gewagt. 1929 heiratete Ursula den »bürgerlichen« Jugendfreund und nun frisch examinierten Architekten Rudi Hamburger, mit dem sie 1930 nach China übersiedelte, als sich ihm dort eine berufliche Perspektive eröffnete. Ihr »zweites« Leben begann.
In China
Wie mit dem Tagebuch, so war es auch mit den Briefen ein Glücksfall, dass die Mutter sie beisammen hielt und über das Exil in wechselnden Ländern, bei vielen Wohnungsumzügen, Bedrohungen und Fluchten sorgsam bewahrte. Nach deren Tod, 1947 in England, erhielt die Tochter sie alle zurück – Briefe noch aus Deutschland, aus den USA, die meisten aus China, Polen, der Schweiz und die aus England in den Jahren des Krieges und danach. Da sie nahezu jede Woche nach Hause geschrieben hatte – oft auch an den Bruder, die Schwestern, andere nahe Verwandte und Freunde –, ist eine Fülle authentischer Lebenszeugnisse überliefert. Es ist erklärlich, dass sie auf dem Postweg zwar ausführlich Erlebtes und Beobachtetes berichtete, jedoch auf die Erwähnung jeglicher politischer oder gar illegaler Aktivitäten, die besonders seit ihrer Ankunft in Schanghai immer mehr ihr Leben bestimmten, völlig verzichten musste.
Anfang Juli 1930 verließ sie mit ihrem Ehemann Deutschland, und sie erreichten im August Schanghai nach einer mehr wöchigen Zugfahrt mit dem Transsibirien-Express durch die Sowjetunion, mit der ostchinesischen Eisenbahn durch die Mandschurei und nach einer Schiffsfahrt von tausend Kilometern. Die Briefe, die sie damals den Eltern und Geschwistern sandte, lassen erkennen, wie fasziniert sie von dem Land, der Stadt und den Menschen war, die sie dort traf. Schanghai war eine pulsierende Großstadt mit den krassesten sozialen Gegensätzen und den höchsten Wolkenkratzern Asiens. Mehr als die Hälfte des Stadtgebiets wurde von ausländischen Mächten regiert. Neben Franzosen und Deutschen waren es vor allem die Briten mit ihrem weitreichenden Settlement und eigener Polizeitruppe, Zollbehörde und Stadtverwaltung (Shanghai Municipal Council). Dort hatte Rudi Hamburger eine Anstellung als Architekt durch Vermittlung seines Freundes Helmuth Woidt gefunden, in dessen Haus er zunächst mit seiner Frau wohnte. »Im Haus empfing uns ein chinesischer Diener; in weißen Handschuhen servierte er eisgekühlte Getränke. In unseren zwei Zimmern unterm Dach fing sich die drückende Hitze. Moskitos saßen im Netz über dem Bett«, berichtete sie über die Ankunft. »Rolf hatte eine angesehene Stellung, wir wurden viel zu Partys eingeladen und mussten uns revanchieren – Damen besuchten mich und erwarteten Gegenbesuche –, eine fremde Welt, die im krassen Gegensatz zu meinem bisherigen Leben stand.«
Vor hundert Jahren war hier, sechzehn Kilometer landeinwärts von der Mündung des Jangtsekiang, der internationale Hafen entstanden, um den sich Schanghai zur größten Stadt Chinas und zum Handels-, Industrie- und Verkehrszentrum ausgewachsen hatte. Ebenso wie der Geschäftsgeist prosperierte das Gangstertum. Abenteurer aller Herren Länder trafen sich hier, tummelten sich in den Vergnügungsvierteln mit ihren Tanzbars, Bordellen, Spielklubs und den Opiumhöhlen, wo auch der Schmuggel und Schwarzhandel florierten. Aber in den exterritorialen Ausländerenklaven fanden zugleich viele chinesische Intellektuelle und politische Flüchtlinge vor der Verfolgung durch die Kuomintang-Behörden Unterschlupf. Tschiang Kai-shek hatte sich zum obersten Kriegsherrn aufgeschwungen, doch weite Teile des Landes außerhalb der großen Städte wurde von rivalisierenden Provinzfürsten und Räuberbanden beherrscht, die ebenso brutal wie die Regierung gegen jeden Widerstand der aufbegehrenden Bauern, Arbeiter und besonders gegen die Kommunisten und ihre sich formierende Rote Armee zu Felde zogen. In Schanghai war 1921 die Kommunistische Partei Chinas gegründet worden, Ende der zwanziger Jahre war es mehrmals in der Stadt zu Aufständen gekommen, und noch hatte hier die Untergrundzentrale der KPCh in einem der Ausländerviertel ihr illegales Domizil.
Gänzlich uninformiert war die Lady Hamburger darüber nicht, doch es brauchte seine Zeit, bis sie Genaueres erfuhr und eine Verbindung zu Kommunisten zustande kam, worum sie sich ungeduldig bemühte. Sie hatte vor ihrer Abreise aus Berlin die KPD-Zentrale im Karl-Liebknecht-Haus aufgesucht und sie über ihren vermutlich langjährigen Chinaaufenthalt unterrichtet. Man hatte sie auf den Ernst der Lage in China, die strenge Illegalität und die extremen Gefahren hingewiesen. Nun vor Ort quälte sie das tatenlose Zusehen, die Verstellung und Anpassung in der noblen Schanghaier Gesellschaft. »Schmutz, Armut und Grausamkeit stießen mich ab. Mein Wille zur brüderlichen Solidarität, mein Bemühen, die Menschen gern zu haben, scheiterten. Ich fragte mich, ob ich nur theoretisch ein Kommunist sei, der nun, wo die Praxis anders als zu Hause aussähe, versagte.« Von Anfang an war ihr jedoch klar, dass ein äußerlich bürgerliches Leben eine wichtige Sicherung und Tarnung war, wollte sie jemals als Kommunist tätig sein. Wochen und Monate, gefangen vom Alltag und den vielen neuen Eindrücken, lauerte sie auf eine Nachricht von der Partei oder irgendein Erkennungszeichen chinesischer Genossen. So nahm sie zuerst gar nicht wahr, dass sie ein Kind erwartete. Ihr war ständig übel, die Ärzte fürchteten, dass ihr das Klima nicht bekäme, und führten alle Schwierigkeiten darauf zurück. Als sie eine Art Darmbewegung bemerkte, stellte man schließlich fest, dass sich da kein Darm, sondern ein Kind bewegte und sie schwanger war. »Nun freute ich mich, dass das ›Schicksal‹ anders entschieden hatte, als wir geplant«, schrieb sie nach Hause.
Schanghai, 27. Juli 30
Dear family, mein Leben verläuft einstweilen völlig ereignislos, wie ein paar ruhige Wochen in Schlachtensee. Merkwürdig, aber die Hitze ist eben so, dass man einfach nichts unternimmt. Es ist gar nicht Gluthitze, sondern Feuchtigkeitshitze. Rudi und ich leiden aber nicht sehr darunter, sie wirkt bei uns wie bei allen, man schwitzt und schwitzt in fantastischer Weise. Jeder Mensch, auch wenn man eingeladen ist, trägt im Gürtel ein Frottiertuch von der Größe eines doppelten Herrentaschentuches, und trocknet sich dauernd damit ab. Beine und alles. Na, Helmuth sagt, schlimmer als jetzt kommt es nicht, und das vertrage ich ganz gut. Man gewöhnt sich daran, dass es auf Rudis Zeichnungen rinnt, das Bett durch und durch feucht ist und es Tag und Nacht gleich heiß bleibt.
Ich kann natürlich nicht sagen, dass ich wenig erlebe, auch wenn ich viel zu Hause bleibe. Einmal mit Auto oder Rikscha in die Stadt zu fahren, birgt tausend Interessantes. Das Europäerviertel (dreißigtausend Europäer, drei Millionen Schanghai-Einwohner) ist bis auf ein paar Straßenzüge des Villenviertels durchaus chinesisch. Läden, Wohnungen, Straßenläden – alles chinesisch. Man kommt also aus Woidts Haus, wo wir zunächst gut untergekommen sind, in die nächste Querstraße, vor jedem Haus stets dann draußen ein kleiner Tisch – die Straße sieht beinahe wie eine gedeckte Tafel aus – und dicht darum hocken Chinesen und essen aus Schüsseln und mit Stäbchen ihre Abendmahlzeit. Kinder liegen bereits auf Matten, natürlich auf der Straße, und schlafen. Durch die Straßen gehen Verkäufer, einen Balken über der Schulter, vorn und hinten hängt ein Korb mit Gemüse, Obst oder brennenden Öfen, auf denen Tee kocht oder geheimnisvolle Dinge mit scheußlichem Fett vermengt braten. Die Hälfte aller Chinesen scheinen solche Art Wanderverkäufer zu sein, jedenfalls erwacht man morgens 6 Uhr davon, dass sie ihr Zeug anpreisen. Heute Nacht war nun Teufelsaustreibung. Irgendwer stirbt, dann zieht die ungeheure Verwandtschaft mit Priester und Musik herum, um böse Geister fernzuhalten. Wie es genau ist, weiß ich nicht, mir genügte fürs Erste der ungeheure Krach, den musikähnliche Instrumente dicht vor unseren Fenstern erzeugen.
6. August 30
Dear family, uns geht es gut. Ich bin immer wieder von neuem froh, dass wir so mühelos in einen so gut geleiteten Haushalt hereingerutscht sind, der uns das Leben angenehm macht. Das Haus hat schöne helle Räume, es wird gut und sehr nahrhaft gekocht, man hat Ruhe und Pflege. Das heißt, Pflege brauchen wir nicht, aber es ist angenehm, in der Hitze nicht allzu viel zu tun. Die Sonnabende und Sonntage werden regelmäßig bei Dr. Wilhelm verbracht, ein Deutscher, der ein großes Haus führt und einen Tennisplatz hat. Man findet sich dort zu sechst oder acht zusammen, der eine Teil spielt Tennis, der andere liegt im Garten auf Liegestühlen und sieht zu. Es wird Tee, Whiskysoda und guter Kuchen gereicht und vor allem in beliebigen Mengen Fruchteis. Ich darf Gott sei Dank wieder essen, meinem Magen geht’s besser. Das einzig Unästhetische sind die Spieler, wenn sie vom Platz kommen, denn nicht nur das Hemd klebt am Körper, sondern auch die Tennishosen schmiegen sich klatschnass an, aber daran gewöhnt man sich bald. Eine andere Attraktion ist der Jazzfieldpark, ähnlich wie der Tiergarten, nur viel üppiger und nirgends Gitter. Man darf natürlich auf den Rasen, und unter Baumgruppen und Gebüschen verstreut und mitten auf der Wiese sind Stühle und Bänke. Marianne und Helmuth haben viele Gäste und sind viel aus. Rudi und ich machen noch nicht allzu viel mit, wir finden einen kühlen Balkon ohne Menschen vorläufig schöner. Gestern haben wir mit der Einrichtung der Räume begonnen und uns Betten à 35 Mark und Korbstühle à 3,50 gekauft. Wir haben uns auch gegen Pocken impfen lassen, Rudi hat schon eine Typhusimpfung hinter sich. Sein Gehalt bekommt er übrigens zu einem Drittel in englischen Pfund. Als Erstes muss Rudi ein Appartement House entwerfen für siebzig Krankenschwestern, das neben einem großen englischen Hospital errichtet werden soll. Das scheint ihm ziemlich selbständig zu unterstehen.
18. August 30