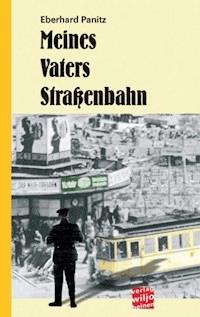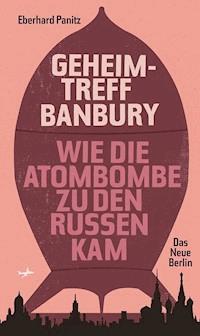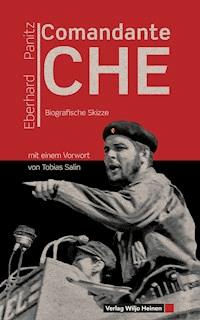
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heinen, Wiljo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Biografische Skizze des Lebens Ernesto Che Guevaras vom Schriftsteller Eberherd Panitz - in revolutionärer Verbundenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
(Diese Seite ist absichtlich fast leer.)
Eberhard Panitz
Comandante Che
Biografische Skizze
mit einem Vorwort von Tobias Salin
2018 • Verlag Wiljo Heinen, Berlin und Böklund
© Dieses elektronische Buch ist urheberrechtlich geschützt!
Autoren und Verlag haben jedoch auf einen digitalen Kopierschutz verzichtet, das heißt, dass – nach dem deutschen Urheberrecht – Ihr Recht auf Privatkopie(n) durch uns nicht eingeschränkt wird!
Selbstverständlich sollen Sie das Buch auf allen Geräten lesen können, die Ihnen gehören.
Als Privatkopie gelten Sicherungskopien und Kopien in geringer Stückzahl für gute Freunde und Bekannte.
Keine Privatkopie ist z.B. die Bereitstellung zum Download im Internet oder die sonstige »Einspeisung« ins Internet (z.B. in News), die dieses Buch »jedermann« zur Verfügung stellt.
Autor und Verlag achten Ihr faires Recht auf Privatkopie – bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie das Urheberrecht von Autor und Verlag achten.
Nur dann sind wir in der Lage, unsere elektronischen Bücher zu kleinem Preis und ohne digitalen Kopierschutz anzubieten.
Wenn Sie noch Fragen haben, was denn »faire Kopien« sind, schreiben Sie einfach eine Mail an
Eberhard Panitz,
Jahrgang 1932, arbeitet seit 1959 als freier Schriftsteller. Er lebt heute in Berlin.
1961 bereiste er mit Schriftstellerkollegen das revolutionäre Kuba und erlebte unter der »Reiseleitung« von »Tania la Guerillera« (Tamara Bunke) Kubas Aufbruch.
Die Eindrücke der Reise, auf denen er auch den Che, Fidel und Raúl Castro kennenlernte, flossen in zahlreiche seiner Werke ein, darunter »Cristobal und die Insel« (1963), die Tamara-Bunke-Biografie »Der Weg zum Rio Grande« (1973) und »Cuba mi Amor« (2004), mit dem damals geführten Tagebuch.
Eberhard Panitz und Tamara Bunke, 1961;
Foto: Thomas Billhardt / Archiv E. Panitz
Inhalt
Nehmt ihn euch zum VorbildVorwort von Tobias Salin [→]
»Alle Tage müssen wir kämpfen, damit diese Liebe zur lebendigen Menschheit sich in konkrete Taten umsetzt, in Handlungen, die als Vorbild, die als Mobilisierung dienen.«
Der Appell Ernesto Che Guervaras, in Lateinamerika nur liebevoll »El Che« genannt, war keine leere Worthülse, sondern seine eigene Maxime. In ihm verschmolzen Theorie und Praxis zu einem Guss, er kämpfte Zeit seines Lebens gegen die schreiende Ungerechtigkeit der imperialistischen Welt – die von Ausbeutung, Krisen und Kriegen bestimmt war und bis heute ist. Bei seinen unzähligen Bemühungen als Kommunist, die einfachen Menschen von der Tyrannei der großen Konzerne und Banken und ihren Handlangern zu befreien, befehligte er niemals nur aus der sicheren Zentrale, sondern kämpfte entschlossen in den ersten Reihen der Revolutionäre und Revolutionärinnen. Selbst die Soldaten des Feindes achtete und versorgte er, nachdem sie sich ergeben hatten, da nicht sie es waren, die er politisch bekämpfte. Gleichzeitig war er immer an der Seite seiner Genoss:innen, denen er noch während der Revolution in neu errichteten Schulen das Lesen und Schreiben beibrachte. Schon bevor er sich dem – von Fidel Castro gegründeten – »Movimiento 26 de Julio« in Mexiko anschloss, kündigte er an, nach der Befreiung Kubas weiter für die Unabhängigkeit Lateinamerikas zu kämpfen. Das sollte seine Antwort sein auf die zerstörerische Politik der führenden imperialistischen Staaten, die verantwortlich waren für den Hunger, das Leid und die Ermordung der Unterdrückten und Ausgebeuteten dieser Erde.
Nicht nur seine Gefährten, sondern Menschen in der ganzen Welt bewundern Ernesto Che Guevara für dieses solidarische Handeln ebenso wie für seine damit verbundene revolutionäre Energie, seinen Mut und seine Aufrichtigkeit. Das gilt vor allem für die Menschen, für deren Befreiung er in Kuba führend kämpfte. So entwickelte sich in Kuba nach Ches Tod eine Nation, die sich vornahm, wie er zu handeln. Das Bild des kubanischen Fotografen Alberto Díaz Korda – welches heute eines der am häufigsten gedruckten Bilder weltweit ist – wird von der kubanischen Bevölkerung nicht nur wie in vielen kapitalistischen Ländern von den Menschen auf T-Shirts und Rucksäcken, sondern auch im Herzen getragen. »Wie Che werden …« ist ein viel betontes Vorhaben der kubanischen Jugend gewesen und auch heute noch werden die Kinder Kubas im Geiste Ches und für seine Vorstellungen vom Kommunismus erzogen und gesamtgesellschaftlich geprägt.
Auch außerhalb des karibischen Eilands nahmen sich Unzählige ein praktisches Beispiel an ihm und wurden so selbst zum Idol, indem sie bereit waren, ihr Leben für die Menschheit zu geben. Es entwickelte sich in Lateinamerika ein sogenannter Guevarismus: In Chile gründete sich 1965 die Bewegung der Revolutionären Linken ( Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR) und fand bis in die 80er Jahre viele Mitstreiter:innen für eine sozialistische Revolution. Unter der Militärdiktatur von Pinochet war sie die einzige Organisation, die ernstzunehmend Widerstand leistete. Die Tupamaros operierte als kommunistische Guerilla ab 1963 als bewaffnete Arbeiter:innen in Uruguay, um gegen die folternde Regierung und Diktatur des Kapitals zu kämpfen.
Schließlich strahlte auch bis nach Deutschland Ches revolutionärer Geist. So bezogen sich die sogenannte »68er-Bewegung« sowie die Gegner:innen des Vietnamkriegs in Westdeutschland auf die revolutionären Ideen von Che. Bei seiner Reise in die DDR im Jahre 1960 begeisterte er nicht nur viele Menschen, sondern zog nicht Wenige in den Bann des antiimperialistischen Kampfes. Beispielgebend dafür steht Tamara Bunke, die ihm sogar nach Kuba folgte. Dort wurde sie zur Agentin ausgebildet und kämpfte bis in den Tod Seite an Seite mit dem argentinischen Revolutionär in Bolivien.
Ches Aufsätze »Der Sozialismus und der Mensch auf Kuba«, »Schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam« und »Der Guerillakrieg« spielten schließlich in der theoretischen Anleitung vieler Guerilleros eine wesentliche Rolle. Die erfolgreiche kubanische Revolution lieferte den Beweis für die Möglichkeit der Befreiung von den Unterdrückern und die in 72 Stunden erfolgte Zurückschlagung der Invasion in der Schweinebucht war dann der Beleg für Verteidigungsfähigkeit der Unabhängigkeit. Eben dies machte El Che und das sozialistische Kuba für die Unterdrücker und Ausbeuter so gefährlich. Geheimdienste der imperialistischen Zentren und Armeen der kapitalistischen Regierungschefs ermordeten abertausende Revolutionär:innen und zerschlugen viele fortschrittliche Bewegungen auf dem südamerikanischen und dem afrikanischen Kontinent. Wie gefährlich Ches theoretische Vorstellungen und praktische Handlungen waren wird deutlich bei der brutalen Verfolgung und Ermordung der Revolutionäre um Che und seiner Ermordung in einer ehemaligen Schule in La Higuera ( Bolivien ). Unmittelbar danach wurden seine Gebeine verscharrt, seine Verwandten verfolgt, seine Ideen verfälscht und seine weltweite Beliebtheit gegen Fidel Castro und den kubanischen Staat zu benutzen versucht. Noch heute wird von der »Rivalität« und den vermeintlichen Bruch zwischen Fidel und Che berichtet, um gegen die sozialistische Regierung Kubas zu hetzen. Noch heute zeigt Kuba, dass eine andere Welt möglich ist. Eine Welt frei von Krieg und Ausbeutung; eine Welt, in der niemand vor vollen Supermärkten verhungern oder auf der Straße vor Luxusvillen erfrieren muss. Noch heute leiden elf Millionen Kubaner:innen unter der mörderischen Blockade der USA, weil sie ihr Schicksal selbst bestimmen wollen und ihre Natur und ihre Arbeitskraft nicht großen Unternehmen verkaufen. Und noch heute ist El Che ein Vorbild für viele Menschen weltweit.
Seinem Beispiel zu folgen ist heute notwendiger denn je: die acht reichsten Männer der Welt besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, während täglich zehntausende Menschen verhungern. Unzählige Wälder werden gerodet, Ozeane verschmutzt, Böden verseucht und somit langfristig die Lebensgrundlage der Menschheit für kurzfristige Profite zerstört. Die Zeit ist lange reif für die Zerschlagung der alten Gesellschaftsordnung und der Kampf für den Sozialismus zwingend notwendig, auch wenn die Formen des Kampfes heute zum Teil andere sind. Betrachtet Che nicht als historische Figur, verehrt ihn nicht als unerreichbares Idol, sondern nehmt ihn euch zum Vorbild. Spürt – wie Che es in seinem Abschiedsbrief an seine Kinder selbst schrieb – zu jeder Zeit jede Ungerechtigkeit auf dieser Welt und fühlt euch verantwortlich für die Schaffung einer Gesellschaft der Freiheit und Gerechtigkeit.
»Die Gegenwart gehört dem Kampf; die Zukunft gehört uns.«
1961: Che Guevara in Playa GirónFoto: Eberhard Panitz
Platz der Revolution
Es lohnt, darüber nachzudenken, warum andere viel gerühmte oder geschmähte Gestalten und Erscheinungen des vorigen Jahrhunderts längst vergessen sind, jedoch die Erinnerung an Che Guevara lebendig bleibt und wohl auch noch die folgenden Generationen erreicht und begeistert. Sein denkwürdiges Leben dauerte von 1928 bis 1967, also nicht einmal vierzig Jahre. Diese kurze Zeitspanne lässt sich nicht als abenteuerliches oder romantisches Heldenleben abtun, durch den frühen Tod ins Märtyrertum entrückt. Vieles, wofür dieser Mann mit größtem Engagement und letztem Einsatz focht, weist auf sehr Gegenwärtiges, immer noch Brennendes, Aufrührerisches und unabweisbar Zukünftiges hin.
Fidel Castro sagte nach seinem Tod: »Als Che fiel, verteidigte er keine anderen Interessen, keine andere Sache als die der Ausgebeuteten und Unterdrückten dieses Kontinents, die der Armen und Gedemütigten dieser Erde. Und selbst seine Feinde wagen nicht, seine Uneigennützigkeit und Größe bei der Verteidigung dieser Sache anzuzweifeln. Vor der Geschichte wachsen Männer, die wie er handeln, die alles für die Sache der Gedemütigten geben, die Tag für Tag mehr die Herzen der Völker erobern werden.«
Wäre der promovierte Arzt, Dr. Ernesto Che Guevara, Chirurg, Dermatologe und aufopferungsvoller Lepraarzt, nicht als Revolutionär und Anführer eines Guerillatrupps im Indiodorf Higuera von bolivianischen Regierungstruppen und US-Rangern brutal und heimtückisch ermordet worden, könnte er noch gut und gern bei den jetzigen Debatten um soziale Gerechtigkeit sowie nationale und globale Befreiung unter uns sein. Lange haben die Täter die schändlichen Tatsachen um seinen Tod verschwiegen, bestritten und seinen Leichnam unter strengster Geheimhaltung verschwinden lassen. Alle Spuren sollten verwischt und wenn möglich auf ewig beseitigt werden, sogar die Hände wurden deshalb dem Toten abgetrennt. Aber diese Hände und sein Tagebuch sind schließlich auf abenteuerlichen Wegen nach Havanna gelangt – dreißig Jahre nach seinem Tod dann auch die auf dem bolivianischen Militärstützpunkt Vallegrande verscharrten übrigen Gebeine Ches, Tamara Bunkes und anderer ermordeter Kämpfer. Der tote Che mit seinem revolutionären Vermächtnis blieb für seine Mörder und ihre Befehlsgeber nicht weniger gefährlich als der lebende Comandante – wohl noch weit über die jetzige Zeit der düsteren Niederlagen und Kehrtwenden der Geschichte hinaus.
1997, dreißig Jahre nach der Ermordung in Bolivien, fanden die Überreste der Guerilleros ihre würdige Ruhestätte.Ches Tochter Aleida Guevara (am Rednerpult) zusammen mit Fidel, Raúl und anderen Führern der kubanischen Revolution am 17. Oktober 1997 im Mausoleum in Santa Clara
In den vergangenen Jahrzehnten bin ich oft gefragt worden, ob ich mir, als ich Che Guevara damals in Kuba traf und wir miteinander sprachen, der Bedeutung dieser Begegnung und des historischen Moments bewusst gewesen sei. Es war 1961, bei meiner Kubareise mit Horst Salomon und Thomas Billhardt, und ich hatte mich am 26. Juli auf der Tribüne am José-Martí-Denkmal von Havanna in Che Guevaras Nähe gedrängt, weil mich Tamara Bunke – unsere Dolmetscherin – auf ihn aufmerksam gemacht hatte. Sie war wie er in Argentinien geboren, schwärmte von ihm und seinem heldenmütigen Einsatz bei den Kämpfen in der Sierra Maestra und dem Sturm auf Santa Clara und Havanna. Wir waren erst den dritten Tag in Kuba, doch schon bei der Ankunft des sowjetischen Kosmonauten Gagarin in Fidel Castros Nähe geraten. Nun riefen Hunderttausende Menschen, die den Revolutionstag feierten: Che solle sprechen. Fidels Stimme war nach einer dreistündigen leidenschaftlichen Rede heiser geworden, er musste innehalten. Doch ehe Che zu Worte kam, hallte vieltausendstimmig die Hymne des 26.-Juli-Aufstands über den Platz. Die aus allen Provinzen der Insel herbeigereisten Bauern, die Städter und Soldaten sangen und schwangen schwarzrote und weißblaue Fahnen mit dem Stern, und viele tanzten in dem Gewühl auf dem riesigen Platz. Lächelnd genoss Che angesichts dieses Freudentaumels, dass er nicht zu Worte kam, und auch Fidel nicht, als sich dessen Stimme erholt hatte, und er der Menge zurief: »Wollt ihr mich wie die Yankees zum Schweigen bringen?« Ein schrilles: »No!« war die Antwort, dann immer wiederholt: »Yankis no! Fidel sí, Che sí, Cuba sí !«
Che sah darin, wie er später im Rückblick schrieb, eine »besondere Art, mit dem Volk eins zu werden«, was man nur, wenn man es miterlebt habe, würdigen könne: »Bei den großen öffentlichen Zusammenkünften bemerkt man so etwas wie den Dialog zweier Stimmgabeln, deren Schwingungen beim Gesprächspartner jeweils andere, neue hervorrufen. Das schwer zu Begreifende für den, der die Revolution nicht gemacht hat, ist die feste dialektische Einheit, die zwischen dem Individuum und der Masse herrscht, innerhalb derer beide in Wechselbeziehung zueinander stehen, und die Masse ihrerseits, als Gesamtheit von Individuen, in Wechselbeziehung zu den Führern steht.«
1961: Comandante Fidel Castro, Premierminister der Revolutionsregierung, mit einer Grußbotschaft anlässlich des fünfzehnten Jahrestages der Internationalen Studentenunion (International Student Union – UIE). Fidel Castro prangert eine neue bewaffnete Intervention der Vereinigten Staaten an. Foto: www.fidelcastro.cu
Alles unter sengender Sonne: Kleidungen in grellen Farben, abgewetzte, schäbige Uniformen, verschwitzte helle, dunkle und schwarze Gesichter, bärtige Männer und Mulattinnen, herausgeputzte Schönheiten und Jugendliche barfuß und in Lumpen, Körper, die sich im Takt afroamerikanischer Rhythmen wiegten, Gesichter auch, aus denen Wut und Trauer über einstiges Leid noch nicht gewichen waren, und da und dort seltene Masken der Gleichgültigkeit oder gar neuen Hasses.
Noch waren die Verbrechen der Batista-Diktatur frisch in Erinnerung und vieles überwältigend neu, kaum begreifbar und für manche ungeheuerlich, was die Revolution von den Bergen der Sierra Maestra herab in kurzer Zeit übers Land gebracht hatte: Die Bodenreform, die Enteignung der USA-Firmen, die radikale Auflösung der alten korrupten und ferngesteuerten Verwaltung und Armee, die bestandenen Abwehrkämpfe jener Tage sowie die begonnene Alphabetisierungs-Kampagne, da bisher die Mehrheit des Volkes nicht einmal die Chance zum Lesen- und Schreibenlernen hatte.
Nach diesem erlebnisreichen Tag in Havanna, war am folgenden Tag, 12 Uhr, eine Fahrt nach Playa Girón, zur Schweinebucht, geplant, wo vor drei Monaten die Invasion der USA und derer kubanischen Söldner nach 72-stündigem Kampf gescheitert war. Ich schrieb unterwegs eifrig in mein Tagebuch, doch glaube bekennen zu müssen, dass mir da keinesfalls die Ereignisse und Begegnungen in ihrer wahrlich historischen Bedeutung, Dramatik und Gefährdung ganz bewusst waren.
»27. Juli 1961. Ärger als pünktliche Deutsche, weil wir stundenlang vorm Hotel sitzen und warten, ohne dass es jemand kümmert. Erst nach und nach versammeln sich die anderen Ausländer, zuletzt erscheint Tamara Bunke und meint lächelnd: ›Nur keine unrevolutionäre Ungeduld, gleich geht’s los !‹ Es ist dann 15:30 Uhr, als der Bus vorfährt und wir mit einer Gruppe aus Brasilien und Paraguay einsteigen. In Playa Girón fahren wir in Galoppgeschwindigkeit an der Landestelle vorbei, die von einem Palmengürtel umgeben ist. Eine gute Straße verläuft dicht am Strand, landeinwärts von undurchdringlichem Dschungel und von Sümpfen umgrenzt. Man kann sich vorstellen, dass hier keiner der Interventen sehr weit gekommen ist.
Am Volksbad Playa Girón sind Karawanen von Autos eingetroffen, Arbeiter aus der umliegenden Gegend haben sich in der unbarmherzig heißen Sonne auf einem Platz schon Stunden vor dem Meeting eingefunden, zu dem, wie es heißt, auch Fidel Castro und Che Guevara erwartet werden. Wieder vergeht viel Zeit, auch der Abend bringt nicht die mindeste Kühlung. Wir vergehen fast vor Hitze und Durst, ich hole uns zwei frisch geerntete Ananasfrüchte. Als ein Hubschrauber landet, schreit es überall: ›Fidel !‹ Man hastet auf den sandigen Kahlfleck inmitten der noch nicht fertigen Neubauten zu, doch Fidel ist nicht im Hubschrauber, niemand will es glauben, ehe man nicht all die anderen Offiziere aus der Kabine hat klettern sehen.
Fidel Castro kommt schließlich mit einem Auto, auch Che Guevara. Ich dränge mich unterhalb der Tribüne durch die Menge und so weit an sie heran, dass ich sie mit meiner primitiven Kamera fotografieren kann. Castro raucht eine Zigarre. Man zeigt ihm ein Intarsienbild, wahrscheinlich das Geschenk eines Künstlers aus der Gegend: Chruschtschow und Castro. Er sieht es sich etwas verlegen an. Seine Miene hellt sich auf, als junge Alphabetisatoren (Schreiblehrer, die selbst noch zur Schule gehen) mit großen Bleistiften und echten sowie symbolischen Petroleumlampen vorbeimarschieren und alte Frauen und Männer ihm Briefe mit ihrem Erstgeschriebenen übergeben. Seine Rede, bei sengender Sonne, hören wir nicht, wir flüchten abseits unter ein Dach.
Als danach Che Guevara spricht, eilt Tamara Bunke zur Tribüne. Sie schwärmt für Che, auch, weil er aus Argentinien stammt, wo sie gleichfalls geboren und bis zur Heimkehr ihrer emigrierten Eltern nach Deutschland aufgewachsen ist. Wie sie mir erzählte, trifft sie sich ab und zu mit ihm und bringt ihm Mate-Tee, das Leib- und Magengetränk der Argentinier, das sie von Landsleuten beschafft. Sie hatte Che bereits in der DDR kennengelernt und als Dolmetscherin nach Leipzig zu einer Konferenz mit lateinamerikanischen Studenten begleitet. Nach seiner Rede kommt sie mit ihm unter das Sonnendach und macht uns miteinander bekannt. Sie stellt Horst Salomon, mit dem ich hier zusammen bin, als ›Poeta‹ vor, weil er vor allem Gedichte schreibt, mich als prosaischen ›Escritor‹, beide hätten wir jedenfalls die Absicht über Kubas Revolution zu schreiben. Er mustert uns freundlich lächelnd. ›Hier gibt es jetzt für euch nicht viel Revolutionäres zu sehen‹, sagt er und weist zur Bucht mit ein paar ausgebrannten US-Fahrzeugen und im Uferschlamm versunkenem Kriegsgerät. ›Das war hier nur ein kleines Gefecht, kein Krieg, keine Konterrevolution. Aber dass wir es geschafft haben, dass weder ein Krieg, noch eine Konterrevolution daraus geworden ist, das sollte man zur Kenntnis nehmen und sich überall gut merken.‹ «
Nichts war mit dem vergleichbar, was ich von zu Hause kannte. Mir dämmerte inmitten dieses aufwühlenden Geschehens immerhin, von welcher Bedeutung das menschliche Profil, die Sprache und Intelligenz der Führer dieser Revolution für den Gang der Dinge und die Mitsprache, der begeisterte Zuspruch des Volkes zu denrevolutionären Entscheidungen war. Mehrmals stand ich dann noch bei den mitreißenden Reden von Fidel, seinem Bruder Raúl und Che eingezwängt in der Menge und erlebtemit, wie daraus hochpolitische Volksversammlungen ohne jedes Tabu mit Zuruf und Gegenrede, Dialogen und leidenschaftlichen, niemals vom Papier abgelesenenBekenntnissen wurden. Diese Begegnung mit der kubanischen Revolution und leibhaftigen Revolutionären gab dem gewohnten Denken einen Stoß und war eineHerausforderung unseres gesicherten, gefestigten aber auch schon zur Selbstzufriedenheit neigenden Realsozialismus.
»Heute hab ich die Demokratie in Aktion erlebt«, sagte Jean-Paul Sartre, nachdem er etwa zur selben Zeit mit Fidel Castro einige Tage unterwegs und Zeuge solcher Zusammenkünfte gewesen war. Und über Che Guevara, den er bewunderte, weil er bei ihm Wort und Tat wie aus einem Guss fand, schrieb er nach dessen Tod: »Ich halte dafür, dass dieser Mann nicht nur ein Intellektueller, sondern der vollkommenste Mensch unserer Zeit war.«
Erst in jüngster Zeit ist bekannt geworden, dass an einem dieser Julitage, vermutlich in Havanna, ein Attentat auf Fidel Castro und Che Guevara geplant war. Der Mordanschlag, vom CIA im Zusammenwirken mit Regierungen Mittelamerikas und Venezuelas vorbereitet, sah vor, mit einem Präzisions-Teleskopgewehr Castro, Guevara und wohl auch Gagarin, der sich damals am Nationalfeiertag dort mit auf der Tribüne des Martí-Monuments befand, zu erschießen. Anschließend sollten eingeschleuste Exilkubaner und Castro-Gegner zum Schein einen »Angriff« der Revolutionären Streitkräfte auf die US-Marinebasis Guantánamo vortäuschen, um so den Vorwand für die bereits zur Playa-Girón-Invasion angestrebte Besetzung der Insel durch 60 000 Soldaten zu liefern. Die Geheimdienste Kubas und der Sowjetunion, die seit Herbst 1960 bereits intensiv zusammenarbeiteten, hatten den Plan jedoch in letzter Minute aufgedeckt und verhindert.
Nachfahre des Vizekönigs
Die Zeichen für den kleinen Ernesto Guevara de la Serna, der am 14. Juni 1928 in Rosario geboren wurde, standen nicht schlecht für einen Weg auf der Sonnenseite des Lebens und zum Erwerb von Bildung und Wissen. Der Vater und die Mutter stammten aus wohlhabenden Familien, allerdings hatten sie beide elf Geschwister und deshalb kein allzu üppiges Vermögen geerbt. Väterlicherseits waren es irische Einwanderer, worauf der Zuname Lynch verweist, Geschäftsleute, Landvermesser und höhere Regierungsbeamte; der Großvater hatte in wilden Gebirgsgegenden die Grenzen Argentiniens und seiner Provinzen markiert und kartographiert. Die Mutter Celia war die Urenkelin des letzten spanischen Vizekönigs von Peru, des Conde de los Andes Joseph de la Serna, der in der letzten Schlacht der Kolonialmacht in Ayacucho 1824 von den aufständischen Südamerikanern geschlagen und zur Kapitulation gezwungen wurde.
Immerhin eine denkwürdige Konstellation, dass der Ahnherr des Che in jener Entscheidungsschlacht des südamerikanischen Befreiungskampfes als oberster Befehlshaber auf der anderen Seite der Barrikade stand, gegen die sein Ururenkel mehr als hundert Jahre später und aus mehr als hundert alten und neuen Gründen bis zum letzten Atemzug focht. Nichts in den hinterlassenen Schriften und Aufzeichnungen des Che deutet darauf hin, dass er dem eine besondere Bedeutung beigemessen hätte. Im Gegenteil, als er in seinem letzten Studienjahr alles hinter sich ließ und mit einem Freund durch fünf südamerikanische Länder reiste, erwähnt er in seinem Tagebuch angesichts des Schicksalsortes seines Ahnherrn diesen nicht einmal, sondern preist stattdessen: »Ayacucho, in der Geschichte Amerikas bekannt für die Schlacht, die Bolivar in den Ebenen vor der Stadt für sich entschieden hatte. Heute aber ist es dort mit der mangelnden Straßenbeleuchtung, die in allen Städten des peruanischen Hochlands ein Ärgernis ist, am schlimmsten: Die elektrischen Glühbirnen erkennt man gerade noch an einem schwachen orangefarbenen Schimmer.«
Obwohl sich Che später eingehend mit den Werken von Marx und Engels befasst hat, dürfte ihm wohl auch, falls er darauf gestoßen sein sollte, darin die Erwähnung des Ortes Ayacucho – eine Gründung des Inka-Eroberers und Schlächters Francisco Pizarro – und des Namens seines Urahnen durch sie keiner besonderen Beachtung wert gewesen sein; vermerkt oder geäußert hat er jedenfalls darüber nirgendwo etwas. Für das Konversationslexikon »The New American Encyclopaedia« hatte Marx, um seine Existenzbedingungen aufzubessern, unter großzügiger Mitarbeit von Engels, einige Artikel besonders zu militärgeschichtlichen Stichworten verfasst, darunter auch zu jenem Namen und Ort. »Nach der Schlacht von Junin (6. August 1824)«, heißt es da, »versuchte der spanische Vizekönig General de la Serna, durch verschiedene Manöver die Kommunikationen der Armee der Aufständischen unter General Sucre abzuschneiden. Als er damit keinen Erfolg hatte, zog er schließlich seinen Gegner auf die Ebene von Ayacucho, wo die Spanier eine Verteidigungsstellung auf der Höhe bezogen hatten. Sie zählten 13 Bataillone Infanterie, dazu Artillerie und Kavallerie, insgesamt 9 310 Mann. Am 8. Dezember 1824 kamen die Vorhuten beider Armeen ins Treffen, und am folgenden Tag rückte Sucre mit 5 780 Mann zum Angriff vor. Die zweite kolumbianische Division unter General Cordoba griff den linken Flügel der Spanier an und brachte ihn sogleich in Verwirrung. Die peruanische Division unter General La Mar stieß am linken Flügel auf hartnäckigen Widerstand und konnte nicht vorrücken, solange die Reserven unter General Lara nicht herangekommen waren. Da der Feind nun überall zurückwich, wurde die Kavallerie zur Verfolgung eingesetzt, welche die spanische Reiterei zerstreute und die Niederlage der Infanterie vollkommen machte. Die Spanier hatten unter den Gefallenen sechs Generale und verloren insgesamt 2 600 Mann an Toten, Verwundeten und Gefangenen, unter den letzteren befand sich der Vizekönig. Die Verluste der Südamerikaner betrugen: ein General und 308 Offiziere und Soldaten an Toten und 520 Verwundete, unter ihnen sechs Generale. Am nächsten Tag unterschrieb General Cantarac, an den das Kommando der spanischen Armee übergegangen war, die Kapitulation, derzufolge nicht nur er und alle seine Truppen zu Kriegsgefangenen erklärt wurden, sondern auch alle spanischen Truppen in Peru, alle militärischen Einrichtungen, die Artillerie und die Magazine sowie ganz Peru, soweit es noch in den Händen der Spanier war (Cuzco, Arequipa, Puno, Quilca etc.), den Aufständischen übergeben werden mussten. (…) Damit war die spanische Herrschaft endgültig gebrochen, und am 25. August 1825 proklamierte der Kongress von Chuquisaca die Unabhängigkeit der Republik Bolivien.«