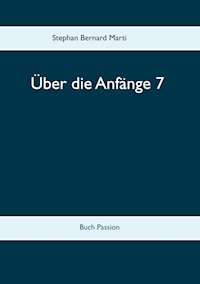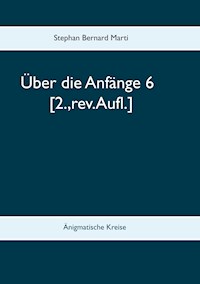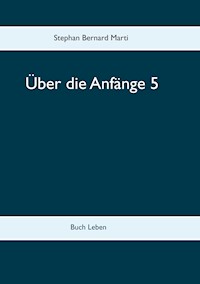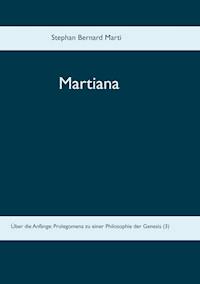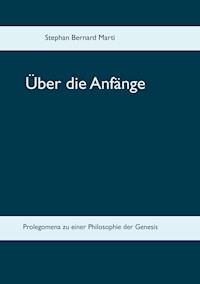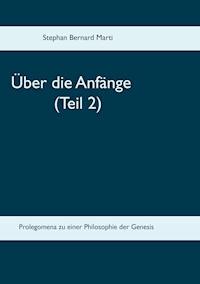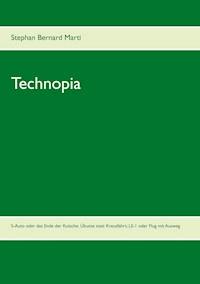Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Geigenunterricht und andere Erzählungen - oder wie Literatur, Lyrik, Philosophie, Geschichte und Religion in die intertextuelle Gegenwärtigkeit und Zukünftigkeit geraten... auch in heroische und traurige Gedichte zum Ukraine-Krieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Die Überholung
2. Über Die Wahlverwandtschaften (1809) und Le rouge et le noir (1830)
3. Die Erbse der Erbse der Erbse...
4. Ukrainische Kriegspoeme
5. Rapp-Gedichte
6. Die Rote Zora des Containing
7. Aus Thoreaus "Walden"
8. Zurück, auf die Bäume!
9. Der Küsser
10. Das erste Paradies der Menschheit
11. Die Bestätigung
12. Pflanzenquälerei
13. Der Hinterweltler und die Ewigkeit
14. Das Vöglein in der Abstellkammer
15. Der Literatur-Dozent
16. Die Bekehrte
17. Der Menschenhändler von Luzern
18. Heta - Hamlet 2. Teil.
19. Im Kartenhaus
20. Das Vatikanmuseum
21. Der Zooausbrecher
22. Über Adler und Adlerhalter
23. Ende und Wiedergeburt der Olympiade
24. Die Geburt der Bücher
25. Der Literaturaufklärer
26. In den Knochen
27. Geigenunterricht
Die Überholung
Dem mittlerweile berühmten Schriftsteller Olle Kogard – jede Ähnlichkeit mit einer lebenden Person ist nicht rein zufällig - wird nachgesagt, die Autobiographie revolutioniert zu haben - abgeneigte Kritiker und Neider meinen dazu, wenn überhaupt jemand die Autofiktion revolutionierte, dann Marcel Proust. Scheinbar mühelos überholte Kogard die autofiktionale Literatur, mühelos und rücksichtslos, ähnlich wie Maxim Billers Roman Esra (2003) und Klaus Manns Mephisto (1936/1981), plündert er, fledderte er das soziale und physische Leben seiner Partnerin, Kinder, Familie, Freunde, Passanten, Geschäfts- und Behördenkontakte, Nachbarn, Vermietern, Verwandten, Bekannten, und deren Verwandten und Bekannten, aus, so dass sein autofiktionales Projekt - eine einzige unterlassene Unterlassungserklärung im Namen der Kunstfreiheit - sicherlich einer der größten Ansammlungen von potentiellen Verletzungen von Persönlichkeitsrechten in der Literaturgeschichte ist [Kogard war bemüht (bei der Ex), wurde er nicht gezwungen (vom Onkel), dieses Potential zu verringern] und auch dass er sein Buchprojekt, wie Hitlers Elaborat, "Mein Kampf" nannte, ist rücksichtlos, aber passt zu Kogards Gesamtkonzept, das sich auf der literarischen Überholspur befindet, denn dieser Titel ist viel spektakulärer als z. B. der Titel "Mein Leben", den der deutsch-jüdische Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki seiner Biographie gab (1999) oder "Meine Zeit" oder "Mein Zeitalter". Mit "Mein Kampf“ hast du alle Augen auf dich gerichtet, dieser Titel erzwingt Aufmerksamkeit und weckt grauenhafte Erinnerungen, mit ihm setzte sich Kogard (aus Pietät und Anstand lehnten ihn etliche Verleger ab) unter Rechtfertigungs-, also produktiven Denk- und Schreibzwang. Elegant hat der Autor diese Rechtfertigung gemeistert, er hätte diesen Titel dem Tabu entrissen, meinte er in einem Interview mit einer deutschen Zeitung, die Norweger würden jetzt zwischen „min kamp" und "Mein Kampf", deutsch ausgesprochen, unterscheiden. Sicher: Kogard und Hitler trennen Welten, Zeiten und Räume. Kritiker meinen, er hätte sein literarisches Großprojekt besser "Mein Überholungszwang" nennen sollen. Bis zum letzten Band, dem sechsten, blieb er auf dieser Spur. Doch er wollte auch auf der literarischen Überholspur abheben, zum Überflieger werden in den Literatur-, Geschichts- und Kulturwissenschaften, indem er sich z. B. mit seinem "Mein Kampf" in den Kampf mit Hitlers "Mein Kampf" machte. Ein Kampf, der eher ein riesiges Arsenal erfordert, das mit allen Wassern gewaschen ist, als ein schmales Stilett, mit dem man clever herumfuchteln kann, um ihn erfolgreich zu bestehen. Als Beispiel nehmen wir eine Sequenz aus Kogards Darstellung einer Lebensphase des jungen Hitler, konzipiert als eine Korrektur - "Gegendarstellung" wäre zu viel gesagt - der Darstellung des aktuell maßgeblichen Hitler-Biographen Ian Kershaw (Hitler: 18891936: Hubris (Bd. 1), dt. 1998) und Brigitte Hamanns Monographie Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators (1996), wobei hierfür Kogards Hauptquellen die 1953 publizierte Erinnerung von Hitlers Jungendfreund August Kubizek und Mein Kampf selber sind. Kogard operierte mit seinem Skalpell einen jungen Hitler des „unschuldigen“ Augenblicks heraus, von dem Biographen (oder HistorikerInnen, die vor der Anachronismus-Falle stehen) absehen sollten "was später geschah", sonst würden sie ihn verpassen, ihn, post hoc deterministisch einengen, weil nur sie wissen, was geschehen wird, was die Zukunft mit diesem jungen Mann und er selber aus der Zukunft machen wird, er selber wisse es noch nicht, wohlwissend, dass es bei einem jungen Hitler (was wäre gewesen, wenn ihn die Münchener Kunstakademie nicht abgewiesen hätte?) fast unmöglich sei:
"all den Zeichen, also Charakterzügen und Ereignissen, die in diese Richtung deuten, keine Aufmerksamkeit zu schenken".
Für Kogard existiert "In der Nacht der Pathologie und des Determinierten...kein freier Wille und ohne freier Wille auch keine Schuld. Unabhängig davon, wie kaputt ein Mensch ist, unabhängig davon, wie verzerrt seine Seele ist, bleibt er doch immer ein Mensch, der eine Wahl hat. Es ist die Wahl, die uns zu Menschen macht. Das allein gibt dem Begriff Schuld einen Sinn.
Kershaw und fast zwei ganze Generationen mit ihm verurteilen Hitler und sein gesamtes Wesen, als würde man ihn und seine Bösartigkeit verteidigen, wenn man auf seine Unschuld im Alter von neunzehn Jahren oder dreiundzwanzig Jahren verweist oder auf seine dauerhaft guten Eigenschaften. Im Grunde verhält es sich jedoch umgekehrt. Erst seine Unschuld verleiht seiner Schuld Gewicht." (S. 609).
Das ist schon richtig, Hitler liebte seine 47jährige Mutter, legte sich selbstlos ins Zeug für sie, als sie im Sterben lag. Zugleich versprach ihm ihr Tod eine Witwenrente, lag in ihrem Unglück ein kleiner materieller Trost für den völlig Verarmten, den das bürgerliche Erbrecht eh vorsieht: Wird ein Verwandter zu Asche, kommt, in bürgerlichen Kreisen, Asche in die Kasse. Wenn Hitler ein ganz normaler Mensch war, dessen Bösartigkeit ausartete - Hannah Arendt hielt Eichmann nicht einmal für einen Sadisten (dabei war er ein Monster von Sadist) -, dann sind alle potentiell Hitler (in diese Richtung geht die These von Christopher Brownings: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die "Endlösung" in Polen (1993)), doch sind Hitler und Hitlers Umwelt ganz anders als wir (unsere):
"dann sind wir im Verhältnis zu den Untaten, die er und das Deutsche Reich später begingen, zu nichts verpflichtet, dann war das alles etwas, das "sie" taten und das uns nicht mehr gefährlich wird. Doch was ist das "Schlechte", was wir nicht sind? Was ist das "Böse", was wir nicht verkörpern?"
Kogards klingt hier wie ein sartre'rscher Existenzialist mit protestantischem Einschlag, der per Fehlschluss annimmt, abstrakte menschliche Freiheit und Wahl machen sein Wesen aus. Später distanzierte sich Sartre von dieser "bürgerlichen" Interpretation und näherte sich in "Die Kritik der dialektischen Vernunft" (1962), vor allem über Hegel und Marx, komplexeren, realeren, sozialdeterministischeren Positionen an, die sich nicht in ein Entweder-oder (mit/ohne Verantwortung, etc.) trennen, sondern von einem Sowohl-als-Auch ausgehen, in dem Umwelt- und Individual-Determinanten und -Chancen komplex zusammenwirken und mutieren (deswegen wird sich Geschichte nicht einfach wiederholen, dafür ist sie zu komplex, zu irritabel, zu irreversibel und zu mutagen). Gehen wir also nicht völlig abstrakt davon aus, dass Hitler ein ganz normaler, völlig durchschnittlicher Mensch gewesen war, und dass dessen Potential zur Monströsität in jedem Menschen gleich angelegt sei, vielmehr davon, dass sich früh angelegte Charakterzüge, Eigen-und Leidenschaften - für Theater, für Gesamt-Kunstwerke, für opulente Gebäude -, in diesem Individuum, mit der Synergie und Beschaffenheit einer besonderen sozialen Umwelt verkoppelte, in die sich der Erste Weltkrieg als Schuld und Verschuldung, und die Wirtschaftskrise von 1929 tief in die Biographien von Millionen Menschen (Deutschen) einschrieben.
Übertragen auf die Entwicklungspsychologie betont Kogard die lebenslange Plastizität, die in einem Menschen angelegt ist, unterbelichtet dabei aber die sich früh bildenden, irreversiblen operativen Fähigkeiten und Charakterzüge, die in der Kindheit und Jugend durch die Interaktion mit der sozialen Umwelt ausreifen. Rückschließend auf dessen wagnerhaften Aufstieg auf der Weltbühne, nehmen wir an, dass wir es bei Hitler mit einem außerordentlich kalkulierenden Menschen zu tun haben, der mit Rienzi-Syndrom, Wagner-Bühnen zum Vorbild aller seiner Bühnenauftritte, alle seiner politischen Inszenierungen, machte. Und nehmen wir an, dass sich in Hitler früh die Einbildung festsetzte, genährt durch das einzige Talent, das ihn in der Schule auszeichnete, sein Darstellungs-, sein Zeichentalent, er sei anders und besser als die anderen, dann lebte er lange in einer für ihn nicht adäquaten, minderwertigeren, elenderen Parallelwelt, ausgeschlossen von einer Welt von Herren, die anerkannter und "besser" in ihr standen, und bei den "besseren", den "eleganten" Damen ankamen, die Hitler, wie „seine“ Stefanie, nur aus Distanz begehren konnte: die Welt der Offiziere, der Kunststudenten, der Künstler, der Musiker, der Dichter, der Opernsänger, der Architekten, der reichen Bürger, weniger interessierte Hitler die Welt der Beamten, wie sein Vater einer war, der Handwerker und der Arbeiter. Der Antisemitismus, die Erfassung der Welt der Juden, in Wien insbesondere der "Ostjuden", als Welt der "Untermenschen", musste für den jungen Hitler, dem als Vorurteil bekannt, aber kaum voll bewusst gewesen sein durfte, dass die Mutter aller Antisemitismen in der paulino-christlichen Theologie, insofern in jedem guten "Christ", in jeder guten "Christin" schlummerte, eine großartige Entdeckung gewesen sein, denn mit ihm eröffnete sich ihm neben der oberen Parallelwelt, von der er sich, unverdient und ungerecht, zumal inadäquat, missachtet und ausgeschlossen fühlte, eine "untere" Parallelwelt, die er voller Verachtung ausschließen konnte, gegen die er die aufgestauten Ressentiments, den empfundenen Neid, die kränkende Zurückweisung, die Missachtung, den Ehrgeiz und die große Willenskraft, die ihm bislang nur das Existenzminimum sicherte, kanalisieren konnte. Als Karrierist des Antisemitismus (und, darauf aufbauend, des Antibolschewismus) - ähnlich wie als Karrierist des Nationalismus, zu dem ihn der Erste Weltkrieg machen wird - konnte er, auf seiner geliebten Wagner-Bühne, die er in der Politik in Szene setzte, hemmungslos Verachtung üben gegenüber einem anderen, als minderwertig betrachteten Teil der Gesellschaft, auch, um zu einer Beachtung und Anerkennung zu kommen, die ihm die andere, als höherwertig betrachtete, Welt bis dahin verweigerte. Als Volkstribun und Wagner-Fan seit seiner Jugend, verwandelte Hitler seine Umwelt, Zuhörer und Zuschauer, allmählich in ein real-existierendes Rienzi-Drama („Rom mach ich groß und frei, aus seinem Schlaf weck ich es auf!“), zu dem er ein pompöses Bühnenbild aufzubauen plante: "Germania", und ein entsprechendes Drehbuch verfasste: "Mein Kampf". In seiner zwölfjährigen Inszenierung, die Generalproben davor nicht mitgerechnet, riss er, bekanntlich, die halbe Welt in den Abgrund.