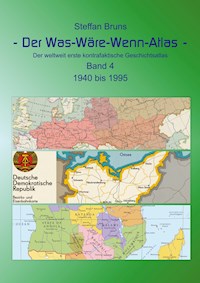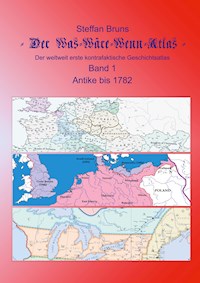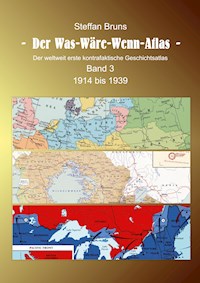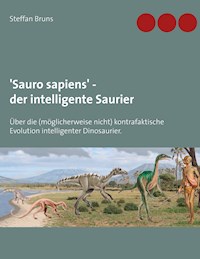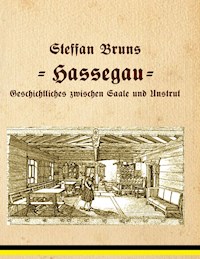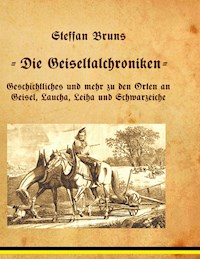
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das hier vorliegende Buch ist eigentlich geradezu aus Versehen entstanden. Für die Region habe ich bereits eine Reihe an Ortschroniken inklusive Ortsfamilienbücher (OFB) verfasst, weitere sind in Vorbereitung bzw. Planung. Um diese OFB mit lokal- und regionalgeschichtlichen Daten ausschmücken zu können, suchte ich nach einem Geschichtsbuch für die Region. Fand aber keines und begann daher selbst zu recherchieren ... irgendwie waren bald ein paar hundert Seiten zusammen. Die brauchten nur noch in einem neuen Zusammenhang gebracht zu werden, mit weiteren Informationen ergänzt und abgerundet und fertig war das Buch, besser gesagt, zwei zusammenhängende Bücher. Na ja, nicht ganz, kaum war es fast fertig, kam ich mehr und mehr in Konflikt mit der allgemeinen Auffassung eines umfassenden Bevölkerungsaustausches östlich der Elbe-Saale-Linie zu Beginn des Mittelalters, der auch starke Auswirkungen auf den Saale-Unstrut-Raum hatte. Nachdem ich mich in dieser Richtung tiefer gehender beschäftigte, merkte ich, dass ich diesbezüglich nicht der Einzige war. Ich entdeckte, dass eine ganze Reihe von Autoren in diese Richtung weisende Ansichten hatten, wenn auch zumeist unterschiedliche und nicht unumstrittene. Die Entstehungsgeschichte des Buches führte dazu, dass das vorliegende Buch eigentlich aus zwei unabhängigen Teilen besteht: Die Ortschroniken der Orte des Geiseltals und seiner Umgebung In topografischer Reihenfolge gibt es hier umfangreiche Ortschroniken, mit besonderem Blick auf die örtlichen Kirchen und Rittergüter. Fernerhin wird auch auf Wüstungen und archäologische Funde in der Umgebung der jeweiligen Ortschaften hingewiesen. Darüber hinaus gibt es aber zu manchen Dörfern zahlreiches Weiteres an Interessantem zu berichten. Die Geschichte des Geiseltals und seiner Umgebung Auch hier verrät der Titel bereits alles, denn es geht hier um Geschichtliches über das Geiseltal, aber auch die unmittelbar dem Geiseltal benachbarten sanften Täler von Stöbnitz, Klia, Leiha, Laucha und Schwarzeiche. Dabei wird auch der geologischen Entwicklung des Geiseltals Aufmerksamkeit gezollt, insbesondere deshalb weil diese auch auf die spätere menschliche Geschichte vor Ort, aber auch in der ganzen Region, einen überaus großen Einfluss hatte. Bei dem 2. Buch handelt es sich um eines über Regionalgeschichte der Region, in welcher sich das Geiseltal befindet - das 'Hassegau'. Und so heißt auch das andere Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagungen für das durchlesen und korrigieren gehen besonders an:
Jürgen Winkler
Inhaltsverzeichnis
Abb. 1.: Übersichtskarte über die Region – Zustand 1920
Vorwort
Das hier vorliegende Buch ist eigentlich geradezu aus Versehen entstanden. Für die Region habe ich bereits eine Reihe an Ortschroniken inklusive Ortsfamilienbücher (OFB) verfasst, weitere sind in Vorbereitung bzw. Planung. Um diese OFB mit lokal- und regionalgeschichtlichen Daten ausschmücken zu können, suchte ich nach einem Geschichtsbuch für die Region. Fand aber keines und begann daher selbst zu recherchieren ... irgendwie waren bald ein paar hundert Seiten zusammen. Die brauchten nur noch in einem neuen Zusammenhang gebracht zu werden, mit weiteren Informationen ergänzt und abgerundet – und fertig war das Buch, besser gesagt, zwei zusammenhängende Bücher.
Na ja, nicht ganz, kaum war es fast fertig, kam ich mehr und mehr in Konflikt mit der allgemeinen Auffassung eines umfassenden Bevölkerungsaustausches östlich der Elbe-Saale-Linie zu Beginn des Mittelalters, der auch starke Auswirkungen auf den Saale-Unstrut-Raum hatte. Nachdem ich mich in dieser Richtung tiefer gehender beschäftigte, merkte ich, dass ich diesbezüglich nicht der Einzige war. Ich entdeckte, dass eine ganze Reihe von Autoren in diese Richtung weisende Ansichten hatten, wenn auch zumeist unterschiedliche und nicht unumstrittene.
Die Entstehungsgeschichte des Buches führte dazu, dass das vorliegende Buch eigentlich aus zwei unabhängigen Teilen besteht:
Die Ortschroniken der Orte des Geiseltals und seiner Umgebung
In topografischer Reihenfolge gibt es hier umfangreiche Ortschroniken, mit besonderem Blick auf die örtlichen Kirchen und Rittergüter. Fernerhin wird auch auf Wüstungen und archäologische Funde in der Umgebung der jeweiligen Ortschaften hingewiesen. Darüber hinaus gibt es aber zu manchen Dörfern zahlreiches Weiteres an Interessantem zu berichten.
Die Geschichte des Geiseltals und seiner Umgebung
Auch hier verrät der Titel bereits alles, denn es geht hier um Geschichtliches über das Geiseltal, aber auch die unmittelbar dem Geiseltal benachbarten sanften Täler von Stöbnitz, Klia, Leiha, Laucha und Schwarzeiche. Dabei wird auch der geologischen Entwicklung des Geiseltals Aufmerksamkeit gezollt, insbesondere deshalb weil diese auch auf die spätere menschliche Geschichte vor Ort, aber auch in der ganzen Region, einen überaus großen Einfluss hatte.
Ergänzend kommt noch ein weiteres Buch hinzu, welches selbst so umfangreich und speziell wurde, dass ich daraus ein eigenes Buch machen musste, um den Umfang des zuvor genannten Buches nicht zu sprengen. Es behandelt die Regionalgeschichte der Region, in welcher sich das Geiseltal befindet und welche mit der historischen Region ‚Hassegau‘ zu verbinden ist:
Menschen, Stämme, Völker, Nationen
Hierbei geht um die Entwicklung kleiner menschlicher Siedlungsverbände zu Stämmen, später zu Völkern und letztendlich zu dem, was wir heute als Nationen bezeichnen. Es geht also um Bevölkerungsentwicklung und Siedlungskontinuität in Mitteleuropa mit einem besonderen Fokus auf das Gebiet der mittleren Saale, in der Besonderheit einer alternativen Sichtweise zum Entstehen einer wendischen bzw. surabischen Bevölkerung zwischen Oder und Elbe/Saale.
Geschichtsträchtiges zwischen Saale und Unstrut
Wie hier schon der Titel verrät, geht es in diesem Teil um die geschichtliche Entwicklung der Region zwischen Saale und Unstrut, dabei durchaus Randgebiete mit einbeziehend. Lokalgeschichte geht nicht ohne Einblick in die Geschichte der umliegenden Region und diese stand ihrerseits in Wechselbeziehungen zu anderen Regionen. Nur wer diese kennt, kann erst seinerseits viele Dinge verstehen, die lokal vor Ort geschahen.
Zusammen mit meinen Ortschroniken / Ortsfamilienbüchern bilden die beiden Bücher ein Duett. Wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass der Inhalt der beiden obengenannten Bücher, in meinen Ortschroniken / Ortsfamilienbüchern in unterschiedlichen Umfang Wiederverwendung findet, denn genau dazu wurde es geschaffen.
Nach meinem Kenntnisstand ist dieses bis zum heutigen Zeitpunkt das einzige Buch, welches sich mit der Geschichte des Geiseltals und seiner unmittelbar benachbarten Täler befasst. Es ist klar, dass dies in diesem Rahmen nur in einem eher bescheidenen Umfang erfolgen kann, aber genau dieser Umfang sollte für den normal Interessierten auch der ausreichende sein. Ich hoffe, dabei weder allzu tiefgründig, noch zu oberflächlich geworden zu sein. Weiterhin hoffe ich, ein Buch verfasst zu haben, welches in der gesamten Familie Interesse an der Geschichte ihrer Ahnen und deren Heimat weckt und gleichzeitig stillt. Über Resonanzen jeglicher Art würde ich mich freuen.
Steffan Bruns
Berlin, den 17. Dezember 2019
P.S. Aus Kostengründen sind sämtliche Bilder nur in Graustufen. Das Buch würde mir, und wohl nicht nur mir, mit Farbbildern besser gefallen, aber es wäre dann ein vielfaches so teuer. Aus Erfahrungen weiß ich, dass es dann zu teuer wäre, um wirklich gekauft zu werden.
Chroniken zu den Orten des Geiseltals und dessen Umgebung
Einleitung
Das Geiseltal gibt es heute faktisch nicht mehr, im 20. Jahrhundert wurde es im Zuge des Braunkohlentagebaues abgebaggert, damit verschwand auch ein Großteil der Dörfer des Geiseltales. Viele der Einwohner dieser Dörfer verschlug es in die umgebenden Orte. Aber nicht zu weit weg, denn was einst Heimat war, wurde nun Arbeitsplatz.
Daher, aber auch weil die Dörfer des Geiseltales und seiner Nebentäler (Klia, Stöbnitz, Leiha) besonders enge Beziehungen zu den Dörfern den Tälern der Schwarzeiche und Laucha hatten, bietet es sich an, all die Täler dieses Gebietes hier zusammenzufassen. Die Geschichte des Geiseltales an sich, sowie der Region in welcher es sich einbettet, dem historischen Hassegau, habe ich im Buch 'Der Hassegau – Geschichtliches zwischen Saale und Unstrut' eingehend behandelt. Dort beschrieb ich die geologische Entstehung der Region und des Geiseltales, aber auch zahlreiche geschichtliche Zusammenhänge von der Steinzeit bis hinein in die Moderne. Die Region im Wandel der Zeiten. Was fehlte, waren die Beschreibungen der Orte, also einzelne Ortschroniken der Teilregionen. Hier mit diesem Buche soll nun von den Chroniken der Orte des Geiseltales und der ihm benachbarten Täler von Stöbnitz, Leiha, Klia, Schwarzeiche und Laucha berichtet werden. Am Ende folgt den Chroniken eine umfangreiche Beschreibung über das Geiseltal, mit geschichtlichen, geologischen, wirtschaftlichen und weiteren Hintergründen.
Das Geiseltal war im frühen Mittelalter Bestandteil der sächsisch-thüringischen Landschaft 'Hassegau' (auch 'Hosgau'), im Westen davon entstand dann das 'Friesenfeld', auch 'Friesengau', bezeichnet, im Norden der 'Nord-Hosgau'. Es war das Land zwischen Unstrut, Saale und Salza. Wohl unter Karl den Großen kam es zu einer Erweiterung nach Norden hin, bis zur Schlenze und bis vor dem Hornburger Sattel. Dieser nördliche Teil führte aber bald schon als 'Nord-Hosgau' ein Eigenleben. Friesenfeld und Nord-Hosgau wurden später zur Grafschaft Mansfeld. Im Norden, Osten und Süden des Harzes reihten sich weitere Kleingaue aneinander.
Die Landschaft wurde und wird als Teil einer reich gegliederten Gefildelandschaft im größten zusammenhängenden Börde-Offenland Mitteleuropas charakterisiert. Das Geiseltal stell sich als sanftes, aber durchaus gut ausgeprägtes Muldental dar, ähnlich wie auch die Täler der Schwarzeiche, Laucha, Stöbnitz, Klia und Leiha, allesamt mit wasserreichen Bächen. Von Westen, also von der Saale bei Merseburg aus gesehen, haben wir eine ruhige Offenlandschaft. Die Ackerfluren bestimmen heute die Physiognomie der Landschaft, Gehölzgruppen und kleine Waldungen an den Wasserläufen gehörten auch dazu. Aber die Horizonte sind nicht unendlich weit entfernt gewesen, recht nah säumten im Süden Wälder die Landschaft. Im Neolithikum war gar die gesamte Landschaft bewaldet und nur mäßig von Lichtungen aufgelockert. In der Bronzezeit wurde die Landschaft aber mehrfach fast vollkommen entwaldet und erst in der Eisenzeit konnte sich wieder ein Waldbestand entwickeln, welcher im Frühmittelalter seine umfangreichste Ausdehnung hatte. Wohl die größte seit der frühen Bronzezeit.
Bei den Chroniken habe ich vor allem Wert auf die früheren Zeiten gelegt. Ob die LPG 'Rote Zukunft' den Kindergarten 'Lenins kleine Oktoberrevolutionäre' baute oder der Bürgermeister der örtlichen großen Koalition so tut, als hätte er die Dorfstraße persönlich neu gepflastert, mag durchaus in eine gute Ortschronik gehören, ich fand es aber eher uninteressant und habe so etwas in der Regel auch ignoriert. Gerne hätte ich zu den vergangenen Jahrhunderten, besonders denen vor der Neuzeit, mehr geschrieben, aber aus den schriftarmen bzw. -losen Zeiten weiß man nicht allzu viel spezifisches – dies ist bedauerlich, liegt aber in der Natur der Sache.
Zu zahlreichen der hier genannten Orte habe ich bereits 'Ortschroniken mit Ortsfamilienbüchern' verfasst, gelegentlich sind die Angaben dort umfangreicher als hier, oftmals aber auch ziemlich identisch. In jedem Falle aber sind diese Bücher um Ortsfamilienbücher erweitert, also umfangreichen Rekonstruktionen der lokalen familiären und verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich gehe davon aus, dass dieses Buch hier vor allem von Leuten gelesen wird, welche entweder selbst aus den beschriebenen Orten stammen, oder Ahnen aus diesen haben. In jedem Falle aber dürften Sie die Hoffnung haben, in den jeweiligen Ortsfamilienbücher mehr zu ihren Vorfahren erfahren zu können. Mit etwas Glück können ihre hiesigen Ahnenketten bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Zu erwerben sind diese Bücher über einen guten Buchhändler bzw. direkt beim Verlag ‚www.cardamina.de‘. Darüber hinaus gibt es aber auch weiterführende Informationen auf meiner Webseite www.steffanbruns.de‘.
Gelegentlich kommt mir beim Schreiben der Chroniken, wenn es um die Herkunft der Ortsgründer und des Ortsnamens geht, was nicht identisch sein muss, der Gedanke: 'Das ist alles so widersprüchlich, warum mache ich dass überhaupt?' Ich denke, diese Widersprüchlichkeit ist auch dem Leser nicht zu verheimlichen. Der Grund, die Chroniken gehe ich aus dem Denken eines Ahnenforschers an, somit ist für mich wichtig, zu wissen, welche Völker oder Stämme einst diese besiedelten. Archäologen, Historiker und Ortsnamensforscher haben hier ihre eigenen, oft sich widersprechenden Ansichten. Man kann sich, ganz nach Belieben mal auf die eine Seite schlagen, mal auf die andere. Meine Sichtweise soll dabei nur eine von vielen möglichen sein. Da Geschichtsdarstellung nicht objektiv ist, es auch niemals war, muss man sich faktisch zu vielen Themen seine eigene Meinung bilden.
Relativ einhellig ist man sich, die Giebelstellung von Gebäuden oder bestimmte Endungen von Ortsnamen bestimmten Stämmen und Völkern zuordnen zu können. So gilt allgemein die Ansicht, die zahlreichen auf '-stedt (-städt)' endenden Ortsnamen der Gegend stammen von Thüringern, genauer gesagt dem thüringischen Teilvolk der Angeln, Germanen die einst nördlich der Elbmündung lebten. Dies könnte sehr gut möglich sein, denn nachgewiesener Maßen siedelten Angeln genau in den Regionen, in welchen sich auf '-stedt' endende Ortsnamen gehäuft vorkommen. Das Problem, bei den Angeln an der Nordsee waren nicht nur die auf '-stedt' endenden Ortsnamen häufig, sondern noch öfter auch solche die auf '-wik' enden, solche lassen sich aber in Thüringen faktisch gar nicht feststellen. Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum die Angeln die eine Endung mitnahmen, die andere aber nicht. Wäre es umgekehrt, könnte man dies deutlich leichter erklären, denn '-wik' ist faktisch ein Synonym von '-dorf', hingegen ist '-stedt' kein Synonym von Stadt, sondern steht für einen hochwassergeschützten Platz in unmittelbarer Gewässernähe – wie z. B. im Ortsnamen 'Stade' oder im Wort 'Gestade' erkennbar. Hier in der Region gibt es nur Bäche und Flüsse, diese sind zwar oftmals recht hochwassergefährdet, aber eher über einen längeren Zeitraum betrachtet. Zudem sind die '-stedt'-Orte hier hauptsächlich auf die oberen Teile der Täler beschränkt, in welchen die Hochwassergefahr zumeist noch etwas geringer ist, als die an den Mittel- und Unterläufen der hiesigen Gewässer. Die auf '-stedt' endenden Ortsnamen an der Nordsee sind dazu im Gegensatz zu Orten gehörend die (einstmals) im Ebbe-Flut-Bereich der Nordsee bzw. großer Flüsse lagen. Logische Konsequenz dieser Feststellung müsste daher sein, dass eine Zuordnung der auf '-stedt' endenden Ortsnamen zu den Angeln nicht machbar ist. Allerdings gibt es hier ein dickes 'aber'! Aber, in Thüringen, und die Region gehörte einst zu Thüringen, ist eine Häufung der auf m '-stedt' endenden Ortsnamen faktisch nur in den Gegenden gehäuft, in welchen man eine Siedlung von Angeln auch aus anderen Gründen annimmt oder sogar nachgewiesen hat. Vielleicht hatten die anderen Thüringer, zum Beispiel die Warnen oder Hermunduren auch eine Vorliebe für auf '-stedt' endende Ortsnamen, denn man kann ihn nicht nur mit 'Gestade' gleichsetzten, sondern auch mit 'Stelle' im Sinne von Platz.
Ähnlich ist es auch mit den zahlreichen auf '-ow/-au' endenden Ortsnamen. Ich komme aus dem Berliner Stadtteil Pankow und als Ureinwohner spreche ich diesen Ortsnamen als 'Pank-ko' aus, Leute aus dem germanischen Altsiedelgebiet sagen aber aus Unwissenheit oftmals nicht 'Pank-ko', sondern 'Pankkoff'. Nur diese sprechen den Namen also 'slawisch' aus, die Ostdeutschen, die mit auf '-ow' endenden Ortsnamen täglich leben, wissen um die richtige Aussprache. Es gibt keinen Beweis, dass es jemals anders war. Schaut man sich die Erstnennungen vieler '-ow'-Namen an, merkt man, dass diese einst auf -au endeten, damit aber auch mit der deutschen Endung '-aue' gleichzusetzen wäre. Eine angebliche Eindeutschung ist zwar möglich, aber nicht zwingend, letztlich oft nur Behauptung. Auch in den Regionen Deutschlands von welchen keine einstige slawischen Besiedlung angenommen wird, gibt es zahlreiche auf '-au(e)' endende Ortsnamen, warum also sollten denn ausgerechnet im Osten Deutschlands, nur weil man für diesen eine einstige slawische Besiedlung annimmt, die gleichen Endungen nun Beleg für eine slawische Besiedlung sein? Und tatsächlich liegen die meisten der auf '-au/-ow' endenden Ortsnamen in einer (einstigen) Aue oder auenähnlichen Landschaft. Kein Grund also, Ortsnamen wie Krakau oder Milzau per se den Slawen zuzuordnen.
Auch der Bezugsname zur Ortsnamensendung ist ein guter, wie auch irreführender Hinweis. Bei einem Ort namens Hermannsdorf ist alles klar, der Ortsgründer hieß Hermann und lebte wohl im hohen Mittelalter. Bei Orten wie Geusa oder Bedra ist dies gänzlich anders, hier ist jeglichen Deutungsversuchen Tür und Tor geöffnet, und gegenteiliges mindestens genauso schwer zu beweisen, wie dafürhaltendes. So nimmt es denn auch kein Wunder, dass für Orte wie die beiden eben genannten, es Ortsnamenstheorien gibt, die locker mehrere Jahrtausende abdecken – zuweilen von Vorindoeuropäern bis hin zu den Slawen. Ortsnamensforscher versuchen einen guten Job zu machen, nach allen Regeln der Wissenschaft, aber anders als Linguisten fehlen ihnen oft die geeigneten Werkzeuge. Ein solches Werkzeug wäre das Wissen um den Ortsnamen bei seiner Entstehung, aber gerade alte Ortsnamen haben es natürlicherweise an sich, eben erst erstmals genannt zu werden, wenn sie schon seit Jahrhunderten in Gebrauch waren und von unterschiedlichen Völkern mehrfach umgeschliffen wurden.
Gleich wie, wenn ich im nachfolgenden von 'Wenden' oder 'wendisch' schreibe, dann meine ich ein Volk, welches im Frühmittelalter aus Abkömmlingen nicht-germanischer Vasallen entstand und den Venetern bzw. Nemetern nahe stand. Eventuell nahmen auch noch die Teurii an der Ethnogenese der hiesigen Wenden teil. Die Vorfahren der Wenden lebten hier bereits vor Ankunft der Germanen und waren selbst Indogermanen – jedenfalls oberflächlich bzw. mehrheitlich. Bei der Ethnogenese der Wenden im Frühmittelalter mischten sich zu diesen noch Reste der sich in Resignation befindlichen Germanen, sowie auch bereits einzeln hinzu wandernde Slawen. Die Slawen nennen ihre östlichen Nachbarn nicht umsonst 'Nemet', eben so auch wie die germanischen Deutschen ihre westlichen Nachbarn einst als 'Wenid' (und ähnlich) bezeichneten.
Wenn ich von 'Suraben' bzw. 'surabisch' schreibe, dann meine ich ein Volk, welches seine Ethnogenese zur selben Zeit bzw. etwas später hatte, wie die Wenden. Ihr Kristallisationskern besteht aber nur zu kleinen Teilen aus Veneter / Nemeter, sondern hauptsächlich germanische Sueben. Aus den Sueben wurden im süddeutschen die Schwaben, während aus den in ihrer Heimat Verbliebenen die Suraben wurden. Im Mittelalter sagte man noch Suraben, erst später dann Sorben. Sorbe ist also vor allem ein neuzeitlicher Begriff. Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde dieser dann auch auf eigentlich mindestens zwei verschiedene Völker der Lausitzer übertragen, welche wir heute noch als Sorben kennen. Ob Veneter und Nemeter ein und dasselbe oder nur ein mehr oder weniger nahe verwandtes Volk waren, darüber lässt sich nichts sagen, da es zu wenig Informationen über sie gibt. Beide lagen deutlich außerhalb der griechischen bzw. römischen Interessenzonen, daher wurde über sie auch nur wenig und wenn, nur beiläufig geschrieben.
Wie erwähnt war der Kristallisationskern der Suraben die germanischen Sueben. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches konnte die germanische Stammeselite nicht mehr ihre Herrschaft über ihre venetisch/nemetischen Vasallen (halbfreie Liten) halten. Ohne mit oder gegen die Römer zu kämpfen, was man seit Jahrhunderten tat, um sich dabei Ruhm und eine goldene Nase zu verdienen, hatte man keinen Daseinszweck mehr. Die germanische Bevölkerung hier, und nicht nur hier, welche nicht ausreichend organisiert war, sich in moderne Staatswesen umzuwandeln, 'kanakisierte'. Ähnlich heutigen Deutschen, die in den 'Hartz-IV-Hochburgen' leben und da eigentlich eine ethnische Minderheit unter der Gesamtheit der vielen anderen Ethnien sind. Diese 'kanakisierten' Deutschen, wir haben sie schon alle kennen gelernt, sind in Art und Benehmen, aber vor allem an der Aussprache, kaum von ausländischen Minderheiten zu unterscheiden, ja übertreffen sie sogar noch. In ihren Wortschatz dringen sogar Wörter der ausländischen Minderheiten mit ein. Die mittelalterliche Ethnogenese der Suraben erfolgte dann unter Einschluss einer größeren Gruppe Wenden, sowie einer kleineren, aber anschwellenden Anzahl an echten Slawen. Bei Suraben, wie auch den Wenden, gab es während der gesamten Ethnogenese einen zwar nicht sehr starken, aber doch stetigen Zufluss an 'echten Slawen'. Mit der Zeit hatte dies zur Folge, dass mehr und mehr echte slawische Wörter in die Sprache von Wenden und Suraben hineinflossen.
In den Jahren 500 bis 600 erfolgte in dieser Sichtweise die erste Phase der Ethnogenese von Wenden und Suraben, hier noch fast unter Ausschluss von Slawen. Ab etwa dem Jahre 600 stieg der slawische Anteil am Volkskörper durch Zuwanderung stetig an, bis er etwa im Jahre 800 begann zu Gunsten des slawischen Anteils zu kippen. Während des 10. Jahrhunderts erfolgte der Beginn der Auslöschung der Wenden und Suraben. Während ein Teil mehr oder weniger schnell im Deutschtum aufging, wurde ein größerer Teil zu Slawen, welche erst im Hoch- bzw. Spätmittelalter, gelegentlich noch später, doch noch im Deutschtum aufgingen.
Wenn ich von 'Slawen' oder 'slawisch' in Bezug auf hiesige Bevölkerungen rede, dann meine ich auch diese. Einzelne slawische Volksgruppen tauchten an der Saale wohl schon um das Jahr 550 auf, wohl etwa ab dem Jahre 800 wurden diese dann häufiger. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Ungarn die pannonische Tiefebene besetzten und sich deswegen slawische Gruppen welche zuvor unter lockerer karolingischer Herrschaft standen, eine solche weiterhin suchten und diese unter anderem, auch hier in Ostdeutschland fanden. Gelegentlich findet sich auch die Bezeichnung ‚altsorbisch‘, sie ist zu verstehen für ‚surabisch‘ wie auch früh-elbslawisch. Diese zugrunde liegenden Belege entstammen vor allem dem Hochmittelalter, einer Zeit in der Wenden und Suraben zu nicht unbeträchtlichen Teilen längst weitgehend slawisiert waren.
Im Buch wird bei den Erstnennungen oft das Hersfelder Zehntverzeichnis genannt, dieses zwar als solches eine spätere Abschrift, möglicherweise gar Fälschung des Hochmittelalters, aber die Datengrundlage, also die Ortsnamen sind real. Das Zehntverzeichnis, wäre es echt, würde mindestens ins Jahr 845 datieren, möglicherweise gar in die Epoche 750-780 verweisen. Die Art der Ortsnamen spricht nicht gegen eine solche zeitliche Einordnung. Wird als für einen Ort die Erstnennung im Hersfelder Zehntverzeichnis genannt, ist er zumindest wohl vor 845 gegründet worden.
Nicht viel anders ist es mit dem Versuch aus der Art wie die Giebel der Wohnhäuser der Höfe bzw. der Art der Höfe, aber auch wie die Straßen ganzer Ortschaften angelegt wurden. Natürlich gibt es klare Unterschiede dieser Dorfformen, in Brandenburg sind die geplanten Straßenangerdörfer am häufigsten, im germanischen Altsiedelgebiet eher Haufendörfer, entstanden aus mehreren Weilern. Runddörfer gibt es nur in besagten wendischen Siedlungsgürtel, darüber hinaus noch vor allem an der Nordsee, nicht aber bei den slawischen Polen, Tschechen oder Kroaten, und natürlich auch nicht bei den Russen. Die Art der Runddörfer an der Nordsee und denen der Wenden unterscheidet sich geringfügig, aber dennoch deutlich genug. Ein Rundling gilt als eine Sonderform dieser, welche es in dieser Form bei den Germanen an der Nordsee nicht gibt. Im Grunde sind die Rundlinge eine Mischung zwischen einer Wagenburg und einem Sackgassendorf. Diese Sackgassendörfer kommen vor allem bei den Germanen östlich von Weser und Werra im Frühmittelalter häufig vor. Ihr Vorkommen reicht aber auch deutlich über die Elbe-Saale-Linie, ja sogar über die Oder-Neiße-Linie hinaus. Zeitlich lassen sich diese Dörfer bis etwa das 4./5. Jahrhundert zurückverfolge. Sie dann aber in erster Linie Slawen zuzuordnen, dürfte mehr als nur unkorrekt sein. Rundlinge gibt es übrigens keine östlich der Weichsel, oder östlich der pannonischen Donau bzw. südlich der Save, damit scheidet der Rundling definitiv als slawisch aus. Er dürfte vielmehr typisch wendisch, also ursprünglich venetisch sein. Rundlinge wurden übrigens auch noch im Hochmittelalter angelegt und hier von wohl eher deutschen Siedlern, so wie einige der Rodedörfer der Querfurter Platte.
Ein Dorf welches vor über tausend Jahren entstand, ist in seiner Geschichte mehrfach abgebrannt und wieder neu aufgebaut. Der Aufbau erfolgte selten vollständig, sondern nach und nach, ganz wie das Dorf wieder aufgesiedelt wurde. Ein mittelalterliches Haus was niederbrannte, hinterließ keine Grundmauern, denn es war aus Fachwerk gebaut. Die Holzpfosten der Fachwerkwände und das Geflecht zwischen diesen war meist 'furztrocken', ging aber wegen einer Lehm- und Kalkabdeckung eher selten in Flamen auf. Anders die hölzernen Dachstühle und Decken, ein Funke genügte hier und alles brannte lichterloh. Wenn diese dann einstürzten, drückten sie die leichten Fachwerkwände nach außen, befreiten so Ständer und Geflecht vom Lehm, womit diese nun auch in Flamen aufgingen. Viel übrig blieb also nicht von so einem mittelalterlichen Haus, welches noch bis weit in die Neuzeit im Grundsatz nur wenig verändert gebaut wurde. Ein Haus, von welchem nach einem Brand wenig bis gar nichts übrig blieb, kann schlecht also Grundlage für einen ähnlichen Wiederaufbau sein. Man kann daher davon ausgehen, dass man das neue Haus völlig neu absteckte. Auch so manche Straße oder Gasse wurde dabei in ihrem Verlauf geändert. Gerade in vorfeudalen Zeiten, in welchen es noch keine festgeschriebenen feudalen Rechte und Pflichten gab, zumal wenn diese weniger an eine Person, sondern eher an eine Hofstelle geknüpft waren. Schon die benachbarte Hofstelle konnte anderen feudalen Rechten und Pflichten unterliegen. Daraus ergibt sich, wie wichtig ab dem hohen Mittelalter die Einhaltung von Grundstücksgrenzen war … aber auch, wie unwichtig im frühen Mittelalter und davor. Dennoch, auch nach vielfachen niederbrennen und wiederaufbauen, gewisse Grundstrukturen bleiben über Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende erhalten.
Kann man bei diesem Wissen ein Dorf, auf Grund der Anlage seiner Straßen und Höfe, einem Volk / Stamm oder einer bestimmten Siedlungsepoche zuordnen? Ja, allerdings mit vielen 'wenn und aber'. Ähnlich wie bei bestimmten Ortsnamensendungen, aber auch Ortsnamen, gibt es bestimmte Ortsformen, welche in bestimmten Gegenden eher charakteristisch sind und in anderen weniger. Hier kann man auf Basis mehrerer Anhaltspunkte vielleicht keine Feststellung, aber zumindest eine Annahme treffen. Ortsname, Ortsnamensendung, Hofart und Giebelstellung, Ortsanlage, Lage, historische Dokumente … können und müssen Basis einer gesamtheitlichen Theorie zur Anlage des Ortes und der Herkunft seiner Bewohner sein. Einzeln hingegen sind diese eher wertlos, möglicherweise gar irreführend.
Anhand von Erstnennungen und Ortsanlage versuche ich, bei jedem Ort zuerst seine Entstehung zu ergründen, dabei folge ich mal meinen Vorstellungen, mal denen Anderer. Da ich aber meine Ansicht nur eher selten als 'unumstößlich' und einzige Wahrheit ansehe, bin ich bestrebt von jeder mir bekannten Theorie hier zu berichten. Es ist klar, dass dies zu mehreren sich gegenseitig widersprechenden Aussagen in einem Absatz führen kann. Ich möchte aber durch die Nennung anderer Sichtweisen unterstreichen, dass die meinige nicht die einzige und absolute Wahrheit ist, sondern nur eine Mögliche von vielen.
Dies führt mich wieder zu meiner Anfangsfrage, wenn dies also so unauflösbar ist, warum versuche ich es dann? Weil es interessant ist und wenn auch manche Sichtweise historisch nicht korrekt ist, mag dies bedauerlich sein, ist aber letztlich, was Geschichte betrifft, gang und gäbe. Geschichte ist weniger ein Bericht von real abgelaufenen Fakten, sondern eher eine Hypothese wie einige Fakten mittels zahlreicher Annahmen zu einem Gesamtbild zusammen gebaut werden können. Das hört sich freilich wenig wissenschaftlich an und in der Mathematik oder Physik könnte man niemals so argumentieren, aber Geschichte ist eben keine Mathematik oder Physik. Wir sehen es schon heute, wie jeder die Gegenwart anders wahrnimmt, da Geschichte durch Sieger und Meinungsmacher geschrieben wird. Was heute noch passiert, war früher nicht anders. Geschichte kann niemals objektiv sein, da der Mensch nicht objektiv sein kann. Geschichte kann damit auch niemals wahr sein, weil dies eben Objektivität verlangen würde. Geschichte ist immer ein Produkt aus vielen Teilen – aus Überlieferungen, welche jeweils unterschiedlichen moralischen und ethischen Kriterien unterliegen.
Nun will ich aber auch nicht weiter herum reden und mit den Ortschroniken beginnen. Die Orte möchte ich dabei in einer Reihenfolge beschreiben, als wären sie auf einer Perlenkette aufgefädelt. Den Anfang mache ich mit Langeneichstädt, einem Ort am oberen Ende des Stöbnitztales. Von Langeneichstädt arbeite ich mich dann der Reihe nach der Schwarzeiche hinunter bis Knapendorf, die Laucha wieder hinauf bis Schafstädt, dann die Stöbnitz hinab nach Mücheln, dann das gesamte Geiseltal hinunter, um über dem Tal der Klia und der Leiha, am Ende Branderoda zu erreichen. Diese Reihenfolge ist freilich willkürlich, andere Varianten wären denkbar, sie ist aber bei mir faktisch von alleine entstanden, entsprechend dem Forschungsfortschritt meiner Ortsfamilienbücher, von denen Niedereichstädt eben das erste, Wünsch das zweite war.
Die Ortschroniken
Langeneichstädt
Langeneichstädt liegt westlich von Merseburg im Tal der Stöbnitz, welche hier eigentlich korrekter Weise Schwarzeiche heißt (nicht zu verwechseln mit der Schwarzeiche, die zwischen Niedereichstädt und Oberwünsch entspringt). Es befindet sich auf einer Höhe von 165 m über Normalnull. Niedereichstädt ist der östliche Teil, Obereichstädt der westliche Teil des Ortes. Hydrografisch liegt Langeneichstädt am oberen Ende des Geiseltales. Topografisch scheint der Ort aber an einer Fortsetzung des östlicheren Schwarzeichetales zu liegen
Eine echte topografische Trennung beider Orte gab es niemals, nur ein schmaler Saum schied sie voneinander. Interessant ist, dass exakt von diesem Saum ein Weg zur alten Warte führt. Beide Orte scheinen unabhängige Gründungen zu sein, wahrscheinlich infolge hier wechselnder Grenzen zwischen dem Bistum Merseburg und dem von Halberstadt. Bei mittelalterlichen Streitigkeiten mit anderen Gemeinden oder mit Adligen traten Ober- und Niedereichstädt aber oft gemeinsam auf, zumeist bereits unter dem Namen Langeneichstädt. Erwähnt wird noch ein weiterer Ortsteil: Mark- bzw. Markteichtstädt, welcher zumindest in der Neuzeit, faktisch ein Ortsteil von Niedereichstädt war, aber einst eine feudalrechtlich eigenständige Siedlung.
Ortsgeschichte
Im Bereich der heutigen katholischen Kirche fand man Spuren einer bronzezeitlichen Siedlung. Die Siedlung selbst wurde zwar später wieder aufgegeben und ist somit kein früher Zeuge für eine frühe Gründung des späteren (Langen-)Eichstädt, belegt aber gut die frühe Besiedelung dieses Gebietes.
Langeneichstädt wird erstmalig im Jahre im Hersfelder Zehntverzeichnis als 'Ehstat' erwähnt. In diesem wichtigen Dokument ist von besonderer Bedeutung, dass eine Zugehörigkeit zu Querfurt (899 'Curnfurdeburg', 979 'Cornfurdeburg') zu dieser Zeit nicht bestätigt werden kann. Dies würde man aber vermuten dürfen, wäre der Ort eine fränkische bzw. deutsche Gründung.
Abb. 2.: Erstnennung des Ortes im Hersfelder Zehntverzeichnis
Genauere Betrachtungen gehen davon aus, dass das Thüringer Teilvolk der Angeln den Ort gründete, als es sich, aus dem heutigen Schleswig-Holstein kommend, hier niederließ. Auch wenn es hierzu keine Aufzeichnungen gibt, dürfte des so etwa im 5./6. Jahrhundert gewesen sein. Darauf schließen kann man deswegen, da die hiesigen Angeln noch immer Verbindung zu den nach Britannien abgewanderten Angeln hatten. Sie konnten sogar einige von diesen dazu bewegen wieder aufs Festland zu kommen, um sich an der Unstrut anzusiedeln. Im Hersfelder Zehntverzeichnis wird Eichstädt nur einmal erwähnt. Damit ist unklar, ob damals bereits die Trennung zwischen Ober- und Niedereichstädt vorhanden war, und - wenn ja - welcher Ort der ältere ist bzw. ob sie beide auch schon damals als Eichstädt bezeichnet wurden. Es ist aber anzunehmen, dass der OrtsteilNiedereichstädt die ältere Gründung ist, da sich dort zuerst eine Kirche befand.
Es gibt die Theorie einiger moderner Ortsnamensforscher, dass Attribute von Ortsnamen wie Ober- / Nieder-, Groß- / Klein- usw., deren Attribute Ober- bzw. Groß- für deutsche Gründungen steht, während die anderen für eher nicht-deutsche, in diesem Sinne vor allem slawische stehen. Wenn überhaupt wären dies dann hier aber weniger slawische Gründungen, sondern wohl bestenfalls wendische bzw. surabische, oder zuweilen gar germanische. Wobei bei letzteren auch immer zu unterscheiden wäre, was man allerdings meist nicht kann, ob der Ort nun von Hermunduren, Warnen, Angeln, Sueben oder auch immer gegründet wurde. Das Ober- bzw. Nieder- steht hier auch nicht für das Alter einer Dorfanlage, sondern so wie auch bei vielen anderen Dörfern der Gegend, für den topographisch höher liegenden Ortsteil. Dies mag zwar nicht immer der Fall sein, ist es aber zumeist. Derlei konnte man schon früher leicht an der Flussrichtung eines Baches, auch ohne Vermessung, feststellen. Wir sehen dies an vielen Beispielen der Umgebung.
Abb. 3.: Ortsanlage 1872
Die Straßenanlage beider Orte ist vergleichbar und dürfte in ihren Hauptteilen aus der spätthüringischen Epoche stammen, wobei die Gehöfte sich zumeist nach fränkischer Art ausrichteten. Der Ursprung des Dorfes, könnten mehrere alte germanischer Weiler rund um den Kirchberg sein, in dessen Mittelpunkt später dann die Niedereichstädter Kirche gebaut wurde, denn um diese sind die Höfe noch heute besonders kleinteilig. Der Kern Obereichstädts könnte das Oval der Gasse Sixtusburg sein, dieses ist trotz ovaler Form wohl eher kein Rundling, sondern wohl zwei benachbarte Weiler oder ein Gassendorf. An beide Ortskerne schlossen sich noch zu Beginn des frühen Mittelalters weitere Weiler an, dazu auch noch Gassen- und Platzdörfer. Zwischen Ober- und Niedereichstädt befand sich damals ein grüner Saum, welcher mit der Zeit immer schmaler wurde und bis auf einen kleinen Rest bereits bis zum Spätmittelalter verschwunden war. Wenn nicht erst im Hochmittelalter, wurden diese Dörfer schon in fränkischer Zeit mittels neu gegründeter langgestreckter Straßendörfer zu zwei Dörfern bzw. einem Dorf vereinigt. Dafür spricht jedenfalls der Fakt, dass der Ort im Hersfelder Zehntverzeichnis nur einmal genannt wurde. Dagegen spricht aber die unterschiedliche Zugehörigkeit beider Orte, welche so fundamentiert war, dass sie bis in die späte Neuzeit reichte. Unterschiedliche lehnsrechtliche Ansprüche haben das Dorf geteilt, diese könnten aber genauso aus der frühen deutschen Zeit stammen, wie auch aus der späten fränkisch-thüringischen.
Im Jahre 1053 wird der Ort als 'Achistide' erwähnt, 1197 als 'Ekstede' bzw. 1205 und 1275 als 'Ekenstede'. Es gab im 13. Jahrhundert ein regional bedeutendes Adelsgeschlecht in Ekenstede. 1320 wird der Ort erstmals als 'Eychstede' bezeichnet, 1370 dann auch zum ersten Mal als Langeneichstädt. Die Orte Obereichstädt, Niedereichstädt, Mark(t)eichstädt werden 1467 erstmals getrennt urkundlich erwähnt. Nach außen hin, z.B. bei Grenzstreitigkeiten mit Nachbargemeinden, traten die Gemeinden gemeinschaftlich auf, dies trotz unterschiedlicher obrigkeitlicher Zuordnungen. Da die Kirche in Niedereichstädt definitiv die ältere ist, dürfte das ursprüngliche 'Achistide' mit Niedereichstädt gleichzusetzen sein.
Auf der Ebene nördlich von Langeneichstädt fand um 575 möglicherweise eine Schlacht zwischen hier ehemals zeitweise ansässigen Sachsen und einem Stammesgemisch von dann hier Ansässigen statt. Als 531 die Region sächsisch wurde, siedelten sich hier auch Sachsen an, welche aber bald darauf nach Italien zogen. Es gefiel ihnen dort aber nicht, weswegen sie nach wenigen Jahrzehnten zurückkamen und nun hier Land forderten, welches sie glaubten einst besessen zu haben. Sie sahen sich im Recht und waren es auch, denn bei den Germanen gab man seinen Besitz nicht auf, wenn man ihn verließ. Da dieses Besitzrecht vererbbar war, verlor man es auch Jahrhunderte nach dem Wegzug nicht und konnte nun seine Rechte einfordern. Die Angeln und andere hier ansässige Gruppen, sicherlich dabei selbst auch einige Sachsen, wussten dies und waren bereit den aus Italien heimkehrenden Sachsen ein Drittel allen Landes abzugeben. Aber die Sachsen wollten alles haben, so kam es zu Schlacht, welche die Sachsen verloren. Das Land war aber dennoch seit 531 nominell zu Sachsen gehörend und blieb es prinzipiell auch noch für einige Zeit. Es siedelten hier wohl seit gut vier Jahrzehnten bereits Sachsen, aber wohl erst Jahrzehnte nach der Schlacht, war in der Region die nominelle sächsische Herrschaft auch etabliert. Nicht für Lange, im 8. Jahrhundert verdrängten dann die Franken die Sachsen auch hier.
Mitte des 11. Jahrhunderts vermacht Erzbischof Adalbert zu Bremen, ein Angehöriger der Wettiner, dem Benediktinerkloster zu Gosek, das Dorf 'Achistede', das heutige Eichstädt. Noch im 15. Jahrhundert hatte das Kloster hier Besitz am Getreidezehnt und Kirchenpatronat. In den Jahren vor 1378 muss der Ort dann unter die Herrschaft der Edlen von Querfurt geraten sein, denen man nun den Zins schuldete. 1541 zahlte man den Zins an das Kloster Sittichenbach. Nicht alles Land gehörte in dieser Zeit Ortsansässigen, vor allem durch Erbschaften geriet immer wieder Land an Auswärtige. So besaß 1254 die Pfarrkirche von Schraplau Land in Eichstädt und 1589 hatte das Kloster Reinsdorf bei Nebra viel Besitz im Ort und betrieb hier sogar eine eigene Gerichtsstätte. 1496 wird der Herr von Watzdorf in Obereichstädt mit einer Hufe Landes belehnt.
Ende des 11. Jahrhunderts residieren in Eichstädt die Edelherren von Eichstedt. Der erste war Eckard von Eichstedt, ein Sohn Timos von Schraplau. Man hat vermutet, dass deren Burg einst auf einem nördlich der Niedereichstädter Kirche St. Wenzeslaus befindlichen Hügel gelegen haben könnte.
Im 17. Jahrhundert hatte das Amt Freyburg fünf Landgerichtsstühle, von denen einer Langeneichstädt war. Da sich die Langeneichstädter aber weigerten das Henkergeld an das Amt zu zahlen, mussten sie eine eigene Stätte zur Vollstreckung der Todesstrafe. Die nordöstlich von Obereichstädt gelegene Flur 'Der Galgen' erinnert daran. Auch die westlich von Obereichstädt gelegene Flur 'Die Mordgrube' kann wohl in diesen Bereich verortet werden.
1465 entstand die Sage vom Römischen Rain durch Conrad Bornhake, welche über die Entstehung der Kirche in Obereichstädt berichtet. 1539 erfolgte die Einführung der Reformation, Gregorius Pfeiffer ist anschließend der erste evangelische Pfarrer im Ort. Erstmalig wurde 1751 in den Kirchenbüchern eine Scheidung erwähnt.
Im Jahre 1753 wurden Mark(t)eichstädt und Niedereichstädt vereinigt. In den Kirchenbüchern von Niedereichstädt wurde in dieser Zeit eine Ortsbezeichnung als 'aufm Markt' genannt. Es ist anzunehmen, dass damit Mark(t)eichstädt gemeint war, da Mark(t)eichstädt keine eigene Kirche hatte. Um 1800 wurde wieder kurzzeitig ein Ortsteil Mark(t)eichstädt gebildet. 1937 wurden Ober- und Niedereichstädt zu Langeneichstädt vereinigt.
Die Kirchen von Langeneichstädt
Die Kirche St. Wenzel in Niedereichstädt
Die Kirche von Niedereichstädt, geweiht auf den Namen St. Wenzel, ist die wohl älteste Kirche in Langeneichstädt. Eine Tafel an der Rückseite des Altars gibt Auskunft über den Bau einer ersten Kirche: 'Anno Christi 700 ist dieser Altar gesetzt…'. Wenn dies zutreffend ist, dürfte es einer der ältesten Kirchen der Gegend sein. Allerdings ist diese Tafel erst in neuerer Zeit angefertigt worden. In einer umkämpften Gegend wie dieser gelegen, wird auch der früheste Kirchenbau bereits eine recht massive, wohl auch schon aus Stein gebaute, gewesen sein. Wobei freilich ein allererster hölzerner Bau anzunehmen ist, welcher bereits nach wenigen Jahrzehnten durch einen Steinbau ersetzt wurde.
Das jetzige Gotteshaus wurde in seiner Grundsubstanz im 11. Jahrhundert erbaut, also noch im romanischen Stil. Aus dieser Zeit stammt noch der breite massige Westturm, der mit dem gleich breiten Kirchenschiff ein Rechteck von 21,80 m x 9,51 m bildet, und Teile der Nordmauer. Die Entstehungszeit ist an den Rundbogenfenstern mit Schlussstein in Turm, Nordmauer und Glockenstube deutlich auszumachen. Gerade in den romanischen Bauteilen zeigt sich noch überdeutlich, ein sehr wehrhafter Charakter der Kirche, bot diese doch den Einwohnern Schutz vor allem vor Raubzügen von Raubrittern und allerlei anderem Kriegsvolk. Viele Kirchen dieser Gegend zeigen ein ähnlich wehrhaftes Aussehen, nicht wenige dieser Kirchen gleichen sich geradezu im Aussehen, dies zeigt wiederum, wie bedroht diese Region im Hochmittelalter war.
Der um 1350 erbaute Chor, ein Rechteck von 5,90 m x 6,65 m mit 3/8 Schluss und Walmdach, zeigt Elemente gotischer Bauart, wirkt aber sonst noch sehr romanisch. Eine südliche Spitzbogentür ist eine spätgotische Arbeit, und gilt als kulturhistorisch besonders interessant und reichhaltig gestaltet. Die drei Spitzbogenfenster entstammen derselben Zeit, sind aber deutlich bescheidener im Stil.
Die Kirchenbücher berichten, dass der 30-jährige Krieg, der in der Gegend in seinem letzten Drittel stark tobte, an der Kirche nur eher leichte Schäden hinterließ, die alsbald auch behoben wurden.
Abb. 4.: Grabstein Kirche Niedereichstädt
Die Steinkanzel entstammt dem Jahre 1601, der barocke Altar 1771. Die erhaltenen gotischen Altarfiguren Maria, Katherina und Barbara sind thüringisch-sächsische Schnitzereien aus dem 14. Jahrhundert. Die Orgel wurde 1924 durch Orgelbaumeister Wilhelm Rühlmann aus Zörbig gebaut und hat 21 klingende Stimmen mit 1233 Pfeifen.
Die Kirche St. Nikolai in Obereichstädt
Die Obereichstädter Kirche St. Nikolai, nördlich der Friedensstraße gelegen, wurde um 1100 erbaut. Damit ist sie nicht viel jünger als die in Niedereichstädt, aber anders als St. Wenzel, dürfte St. Nicolai nie einen Vorgängerbau besessen haben. Auch zu einer möglichen Kapelle geben die Überlieferungen nichts her.
Turm und Kirchenschiff bilden ein Rechteck von 24,10 m x 6 m . Kirchenschiff und die Grundlage des Turmes stammen aus romanischer Epoche, wie es noch heute an einem kleinen romanischen Rundfenster in der Südmauer zu erkennen ist. Im 14. Jahrhundert muss die Kirche dann einen umfangreichen Umbau erfahren haben.
Eine Tafel an der Südseite des Turmes verweist auf eine weitere grundlegende Veränderung der Kirche im Jahre 1665. In dieser Zeit wurden viele Kirchen der Gegend erneuert, da viele Kirchen durch den Dreißigjährigen Krieg direkt bzw. indirekt in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Es dauerte dann Jahrzehnte bis man sich Kirchensanierungen bzw. -neubauten leisten konnten. Der damalige Turm muss dabei sehr stark verfallen gewesen sein, denn er wurde auf älteren Grundmauern völlig neu errichtet. 1847 wurde der Turm erhöht und die noch heute vorhandene Turmspitze aufgesetzt.
Die Figuren des Altars stellen Maria, links Agnes und Dorothea, rechts Barbara und Margaretha, mit den 12 Aposteln dar, ein anmutiges Werk aus der blühenden Zeit der Holzschnitzerei. Besonders die Frauen des Altars gelten künstlerisch mit besonderer Ausstrahlung und Liebreiz gestaltet. Die Orgel mit einem besonderen 'Harmonium-Register' stammt aus dem Jahre 1892, erbaut wurde sie von Wilhelm Heerwagen aus Klosterhäseler.
Abb. 5.: Grabstein Kirche Obereichstädt
Die Kirche St. Bruno von Querfurt
Am 24. April 1955 wurde auf einem Areal südwestlich des Bahnhofs Langeneichstädt der Grundstein für die katholische Kirche Langeneichstädts gelegt. Am 20. November 1955 wurde sie durch den magdeburger Weihbischof Rintelen geweiht. Patron der neuen katholischen Kirche wurde der Heilige Bruno von Querfurt (975-1009). Nach über 400 Jahren hatten die Katholiken hier nun wieder ein Gotteshaus. 1958 erhielt die Kirche drei Glocken aus Stahlguss. 1962 wurde das Grundstück um die Kirche mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt und erhielt einen parkähnlichen Charakter.
Der Innenraum der Kirche zeichnet sich durch große Helligkeit aus, denn die Fenster haben keine Farbgebung. Die gewölbte Holzdecke gibt dem Raum Höhe und Weite. Besondere Beachtung findet die Pieta, eine Darstellung der Gottesmutter mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß (Dauerleihgabe des Ursulinenklosters Erfurt). Altarkreuz, Tabernakel, Osterleuchter und Ambo sind aus der Werkstatt von Friedrich Schötschel und stammen aus der Kapelle des Provinzialmutterhauses Ost der Marienschwestern in Berlin.
Historische Denkmäler
Die Borke und andere Burgstandorte
Wenig bekannt, außer vielleicht unter den Eichstädtern, sind die 'Borke' in Niedereichstädt und der Borkengrund am und im Dorf. Borke ist möglicherweise ein Hinweis auf eine einst hier stehende Burg, keine steinerne mit Mauern und Türmen, eher eine hölzerne Burg mit befestigen Haus.
Gewiss hat der Borkengrund, der westlich vom Dorf seinen Anfang nimmt, sich durch das Dorf zieht und südwärts weiterläuft, zu einer Burg geführt bzw. als Flur gehört und bildet möglicherweise den Ursprung des Ortes.
Westlich vom Dorf beginnt der Borkengrund, welcher in südwestlicher Richtung verläuft. Dort befindet sich eine spornartig aus der Hochfläche der Querfurter Platte nach Südosten hervorragende 15 m hohe kegelförmige Bergkuppe. Selbige ist offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs, sondern wurde vor einigen tausend Jahren planvoll und künstlich angelegt, man kann dies an den Einschnitten aus den Schichtungen des Hügels gut erkennen. Ursprünglich war der Hügel wohl ein bronzezeitlicher Grabhügel oder eine heidnische Wallburg, auf der in vorchristlicher Zeit einer Sonnengöttin gehuldigt wurde, vielleicht auch noch anderen heidnischen Gottheiten. Im frühen 8. Jahrhundert entstand hier wohl eine kleine Burg (zu klein um die Smeringaburg zu sein) welche aber wohl keinen langen Bestand hatte. Der Hügel ist stark durchfurcht und vielfach unterhöhlt, was eine Besteigung erschwert. Gefunden wurden in ihm einzelne Scherben, sowie ein Napf, welche beide chronologisch als 'mittelslawisch' eingeordnet werden, was den Verdacht erweckt die kleine Burg auf der Borke war eine wendische Anlage. Das Erdreich für den Grab-/Burghügel wurde einst vor Jahrtausenden, im Bereich der heutigen katholischen Kirche abgetragen, wo man Reste einer bronzezeitlichen Siedlung fand.
Abb. 6.: Niedereichstädt vom Kirchberg aus
Noch im hohen Mittelalter hat in Langeneichstädt wohl eine Burg gestanden, welche aber nicht mit der Warte nördlich des Ortes zu verwechseln ist oder mit der Borke, sondern mitten im Ort sich befand. Nordöstlich der Niedereichstädter Kirche, inmitten des heutigen Friedhofes befinden die schwachen Reste eines einstigen Burghügels. Vor einem Jahrhundert war der Hügel aber noch besser erkennbar, heute sind nur noch wenige Mauerreste vorhanden. Die Flur nördlich dessen, heißt 'Hinter der Burg'. An der Kirche selbst ist ein menschliches Gesichtsfresko eingemauert, es wird angenommen, dass es sich dabei um den einstigen Burgherren gehandelt hat. Möglicherweise befand sich das Konterfei einst an der Burg und wurde erst später in den Kirchenchor eingelassen. Oder aber es wurde schon bei dessen Bau von mit eingebaut, denn auch bei anderen Kirchen in der Nähe einer Burg, gibt es solche Köpfe.
Auch westlich von Obereichstädt in der Flur 'Krutschke' wird eine einstige Burg vermutet. Mit der 'Smeringaburch' dürfte aber keiner der hier genannten Burgstandorte identisch gewesen sein, da diese wohl erst späten 8. Jahrhundert entstand und wohl nur ein paar Jahrzehnte stand.
Eichstädter Warte
Nördlich von Eichstädt befindet sich die Eichstädter Warte, ein mittelalterlicher Wachturm. Er steht gute 100 m oberhalb von Merseburg und ermöglicht somit einen guten Fernblick. Der runde Turm hat einen Umfang von 23 m am Fuße und eine Höhe von 15,7 m, sowie einen Durchmesser von 7,8 m . Der einzige Zugang liegt etwa 8 m über dem Niveau der Umgebung. Die verwendeten Steine sind vorwiegend grob behauener Kalkstein und ein wenig Sandstein. Es wird angenommen, dass der Bau einer Warte an dieser Stelle erstmals um 950 unter Heinrich I. erfolgte. Er dürfte als Glied einer Reihe von Wehrbauten gegen die Einfälle der Ungarn errichtet worden sein. Dieser Turm muss aber mit der Zeit verfallen oder zerstört worden sein, denn aufgrund der Mauertechnik wird die Entstehung der Warte in ihrer heutigen Form, ins 14. oder 15. Jahrhundert datiert. Neuere dendrochronologische Untersuchungen entnommener Holzbalkenreste setzen das Baujahr um 1483 an.
Abb. 7.: Eichstädter Warte
Die in Urkunden gelegentlich genannte 'Smeringaburch' wird oftmals im Raum Langeneichstädt vermutet, jedenfalls irgendwo zwischen Großgräfendorf und Schmirma. Aber unmittelbar in oder um Langeneichstädt dürfte die Smeringaburg jedenfalls nicht gestanden haben. Zwar wäre die Lage dafür ideal, aber Ausgrabungen hätten diese längst belegt, da sie erheblich größer hätte sein müssen, als nur die Warte. Hingegen gibt es in alten Flurkarten westlich von Obereichstädt die Flur 'Burggrund'. Möglich das hier in Richtung Göhrendorf einst die Smeringaburg stand.
Die Eichstädter Warte ist gut rekonstruiert und heute eine Station auf der touristischen Straße 'Himmelswege'. Leider ist die Warte verschlossen, weshalb man vom Turm nicht die schöne Aussicht genießen kann.
Das Steinzeitgrab
Abb. 8.: Statue der Dolmengöttin
Auf der Anhöhe, nur wenige Meter neben der Eichstädter Warte, wurde 1987 bei Feldarbeiten zufällig ein jungsteinzeitliches Steinkammergrab entdeckt. Im Rahmen der archäologischen Untersuchungen wurden Sandstein- und Muschelkalkplatten freigelegt und das Grab faktisch wieder hergestellt.
Das Steingrab (5,3 m lang, 1,9 m breit und 1,7 m hoch) wird auf 3.600 bis 2.700 v. u. Z. datiert und ist somit der Salzmünder Kultur bzw. der Baalberger Kultur zuzurechnen. Als Deckstein der Grabkammer wurde eine 1,76 m große Menhirstatue entdeckt. Die Statue zeigt die vereinfachte Darstellung einer Dolmengöttin (weibliche Gottheit) und ein Axtmotiv als Statussymbol des Mannes. Durch die Berührung der Dolmengöttin erbaten die steinzeitlichen Menschen Fruchtbarkeit für Mensch, Tier und Feldfrüchte. Daher weist die Darstellung Abtragungsspuren auf. Im Fußboden des Grabes - bestehend aus mehreren Schichten von Kalksteinplatten - fanden die Archäologen Schmuckstücke aus Tierzähnen, Kupfer, Knochen und Bernstein. Eine Replik des Menhirs wurde zwischen dem Wachturm und der Grabkammer errichtet. Das Original wird im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gezeigt.
Die Eichstädter Warte ist bis heute eng mit den traditionellen Pfingstbräuchen in Langeneichstädt verbunden. Jedes Jahr zu Pfingsten erfolgt das 'Maienstecken' auf der Warte. Sehr gut möglich, dass hier Jahrtausende Jahre alte heidnische Traditionen, übertüncht mit ein paar christlichen Bräuchen, noch immer gepflegt werden. Diese Traditionen könnte ein Hinweis darauf sein, dass eine ebensolche uralte und ununterbrochene Besiedlungstradition des Dorfes vorhanden sein könnte. Dass aber die Warte hier und nicht wo anders gebaut wurde, dürfte er ein Zufall gewesen sein bzw. den topographischen Verhältnissen geschuldet sein.
Abb. 9.: Grabkammer
Der Grabhügel bei Niedereichstädt
An der von Niedereichstädt nach Mücheln führenden Straße, unweit von Niedereichstädt auf dem Plateau liegt oder besser gesagt lag ein großer Erdtumulus, ein Grabhügel aus Erde. Benannt war dieser nach einer in der Nähe befindlichen wüsten Mark als der Zeckerhügel oder wegen der zahlreichen ihn durchziehenden Kaninchenbaue als Kaninchen-Hügel.
Als ein Major Scheppe im Jahre 1864 den Grabhügel öffnete, waren die Ränder schon zum großen Teil entfernt, sodass nur noch der 14 Fuß hohe zentrale Teil übrig war. In diesem fand Scheppe eine große Steinkiste von über 10 Fuß Länge, 4 Fuß Breite und 4 Fuß Höhe im Lichten, ausschließlich der die Südwand abschließenden Vorbauten. Die Kiste war von N nach S ausgerichtet und im Süden durch mehrere Steinplatten und dazwischen aufgeschichtete Steinlagen sowie eine Holzbohle verschlossen. Im Innern lag in der Mitte auf einer Holzbohle ein kleines weibliches Skelett mit dem Kopfe nach Süden. Zu beiden Seiten dieses Skelettes lag je ein großes männliches Skelett mit dem Kopfe nach Norden. Die angegebene Lage wurde nur nach den Schädeln bestimmt, denn die übrigen Skelettteile befanden sich in Unordnung bzw. waren durch die Kaninchen verschleppt worden. Neben jedem Schädel befand sich eine Kugelamphore, ferner wurden gefunden ein schwarzes und ein weißes Feuersteinbeil, eine Holzkeule (Beilschaft?) ein Feuersteinmesser, Fragmente eines Holzschildes, eine Menge durchbohrte Tierzähne, ein Eberhauer, einige Bernsteinperlen und eine kleine Spirale aus Kupfer oder Bronze. Von den beiden in Form und Ornament einander gleichen Kugelamphoren, gelangte die eine an die altertumsforschende Gesellschaft zu Halle, die andere behielt Scheppe. Das dritte Gefäß, welches in der Form den beiden andern glich, aber 'gebogene Linien' in den Verzierungen aufwies und sich beim weiblichen Skelett fand, blieb zerbrochen in Eichstädt zurück. Ein weißes Feuersteinbeil erhielt ein Oberstleutnant von Stahr, die übrigen Funde behielt zunächst Scheppe, dessen Funde später an das Römisch-Germanische Museum in Mainz übergingen.
Der Walachenstein
Beim Walachenstein handelt es sich um einen unscheinbaren, 72 cm hohen, 13 cm dicken und am oberen Ende 21 cm breiten Steinkreuzstumpf aus Sandstein,. Dieser steht auf dem Kirschberg in Obereichstädt oberhalb des Artenschutzturmes, an einem schmalen Weg zwischen den Gärten, wie ein Grenzstein.
Dieser Stein diente in zweiter Nutzung als Grabmal für den Angehörigen eines Volks - stammes aus dem Süden Rumäniens, einen Walachen, der nach eigenem Wunsche am 17. Mai 1707 nach christlicher Sitte auf dem Kirschberg bestattet worden ist. Das Steinkreuz selbst ist in die Kategorie der Sühnekreuze des frühen Mittelalters einzureihen.
Die Geschichtsschreibung bringt den Walachen(-Obersten) in Zusammenhang mit einem Regiment Walachen des Schwedenkönigs Karl XII., das vor dem Frieden von Altranstedt 1706 ein Jahr lang in Langeneichstädt einquartiert war und dem Doppeldorf 30.000 Taler kostete.
Die Bockwindmühle
Die hier stehende Bockwindmühle stand ursprünglich im Harz. 1836 wurde sie mit Pferdefuhrwerken nach Langeneichstädt gebracht und am Barnstädter Weg wieder aufgebaut. Die ersten hiesigen Mühlenbesitzer waren Johann Leberecht Henze und sein Sohn Ferdinand. Ab 1888 wurde ein Louis Franz Keutel als Mühlenbesitzer geführt. 1924 übergab er die Mühle an seinen Sohn Otto, der sie 1954 an Rudolf Dreßler verpachtete. Letzterer betrieb die Mühle noch bis 1959 und sorgte dann anschließend mit großem Engagement dafür, dass sie für die Nachwelt erhalten blieb. Denn schon damals gab es in Deutschland kaum noch solche, obwohl es sie nur wenige Jahrzehnte überall gab.
1993 wurde die Außenhaut erneuert, 2006 das Dach mit neuen Schindeln gedeckt und seit Dezember 2007 ist sie wieder mit Flügeln (Attrappen) zu sehen. Die Inneneinrichtung ist vollständig erhalten
Archäologie
Auf den Feldern des Bauern Hindorf fand man in den 1920 Jahren ein germanisches Körpergrab, in welchen Keramikscherben und Alltagsgegenstände aufgefunden. Darüber hinaus fand man auch ein Urnengrab, welches wohl deutlich älter noch war und der Eisenzeit entstammte.
Wüstungen bei Langeneichstädt
Droyßig
In der Umgebung von Langeneichstädt befinden sich mehrere Wüstungen auf dem weiten Feld zwischen Oechlitz und Schaffstädt. Nördlich bis nordöstlich von Niedereichstädt lag 'Drößig' bzw 'Droyßig', eine Langeneichstädter Flur führte noch in jüngster Zeit den Namen 'Dresig'. Auch als Droschwitz bzw. Drosewitz erscheint der Ort in Urkunden. Den Namen könnte der Ort von den 30 Häusern oder Hufen haben, was aber unwahrscheinlich ist, denn so viele Hufen oder Häuser hat hier kaum ein Dorf. Die Kirche von Schraplau hatte in Droyßig 2,5 Mansen – wobei ein Mansen, einen Hof mit Acker darstellt. Die Bezeichnung am Schraplauer Wege soll davon zeugen. Eine andere Erklärung führt den Namen auf den surabischen Personennamen 'Trysk' zurück, was in etwa 'Schelm' bedeutet.
Zwanzig
Eine Feldkapelle, St. Maria virgo lag in dem wüsten Droyßig / Drosewitz (oder Droschwitz), die andere zu St. Georg in dem wüsten Zanzig (Zwanzig). Diese beiden Kapellen wurden mit ihren Einnahmen zu einem Spital geschlagen, um Hausarmen zu helfen.
Schemlitz
Weitere Wüstungen waren 'Unter- bzw. Ober Schem(p)litz' (auch als Schomlitz), gelegen südlich von Niedereichstädt. Beides können nur eher kleine Dörfer, kaum mehr als Weiler sein, da deren Fluren nur recht klein waren. Dem Namen nach dürften es slawische Ansiedlungen gewesen sein.
Wolkau Am nördlichsten Ende der Niedereichstädter Flur, kurz bevor, die von Schafstädt beginnt, lag einst Wolkau. Wolkau wurde im Hersfelder Zehntverzeichnis als einziger dieser wüsten Orte aufgeführt, und zwar als 'Uluchistedtin'. Dass der Ort im Zehntverzeichnis die Endung '-stedt' hat und eben nicht auf '-au' endet, zeigt, dass er ebenfalls eine spätthüringische Gründung ist und keine slawische. Das Bestimmungswort soll dabei vom Personennamen 'Wolf' abgeleitet worden sein.
Abb. 10: Erstnennung des Ortes im Hersfelder Zehntverzeichnis