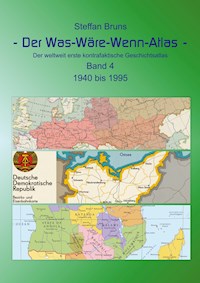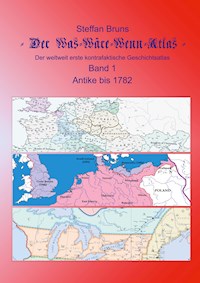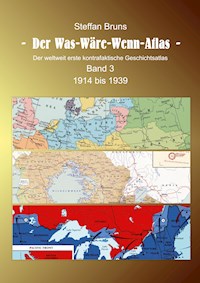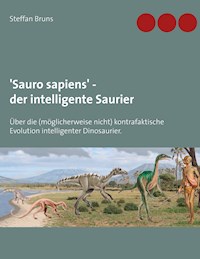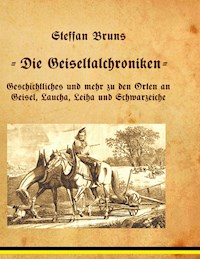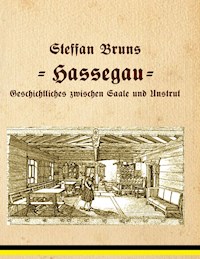
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das hier vorliegende Buch ist eigentlich geradezu aus Versehen entstanden. Für die Region habe ich bereits eine Reihe an Ortschroniken inklusive Ortsfamilienbücher (OFB) verfasst, weitere sind in Vorbereitung bzw. Planung. Um diese OFB mit lokal- und regionalgeschichtlichen Daten ausschmücken zu können, suchte ich nach einem Geschichtsbuch für die Region. Fand aber keines und begann daher selbst zu recherchieren ... irgendwie waren bald ein paar hundert Seiten zusammen. Die brauchten nur noch in einem neuen Zusammenhang gebracht zu werden, mit weiteren Informationen ergänzt und abgerundet und fertig war das Buch, besser gesagt, zwei zusammenhängende Bücher. Na ja, nicht ganz, kaum war es fast fertig, kam ich mehr und mehr in Konflikt mit der allgemeinen Auffassung eines umfassenden Bevölkerungsaustausches östlich der Elbe-Saale-Linie zu Beginn des Mittelalters, der auch starke Auswirkungen auf den Saale-Unstrut-Raum hatte. Nachdem ich mich in dieser Richtung tiefer gehender beschäftigte, merkte ich, dass ich diesbezüglich nicht der Einzige war. Ich entdeckte, dass eine ganze Reihe von Autoren in diese Richtung weisende Ansichten hatten, wenn auch zumeist unterschiedliche und nicht unumstrittene. Die Entstehungsgeschichte des Buches führte dazu, dass das vorliegende Buch eigentlich aus zwei unabhängigen Teilen besteht: Menschen, Clans, Stämme, Völker, Nationen - Hierbei geht um die Entwicklung kleiner menschlicher Siedlungsverbände zu Stämmen, später zu Völkern und letztendlich zu dem, was wir heute als Nationen bezeichnen. Es geht also um Bevölkerungsentwicklung und Siedlungskontinuität in Mitteleuropa mit einem besonderen Fokus auf das Gebiet der mittleren Saale, in der Besonderheit einer alternativen Sichtweise zum Entstehen einer wendischen bzw. sorbischen Bevölkerung zwischen Oder und Elbe/Saale. Geschichtsträchtiges zwischen Saale und Unstrut - Wie hier schon der Titel verrät, geht es in diesem Teil um die geschichtliche Entwicklung der Region zwischen Saale und Unstrut, dabei durchaus Randgebiete mit einbeziehend. Lokalgeschichte geht nicht ohne Einblick in die Geschichte der umliegenden Region und diese stand ihrerseits in Wechselbeziehungen zu anderen Regionen. Nur wer diese kennt, kann erst seinerseits viele Dinge verstehen, die lokal vor Ort geschahen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagungen für das durchlesen und korrigieren gehen besonders an:
Jürgen Winkler, Gudrun Urlauber,
Kontakt und Weiterführendes
Version 17.12.2019
Weiteres unter www.steffanbruns.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Menschen, Clans, Stämme, Völker, Nationen
Mitteleuropäische Besiedlungsgeschichte
Germanen – Wenden – Slawen … ein Problem
Völker kommen und gehen, Menschen bleiben
Erste Besiedlungen
Der erste Mitteleuropäer
Der Cro-Magnon
'Ancient DNA'
Die Nostraten
Die eiszeitlichen Europäerinnen
Die Alteuropäer
Das Ende des Paradieses
Das Doggerland
Kulturen der 'Keramiker'
Bandkeramiker im Spiegel der Haplogruppen
Die Stichbandkeramiker
Die Schnurkeramiker
Indoeuropäer
'Ger-Kel-It-er'
Udolphs Theorie
Die Germanen
Die Veneter
Furor Teutonicus
Nordische Heimatverbundenheit
Die Wenden
Die Slawenlegende
Die Urheimat
Ein Volk entsteht
Leben und Überleben
Die Slawen
Das Reich des Samo
Slawen überschreiten die Saale
Belege gegen einen Bevölkerungswandel
Die Archäologie
Die Genetik
Y-DNA
X-DNA
atDNA
mtDNA
Ergebnisse der Genetik
Rassenunterschiede
Gesellschaftliche Differenzierungen
Von der Genetik zur Ortsnamenforschung
Ortsnamen
Dorfformen
Stammesnamen
Sprachen
Gegentheorien
Resümee
Wie ich es mir denke
Schlusswort
Siedlungsgeschichte im Saale-Unstrut-Raum
Vorgeschichte
Siedlungsnamen
Dorfformen
Weiler(-dorf)
Druppel / Weiler-Ansammlung
Platzdorf
Sackgassenplatzdorf
Runddorf
Rundling
Sackgassendorf
Gassendorf
Straßendorf
Haufendorf
Angerdorf
Sonstige neuere Dorfformen
Haus- und Hofformen
Eindachhof
Der Zweiseithof
Der Dreiseithof
Der Vierseithof
Die baulichen Anlagen
Historische Höfe und Häuser
Die Archäologie
Jungsteinzeitliches Langhaus
Bronzezeitliches Wohnstallhaus
Das eisenzeitliche Wohnstallhaus
Mittelalterliche Weiterentwicklungen
Das Hersfelder Zehntverzeichnis
Statistische Angaben zur Bevölkerungsentwicklung
Namen und Berufe
Männliche Vornamen
Weibliche Vornamen
Berufe
Religionszugehörigkeit
Lebenserwartung
Uneheliche Kinder
Mehrlingsgeburten
Alter bei 1. Kind
Anzahl Kinder pro Familie
Alter bei Heirat
Scheidungen
Durchschnittsalter Verstorbene
Monatsauswertungen Geburten - Sterbefälle – Hochzeiten
Fazit zur Bevölkerungsentwicklung in den OFB-Orten
Geschichte zwischen Saale und Unstrut
Der Hassegau – heute eine namenlose Region
Die Unstrut
Das Flussumfeld
Geschichte der Unstrut-Schifffahrt
Weinbau an der Unstrut
Die Saale
Die Saaleburgen
Burg Giebichenstein
Die Hallenser Moritzburg
Schloss Merseburg
Weißenfels
Schloss Schönburg
Die Salzwirtschaft an der Saale
Udolphs Ansicht
Halloren
Der Ziegelrodaer Forst
Hügelgräber und Wüstungen
Eine 'teutsche' Jagd im Forst Ziegelroda – ein historischer Jagdbericht
Die Lautersburg
Salziges Wasser
Die Salza
Der Salzige See
Historische Beschreibung
Der Süße See
Die Seeburg
'Die Roden'
Eine Landschaft
Hydrographie
Erhebungen
Klima
Wälder – ein Auf und Ab
Besiedlungsgeschichte
Das Schmoner Tal
Bronzezeit
Geologie, Flora und Fauna
Das Querfurter Land
Hochwassergefahr
Im Wandel der Zeiten
Der Kuckenburger Zipfel
Archäologen auf der Kuckenburg
Das Schraplauer Land
Das Weidatal
Flussgeschichte
Die Herrschaft Schraplau
'Tal der Würde'
Geschichte
Herrschaftsverhältnisse
Der Kalibergbau
Elster-Luppe-Aue
Die Aue
Zwischen Warnen und Sachsen
Das Gosecker Land
Vergesst Stonehenge
Burg, Kloster und Schloss Goseck
Das Werden einer Landschaft
Vorzeit
Urzeit
Steinzeit
Bronze- und Eisenzeit
Germanenzeit
Die Thüringer
Fränkisch-Sächsischer Gegensatz
Die karolingische Herrschaft
Die mittelalterlichen Reichsgaue
Die ottonische Herrschaft
Hohes Mittelalter
Spätes Mittelalter
Neuzeit
Wandel in die Moderne
Territoriale Verhältnisse
Wege und Straßen aus alter Zeit
Bedeutende Städte zwischen Saale und Unstrut
Merseburg
Halle/Saale
Weißenfels
Naumburg
Freyburg
Laucha
Nebra
Querfurt
Archäologie zwischen Saale und Unstrut
Die Funde beim Braunkohlentagebau
Die ersten Menschen im Geiseltal
Der mittelalterliche Kirchhof von Wengelsdorf
Ergebnis der Ausgrabungen an der ICE Strecke
64 Kilometer Geschichte
Gräberanlagen aus der Stein- bzw. Bronzezeit
Das Rätsel eines Netzes auf der Landschaft
Bronze- und eisenzeitliche Landgräben und Grubenreihen
Neue archäologische Aufschlüsse
Länger als die Chinesische Mauer
Wofür dieser enorme Aufwand?
Die Himmelsscheibe von Nebra
Ein 4000 Jahre altes Handelszentrum an der Unstrut?
Der Rössener Fundplatz
Die Rössener Kulturgruppe
Der Grabhügel von Rössen
Das Sonnenobservatorium von Goseck
Das Massaker von Eulau
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung und Lebensstandard
Wüstungen des Hassegaues
Die administrative Geschichte des Hassegaues
Feudalrechte im Merseburger Land
Die Heeresfolge
Ausrüstung 1. Heereswagen
Ausrüstung 2. Heereswagen
Die Landesfolge
Die Gerichtsfolge
Die Wache
Die Wirtschaft der Region
Preisverhältnisse der Region in den 1830er Jahren
Durchschnitts-Marktpreise
Einige Anzeigen aus der Merseburger Zeitung
Chronik der Region
Nachwort
Anhang
Quellenverzeichnis
Bücher und Artikel:
Internetquellen:
Bilderverzeichnis:
Bücherliste
Vorwort
Das hier vorliegende Buch ist eigentlich geradezu aus Versehen entstanden. Für die Region habe ich bereits eine Reihe an Ortschroniken inklusive Ortsfamilienbücher (OFB) verfasst, weitere sind in Vorbereitung bzw. Planung. Um diese OFB mit lokal- und regionalgeschichtlichen Daten ausschmücken zu können, suchte ich nach einem Geschichtsbuch für die Region. Fand aber keines und begann daher selbst zu recherchieren ... irgendwie waren bald ein paar hundert Seiten zusammen. Die brauchten nur noch in einem neuen Zusammenhang gebracht zu werden, mit weiteren Informationen ergänzt und abgerundet – und fertig war das Buch, besser gesagt, zwei zusammenhängende Bücher.
Na ja, nicht ganz, kaum war es fast fertig, kam ich mehr und mehr in Konflikt mit der allgemeinen Auffassung eines umfassenden Bevölkerungsaustausches östlich der Elbe-Saale-Linie zu Beginn des Mittelalters, der auch starke Auswirkungen auf den Saale-Unstrut-Raum hatte. Nachdem ich mich in dieser Richtung tiefer gehender beschäftigte, merkte ich, dass ich diesbezüglich nicht der Einzige war. Ich entdeckte, dass eine ganze Reihe von Autoren in diese Richtung weisende Ansichten hatten, wenn auch zumeist unterschiedliche und nicht unumstrittene.
Die Entstehungsgeschichte des Buches führte dazu, dass das vorliegende Buch eigentlich aus zwei unabhängigen Teilen besteht:
Menschen, Clans, Stämme, Völker, Nationen
Hierbei geht um die Entwicklung kleiner menschlicher Siedlungsverbände zu Stämmen, später zu Völkern und letztendlich zu dem, was wir heute als Nationen bezeichnen. Es geht also um Bevölkerungsentwicklung und Siedlungskontinuität in Mitteleuropa mit einem besonderen Fokus auf das Gebiet der mittleren Saale, in der Besonderheit einer alternativen Sichtweise zum Entstehen einer wendischen bzw. sorbischen Bevölkerung zwischen Oder und Elbe/Saale.
Geschichtsträchtiges zwischen Saale und Unstrut
Wie hier schon der Titel verrät, geht es in diesem Teil um die geschichtliche Entwicklung der Region zwischen Saale und Unstrut, dabei durchaus Randgebiete mit einbeziehend. Lokalgeschichte geht nicht ohne Einblick in die Geschichte der umliegenden Region und diese stand ihrerseits in Wechselbeziehungen zu anderen Regionen. Nur wer diese kennt, kann erst seinerseits viele Dinge verstehen, die lokal vor Ort geschahen.
Abb. 1a.: Übersichtskarte über die Region – Zustand 1920 / Abb. 1b.: Frühmittelalterliche Gaueinteilung ca. um 900
Ergänzend kommt noch ein weiteres Buch hinzu, welches selbst so umfangreich und speziell wurde, dass ich daraus ein eigenes Buch machen musste, um den Umfang des zuvor genannten Buches nicht zu sprengen. Es behandelt die Lokalgeschichte einer Teilregion des einstigen Hassegaus: Dass des Geiseltals und unmittelbaren seine Nachbartäler.
Die Ortschroniken der Orte des Geiseltals und seiner Umgebung
In topografischer Reihenfolge gibt es hier umfangreiche Ortschroniken, mit besonderem Blick auf die örtlichen Kirchen und Rittergüter. Fernerhin wird auch auf Wüstungen und archäologische Funde in der Umgebung der jeweiligen Ortschaften hingewiesen. Darüber hinaus gibt es aber zu manchen Dörfern zahlreiches Weiteres an Interessantem zu berichten.
Die Geschichte des Geiseltals und seiner Umgebung
Auch hier verrät der Titel bereits alles, denn es geht hier um Geschichtliches über das Geiseltal, aber auch die unmittelbar dem Geiseltal benachbarten sanften Täler von Stöbnitz, Klia, Leiha, Laucha und Schwarzeiche. Dabei wird auch der geologischen Entwicklung des Geiseltals Aufmerksamkeit gezollt, insbesondere deshalb weil diese auch auf die spätere menschliche Geschichte vor Ort, aber auch in der ganzen Region, einen überaus großen Einfluss hatte.
Zusammen mit meinen Ortschroniken / Ortsfamilienbüchern bilden die beiden Bücher ein Duett. Wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass der Inhalt der beiden obengenannten Bücher, in meinen Ortschroniken / Ortsfamilienbüchern in unterschiedlichen Umfang Wiederverwendung findet, denn genau dazu wurde es geschaffen.
Nach meinem Kenntnisstand ist dieses bis zum heutigen Zeitpunkt das einzige Buch, welches sich mit der Geschichte des Geiseltals und seiner unmittelbar benachbarten Täler befasst. Es ist klar, dass dies in diesem Rahmen nur in einem eher bescheidenen Umfang erfolgen kann, aber genau dieser Umfang sollte für den normal Interessierten auch der ausreichende sein. Ich hoffe, dabei weder allzu tiefgründig, noch zu oberflächlich geworden zu sein. Weiterhin hoffe ich, ein Buch verfasst zu haben, welches in der gesamten Familie Interesse an der Geschichte ihrer Ahnen und deren Heimat weckt und gleichzeitig stillt. Über Resonanzen jeglicher Art würde ich mich freuen.
Steffan Bruns
Berlin, den 17.Dezember 2019
P.S. Aus Kostengründen sind sämtliche Bilder nur in Graustufen. Das Buch würde mir, und wohl nicht nur mir, mit Farbbildern besser gefallen, aber es wäre dann ein vielfaches so teuer. Aus Erfahrungen weiß ich, dass es dann zu teuer wäre, um wirklich gekauft zu werden.
Einleitung
'Hassegau, noch nie gehört davon', wird sich so mancher sagen, selbst wenn dieser sogar aus 'dem Hassegau' kommt. Dies liegt ganz einfach daran, dass dieser Name mittelalterlich ist und bereits im Laufe des hohen Mittelalters wieder verloren ging und danach auch nie wieder ersetzt wurde und diese Region zu einer faktisch namenlosen Region verkam. Gemeint ist hiermit die Region zwischen Saale und Unstrut, welche im Weiteren auch von der Salza und dem Ziegelrodaer und Allstedter Forst begrenzt wird.
Eigentlich ist der historische Hassegau noch größer und besteht aus drei Teilgaue. Neben dem eigentlichen und ursprünglichen Hassegau, gibt es im Westen den Teilgau 'Friesenfeld', im Norden, also nördlich der Salza bis hin ins Wettiner Land, den Teilgau 'Nordhosgau', auch bekannt als nördlicher Hassegau. Es ist recht sicher, dass alle drei Gaue einstmals ein Gau waren, es scheint aber, dass diese sich bis spätestens zum Jahr 1000 in verschiedene, relativ selbständige Gaue aufteilten.
Die Region des Hassegaues, einst zum Thüringerreich gehörend, dann offiziell sächsisch, wurde von den Merowingern und Karolingern durch langsames Einsickern über einen Zeitraum von über zwei Jahrhunderten erobert. Ein Vorfahr von Karl den Großen, wahrscheinlich Vater Pippin oder dessen Vater Karl Martell, war es wohl, der unmittelbar nördlich der unteren Unstrut, diesen Gau in seiner Basis schuf, als er zeitweise die regionale Nordgrenze seines Reiches im Norden bis an die Salza heranschob. Das Land was er damals eroberte, es mag so um das Jahr 740 gewesen sein, mag damals nicht sehr bedeutend gewesen sein, es war aber strategisch von hoher Bedeutung. Und vielleicht ahnten die Karolinger ja tatsächlich von dessen Potential. Dennoch, auch die Franken hielten sich an einer uralten Regelung, dass die Grenze zwischen Sachsen und Thüringen die Unstrut sei, weswegen das Hassegau weiterhin de jure eigentlich sächsisch war und blieb, de facto war es aber fränkisch-thüringisch.
Zur sichereren Versorgung der Burgen und der karolingischen Front gegen die Sachsen an der Salza, wurden hier wohl zahlreiche neue Dörfer angelegt und diese zum Teil mit Neusiedlern aus dem Altreich neu besiedelt. Erst Karl der Große eroberte das Sachsenreich vollständig, wohl in diesem Zuge schob er die Grenze des Hassegaues auch über die Salza hinaus, etwa bis hin an die Schlenze, möglicherweise gar bis an die Wipper und gliederte wohl dieses Gebiet dem Altgau Hosgau, also Hassegau, an. Es ist schwer zu sagen, ob Karl der Große bereits den Nordhosgau als mehr oder weniger eigenständigen Gau schuf oder dieser erst später entstanden ist, zumindest aber die Abspaltung des Friesenfeldes dürfte auf sein Konto gehen.
Eine informative und einzigartige Urkunde für diese Region ist das 'Verzeichnis Hersfelder Zehnten im Friesenfeld, an Hersfeld zehntender Burgen sowie Hersfelder, vom Kaiser und vom Herzog Otto besessener Ortschaften'. Die Urkunde, auch wenn nur in einer Fassung des 11. Jahrhundert vorliegend, entstammt in ihrer Basis wohl dem 9. Jahrhundert, die Hintergründe für dessen Entstehung aber der Zeit Karl des Großen, wohl so gegen 775-780. Ein gewisses Problem ist, dass die Urkunde nur vom Friesenfeld redet, nachweisbar aber viele der in der Urkunde genannten Orte außerhalb des Friesenfeldes liegen. Die genaue Ostgrenze des Friesenfeldes hin zum südlichen Hassegau ist nicht bekannt, aber eine ungefähre. Sie dürfte östlich von Memleben an der Unstrut begonnen haben, von da nach Norden entlang des Höhenrücken des Ziegelrodaer und Allstedter Forstes geführt haben, im Norden Rothenschirmbach mit eingeschlossen haben. Recht unumstritten gehörte zumindest zeitweise auch der Burgbezirk Cucunburg (Kukenburg an der Weida) dazu, möglicherweise auch der Burgbezirk Quernfordburg (Querfurt). Obhausen dürfte dabei wohl der östlichste Ort des Friesenfeldes gewesen sein. Die Orte des Siedebachtales, der Vier Dörfer (Göhritz, Barnstädt, Göhrendorf, Nemsdorf), und alles östlich von Schafstädt, Asendorf, Esperstedt und Hornburg waren nicht zum Friesenfeld gehörig. Unabhängig von dieser Tatsache werden Orte im Hersfelder Zehntverzeichnis genannt, die bis an die Saale und Unstrut reichen, ja sogar darüber hinaus, in ganz andere Gaue hinein. Ja sogar die meisten genannten Orte liegen in diesem Gebiet, wie aber kommt das? Wussten die Hersfelder Äbte nicht, was ihnen gehörte? Doch, schon, aber wie oben erwähnt, die Urkunde an sich entstammt dem 11. Jahrhundert, sie wurde offenbar auf der Basis von verschiedenen Urkunden des 9. Jahrhunderts verfasst, welche heute nicht mehr vorliegen. Den Äbten des 11. Jahrhunderts war aber die alte Gauordnung nicht mehr wirklich geläufig und vergrößerten so das Friesenfeld um ein vielfaches.
Angemerkt sei aber auch, dass einige Historiker wie zum Beispiel Otto August, in der Bezeichnung 'Friesenfeld' nur eine andere Bezeichnung für den eigentlichen, den südlichen Hassegau sehen, als Abgrenzung zum nördlichen, nördlich 'der Seen'.
Der Hassegau war wohl von verschiedenen Stämmen und Völkern besiedelt, abgesehen von eher wenigen Sachsen, waren es wohl vor allem Angeln und Sueben. An der Unstrut sicher auch Hermunduren, zur Saale hin auch Warnen, Vandalen und Wenden. Außerdem müssen spätestens in karolingischer Zeit, wahrscheinlich aber bereits unmittelbar nach der Zeitenwende, dort auch Hessen gesiedelt haben, denn von diesen hat der Gau seinen Namen: Hassegau oder Hosgau. Soweit die offizielle Lehrmeinung und sicherlich auch eine gute Theorie, aber eben auch nicht mehr als eine solche. Andere Möglichkeiten sind möglich.
Im 8./9. Jahrhundert müsste dann die hessische Besiedlung des Hassegaus liegen, nur gibt es dabei zwei maßgebliche Probleme. Erstens, war der Hassegau schon das gesamte Frühmittelalter lang recht dicht besiedelt. Er war wohl, und dies recht ununterbrochen, mindestens seit der ältesten Bronzezeit einer der dicht besiedelsten Gebiete östlich des Rheins und nördlich der Donau. Andermal war aber Hessen, mit Ausnahme der Wetterau das ziemliche Gegenteil davon. Es ist bekannt, dass aufrührerische Thüringer in anderen Reichsgebieten angesiedelt wurden, dies dürften aber Thüringer aus den inneren Gauen gewesen sein, weniger solche, die an der Frontlinie zu den Sachsen lebten. Denn die Franken waren hier an der Grenze Schutzmacht und diese war vor allem gegenüber den Sachsen absolut notwendig, denn auf die Sachsen waren die Thüringer an sich auch nicht besser zu sprechen, als auf die Franken.
Aber wie kommt dann der Gau zu seinem Namen, nun es gibt noch eine 'zweite Lehrmeinung', in welcher der Name von 'Hohsegau' als 'Hochseegau' interpretiert wird, nach der Burg Hochseeburg, dem heutigen Seeburg bei Röblingen. Sicher, auch dies ist nicht die schlechteste Theorie, aber es ist auffällig, dass die Gaue der Umgebung vor allem nach den dort lebenden Stämmen oder dort durchfließenden Flüssen benannt wurden. Ein Fluss, der hier Namensgeber hätte sein sollen, fällt aber aus. Heißt dies, dass somit die erstgenannte Lehrmeinung die korrekte ist?
Nun, ich möchte hier eine dritte Theorie nennen. Beim Anschauen einer Karte der mittelalterlichen Gaue fiel mir auf, dass der östlich des Hassegaues benachbarte Gau, 'Chutizi' genannt wird. Bis etwa zur Mulde zieht sich dieser hin, möglicherweise gar bis zur Elbe bei Riesa. Der Name ist nicht einfach zu erklären, die Endung '-izi' wird oft slawisch erklärt, könnte aber eher mit dem althochdeutschen 'sezzi=Sitz' in Verbindung stehen. Also 'Sitz der Chutten'? Ein Stamm Namens Chutten ist nicht bekannt, aber einer des Namens 'Chatten'. Nun wird dieser Stamm von den meisten Historikern ins heutige Hessen verlegt und dort saß er sicherlich auch tatsächlich im Frühmittelalter, aber lebte er dort schon immer? Nun, die Chatten werden von einem Teil der Historiker dem Kultverband der Hermionen zugeordnet, zu welchen auch die Hermunduren gehören. Früheste Nennungen der Hermunduren verorten diese aber nicht im heutigen Thüringen, sondern in die Gegend östlich davon, zwischen Saale bzw. Mulde und Elbe. Da aber nun bekannt ist, dass zur Zeitenwende Chatten und Hermunduren eng benachbart lebten, immerhin bekriegten sie sich in der sogenannten 'Salzschlacht', müssen diese damals hauptsächlich westlich der Mulde bzw. Saale gelebt haben. Tatsächlich werden diese auf Karten, die auf Basis von Angaben des Ptolemaios und von Tacitus gemacht wurden, in einer Region dargestellt, der im Osten mindestens bis zur mittleren Saale reicht. Sie wären dann seit etwa kurz vor der Zeitenwende die hauptsächlichen Einwohner der Region, allerdings aber nicht die einzigen. Kann es nicht sein, dass Chatten unter anderem auch in einem Gürtel vom Ostharz bis zur mittleren Mulde siedelten?
Nun, man muss sagen 'ja', denn die genauen Siedlungsgebiete der Germanen in der sogenannten 'Germania Magna' sind nicht wirklich bekannt, ja sogar hoch umstritten. Die damaligen römischen Historiker und Geographen waren nur selten mal vor Ort und haben daher die Stämme nach 'Hören-Sagen' verortet. So heißt es dann auch oft: 'hinter Stamm A lebt Stamm B, dahinter Stamm C, südlich davon Stamm D, am Fluss XY lebt Stamm E'. Dass Prinzip in die heutige Zeit versetzt, könnte man sagen 'Südlich der Mecklenburger leben die Altmärker, dahinter die Anhaltiner und dann die Lausitzer, am Fluss Elbe leben die Sachsen, westlich davon die Vogtländer'. Diese Aussage bringt viele Informationen, aber hält noch mehr zurück. Was ist mit den Wendländern und den Prignitzern zwischen Mecklenburg und Altmark, was mit denen der Börde zwischen Altmark und Anhalt, die Sachsen leben nicht nur an der Elbe, sondern in einem breiten Streifen, der schon bei den Anhaltern beginnt … und und und. Jeder wird einsehen, dass man so nur sehr schwer und mit hohen Ungenauigkeiten irgendetwas verorten kann. Also gibt es viele Unsicherheiten bei der Verortung der Völker der Germania Magna.
Sicher ist aber eines, die archäologische Kultur der Menschen, die damals an der mittleren Saale wohnten, ist dieselbe, wie die im mittleren und nördlichen Hessen, im Prinzip genau die der Chatten. Sicher ist aber auch, dass die Chatten bevor sie, wohl erst nach der Zeitenwende, nach Hessen kamen, wo anders gelebt haben müssen. Warum nicht zwischen Harz und Mulde? Es könnte aber genauso gut sein, dass Chatten erst zur Römerzeit hier her kamen, ähnlich wie es dann auch die Sueben, Angeln und Warnen taten. Die Chatten waren möglicherweise die häufigen Strafexpeditionen der Römer leid und siedelten sich beiderseits der Saale beim späteren Merseburg an.
Als im Frühmittelalter die Saale zur Grenze wurde, gingen die linkssaalischen und die rechtssaalischen Chatten unterschiedliche Wege. Dies war nach dem Jahre 600, in dieser Zeit kam es in den frühen deutschen Sprachen zur sogenannten Zweiten Lautverschiebung, in welcher aus (christlichen) Chatten sprachlich Hessen wurden. Dies aber natürlich nur westlich der Saale, wo Franken und Sachsen diese Lautverschiebung mitmachten, aber nicht östlich der Saale, wo diese Lautverschiebung nicht nur nicht stattfand, sondern eine Wendisierung nicht-christlicher Stämme, später gefolgt von einer Slawisierung. Wenn diese Theorie korrekt ist, dann ist der Gau Chutizi faktisch der Ost-Hassegau. Aber auch der Ort der Salzschlacht des Jahres 58 u. Z. lässt sich somit an der mittleren Saale, wohl bei Halle, recht gut lokalisieren, denn bisher war es ein Problem, die Wohnorte der Chatten, mit eben den in römischen Quellen genannten Örtlichkeiten in Verbindung zu bringen. Die Folge dieser Theorie wäre, dass es unter den Karolingern keine nennenswerte Ansiedlung von Hessen gab. Bestenfalls wurde die Region nach der Eroberung durch die Karolinger, nur durch fränkische Adlige und ein paar getreue Wehrbauern aus dem hessischen Franken faktisch in Besitz genommen. Diese sicherte sich die besten Höfe und bildeten eine Elite, welche die Ureinwohner beherrschte - wohl recht ähnlich wie in der Eisenzeit die Germanen und in der Bronzezeit die Indoeuropäer. Geschichte wiederholt sich! Das natürlich nur westlich der Saale, die Chatten östlich der Saale gingen, zusammen mit den dortigen Sueben, Warnen und Wenden, in den Sorben auf und wurden im weiteren Verlauf auch slawisiert.
Aber zurück zu den Hessen und Chatten. Hessen selbst wurde als Land der Chatten nur wenige Jahrzehnte vor der Eroberung des Thüringerreiches erobert bzw. ins Fränkische Reich eingegliedert. Die Chatten waren ein Teilvolk der Franken und es ist denkbar, dass diese sich auch freiwillig dem Merowingerreich anschlossen. Das muss wohl so um das Jahr 500 gewesen sein, da war aber das Land nördlich der Wetterau relativ schwach besiedelt. Die alte Verbindung der Chatten mit den Franken hat sicher die Integration der Chatten ins Reich vereinfacht. Dennoch bleibt, sie konnten damals kaum größere Siedlerbewegungen Richtung Thüringen durchführen. Bestenfalls ein paar Adlige mit ihren treuesten Anhängern dürften daher aus Hessen nach Thüringen umgesiedelt sein.
Anfangs lebten die Hessen an der Peripherie des Frankenreiches, wohl kaum merkbar war das Frankenreich bei den Hessen, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Wirklich interessant für die fränkischen Könige wurde das spätere Hessen erst mit der Eroberung des Thüringerreiches, da es faktisch einen Keil zwischen Thüringen und den fränkischen Rheinland darstellte, welcher immer wieder Gefahr lief, unter sächsischen Einfluss zu geraten. Die Eingliederung der hessischen Chatten scheint keine große Aktion gewesen sein, von größeren Widerständen und Kriegszügen ist jedenfalls nichts bekannt. Gerade zu auf einmal erscheint die Region als fränkisch. Manche Gegenden ihrer eroberten Reichsteile beherrschten die Franken eher indirekt, andere deutlich direkter. Gerade in umstrittenen oder widerborstigen Regionen legte man Ansiedlungen fränkischer Adliger und ihrer Gefolgsleute an, also Bauern. Nicht das diese Bauern den Frankenkönigen sehr treu waren, aber die fränkischen Adligen hatten sie gut unter ihrer Kontrolle. Die Chatten und ihre Klientelvölker waren jedenfalls wohl schon binnen zwei Jahrhunderte gut ins Frankenreich integriert worden.
Im Jahre 738 u. Z. tritt der Name Hessen zum ersten Mal in der Geschichte auf: In einem Sendschreiben Papst Gregors III. an Bonifatius wurde von mehreren Kleinstämmen auf dem Gebiet der Chatten berichtet. Erwähnt wurde neben den Lognai im mittleren und oberen Lahntal, den Wedrecii (möglicherweise im Wetschafttal) und den Nistresi (auf der Korbacher Hochfläche) auch das Volk der Hessen (populus hessiorum), das an der unteren Fulda siedelte. Der Name Hessen wurde fortan als Sammelname auf alle Gruppen in Nieder- und Oberhessen übertragen. Die linguistische Herleitung der Namenswandlung von Chatten zu Hessen verlief in mehreren Zwischenschritten: Chatti (ca. 100 u. Z.) → Hatti → Hazzi → Hassi (um 700 u. Z.) → Hessi (738 u. Z.) → Hessen. (Siehe hierzu auch die zweite Lautverschiebung in der deutschen Sprache.)
Die etymologische Herleitung des Namens der Hessen blieb – wegen der langen Überlieferungslücke zwischen der letzten Erwähnung der Chatten 213 und der ersten Erwähnung der Hessen 738 – nie unumstritten. Der Wandel der Stammesbezeichnung wird heute in den Kontext der Ausdehnung des fränkischen Machtbereichs auf ehemals chattisches Gebiet gestellt. Zudem stellte man Versuche an, durch archäologische Befunde, die in der Forschung als überzeugend betrachtet werden könnten, eine Kontinuität zwischen Chatten und Hessen zu begründen. Entscheidend waren dabei die Ausgrabungen in den Wüstungen Geismar und Holzheim bei Fritzlar in den 1970er Jahren. Beide Orte waren wahrscheinlich von der römischen Eisenzeit bis ins Hochmittelalter durchgehend besiedelt – allerdings ist es nur eine Annahme, dass hier auch Chatten siedelten.
Wie auch immer, für dieses Buch ist die hessische Geschichte eher Nebensache. Ob im Hassegau nun waschechte Hessen, also Chatten, siedelten bzw. angesiedelt wurden oder Bauern aus unterschiedlichen fränkischen Landesteilen und man diese eben nur Hessen nannte, weil diese eben, dass den Thüringern und Sachsen nächste fränkische Volk waren. Egal wie, groß dürfte die fränkisch-hessische Siedlung niemals gewesen sein. Wahrscheinlicher wurden viele der lokalen Adligen ausgeschaltet, fränkische Adlige, einige wohl aus dem frankentreuen Hessen, übernahmen den Job. Die Bauern konnten sich damit durchaus arrangieren, denn noch griff das Feudalsystem nicht und viele der freien Bauern waren selbst de facto kleine Adlige und hatten damit selbst Interesse die zahlreichen hörigen Kleinbauern, oftmals selbst aus anderen Stämmen, sicher zu beherrschen und unter Kontrolle zu behalten.
Als die Karolinger den Hassegau als Grafschaft gründeten, verstanden sich dessen Bewohner nicht als ein Volk der Hassegauer, ein Fakt, der sich auch in Zukunft nicht änderte. Wann und wie das Friesenfeld zum Hassegau kam, ist nicht einfach zu erklären, wahrscheinlich war es schon immer dazugehörend. Auf alle Fälle gab es dieses schon unter Karl den Großen, und es war damals schon ein eigener Gau, wenn auch einer in enger Anlehnung an den Hassegau. Wahrscheinlich handelte es sich um zwei administrative Territorien, welche aber in Personalunion von einem Pfalzgrafen regiert wurden. Wegen seiner guten Arbeit bekam er dann von Karl den Großen die besagte Erweiterung über die Salza nach Norden. Sein Hassegau grenzte im Norden nun an den dortigen Sueben- bzw. Schwabengau. Dessen Bewohner waren allerdings keine Neusiedler aus dem fränkischen Herzogtum Alamannien, sondern deren Vorfahren, suebische Siedler, welche einst von der oberen Havel an die Elbe kamen. Sie kamen auch in die Region zwischen Saale und Unstrut.
Unter den Ottonen hatten viele der alten Pfalzgrafschaften ihre Bedeutung verloren. Das Grafenamt wird zwar noch bis Mitte des 11./12. Jahrhunderts vergeben, aber der Titel wird mehr und mehr Makulatur, denn längst ist das Land unter verschiedenen Grafen und den Bischöfen von Halberstadt und Merseburg aufgeteilt worden, wobei ein Hauptteil des Hassegaues an Halberstadt kam und nur der unmittelbar um Merseburg gelegene an Merseburg. Das war dennoch kein so schlechter Deal für Merseburg, denn dieses konnte so seine volle Kraft gegen Osten, weit über die Saale hinaus, lenken. Der Westen und Norden, vor allem das Friesenfeld, wurden gar zum Stammland der Grafen von Mansfeld, welche als Nachfahren der Grafen des Hassegau gelten und somit zu den wichtigeren Grafen des Reiches.
In der Folge geschah mit dem Hassegau ähnliches wie in anderen Regionen des Reiches, das Land geriet unter den Druck von Bischöfen, Grafen und Städten. Jeder der Beteiligten versuchte sich so viel Land, so viele Dörfer wie möglich unter die Nägel zu reißen – wobei die Städte erst eher spät, im Hochmittelalter, sich ins Spiel einschalteten. Dieser Interessenkampf führte wie überall im Reich, so auch hier, zu einer Fragmentierung der Herrschaft des Landes. Der Hassegau zerfiel und schon im 12. Jahrhundert redete niemand mehr von ihm. Denn nachdem es keine Grafen des Hassegaues mehr gab, gab es auch kein Hassegau mehr. Die letzten Grafen des Hassegaues waren übrigens die Mansfelder Grafen, ein sehr altes Adelsgeschlecht, welches bis in die Neuzeit überlebte. Einer hochmittelalterlichen Legende nach soll ein früherer Graf von Mansfeld, ein Hoyer der Rote, Ritter der legendären Tafelrunde gewesen sein. Dem muss aber entgegengehalten werden, dass die Mansfelder Grafen historisch erst ab 868 nachweisbar sind, damals aber bereits als nicht unwichtige Pfalzgrafen. Tatsächlich dürfte das Amt der Hassegauer Pfalzgrafen kaum vor 750 gegründet worden sein.
Die Region des Hassegau mag heute - als Gesamtheit - namenlos sein, aber sie ist alles andere als geschichtslos. Die schriftliche Geschichte setzt zwar erst langsam im frühen Mittelalter ein, aber davor war diese Region keinesfalls von einzig ihre Keulen schwingenden und Met trinkenden Bärenjägern bewohnt, welche ihr Dorf nur dann gelegentlich verließen, um auf ihren Plündertouren Richtung Süden Spaß mit den Italiener(inne)n zu haben. Ganz im Gegenteil, hier kommt die berühmte Himmelsscheibe von Nebra her, hier steht bei Goseck das deutsche Stonehenge - jahrtausendealte Relikte menschlichen Intellekts und ebensolcher Schaffenskraft, die älter sind als die Pyramiden Ägyptens. Zahlreich sind weitere archäologische Funde, welche man überall in der Region machte. So fand man Spuren des Neandertalers, wie des frühen Homo sapiens. Der Steinzeitmensch wuselte hier genauso herum, wie die Menschen der Bronze- oder Eisenzeit. Schon im Neolithikum entstand hier ein Gebiet relativ dichter Besiedlung, mit der Rössener Kultur gibt es gar eine Kulturgruppe, die nach einem Ort in diesem Gebiet benannt ist. Die Region zwischen Saale und Unstrut wurde in dieser Zeit zu einem wichtigen kulturellen und wirtschaftlichen Hotspot in der Mitte Europas und blieb es auch, selbst als andere Regionen an Bedeutung gewannen.
Heute gehört diese Region zu Sachsen-Anhalt, einem 1945 bzw. 1990 künstlich geschaffenen Konstrukt. Im frühen Mittelalter war die Region noch Kerngebiet des Thüringerreiches, dann geriet sie offiziell an Sachsen, nach und nach aber unter fränkische Herrschaft. Im hohen Mittelalter war sie umstritten bei kursächsischen und thüringischen Landesherren, auch die Brandenburger griffen hier bald ein, nachdem sie die Herrschaft über Querfurt bekamen. Ein großer Teil des Hassegaues kam mit der Zeit an Kursachsen, nur hat dieses Kursachsen (das heutige Land Sachsen) de facto nichts mit dem mittelalterlichen Sachsen zu tun als den Namen. Es ist eher ein Treppenwitz der leidigen deutschen Territorialgeschichte, wie das heutige Sachsen zu seinem Namen kam – von einem Adligen, der den Namen seiner sächsischen Herrschaft auf eine bei Wittenberg neu hinzugewonnene Herrschaft ausdehnte. Seine sächsische Herrschaft bei Lauenburg ging dem Hause irgendwann verloren, aber an der Elbe hatte man sich in alle Richtungen weit ausgebreitet und erreichte damit auch bald unsere Region. Da die Sachsen zu Napoleon hielten, verloren sie beim Wiener Kongress 1815 viele Gebiete, unter anderem die Region zwischen Saale und Unstrut, welche nunmehr die neue preußische 'Provinz Sachsen' bildete und in weiten Teilen zumindest identisch war mit dem sächsischen Landesteil Ostfalen. Ostfalen wiederum ist zu einem großen Teil erst im 6. Jahrhundert an Sachsen gekommen und gehörte zuvor zu Thüringen, wie aber diese die Landschaft nannten, ist heute unbekannt.
Vor wenigen Jahren wurde in mehreren Schritten aus mehreren älteren Kreisen der neue Saalekreis geschaffen, welcher in weiten Teilen mit dem einstigen Hassegau identisch ist, aber leider wichtige Gebiete des letztgenannten einfach außen vor lässt, wie z. B. die Täler von Unstrut und Saale und sich somit eigentlich nur noch auf die Hochebene beschränkt. Von Süden her reicht der ebenfalls neu kreierte 'Burgenlandkreis' über Saale und Unstrut hinauf auf die Hochebene und schließt so die südlichen Gebiete des Hassegaus mit ein.
Nun mögen die Herrscher und die territorialen Zugehörigkeiten über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder gewechselt haben. Auch kam es immer wieder zu Ab- und Zuwanderungen neuer Bevölkerungsgruppen. Aber viele der Menschen die hier heute leben, können trotz allen Wandels ihre Abstammung von den Erbauern Gosecks oder den Herstellern der Himmelscheibe von Nebra herleiten. Grundlegende genetische Untersuchungen, insbesondere in Zusammenarbeit mit genealogischen Auswertungen wie Ortsfamilienbüchern, könnten dies sicher gut belegen – zumindest so lange dies noch gemacht wird, solange es noch möglich ist. Denn erst heute in der Moderne ist die jahrtausendealte Besiedlungsgeschichte Mitteleuropas in einem derart umfangreichen Umbruch begriffen, wie es ihn nie zuvor gab. In einem Umbruch, der derartige Ausmaße hat, dass er binnen weniger Jahrzehnte jahrtausendealte Siedlungsfolgen zerreißt bzw. verwischt.
Zwischen Saale und Unstrut wurden keine modernen Nationen oder Reiche geschaffen, hier liegt weder der Grundstein Deutschlands, noch der Europas – aber die Region ist und bleibt ein wichtiger Baustein in der Grundmauer des Hauses der deutschen, wie auch des europäischen Kultur. Deutschland wie auch Europa würden ohne die Region an Saale und Unstrut deutlich anders sein, als sie es heute sind.
Wie also entstand die Region zwischen Saale und Unstrut, die in vielem so speziell ist, wie auch allgemein ist - romantische Flusstäler, sanfte Hochebenen, riesige künstliche Seen, einzigartige Kulturdenkmäler. Welche Geschehnisse machte sie zu dem, was sie heute ist, warum ist sie so, wie sie ist und nicht wie andere Regionen?
Im Nachfolgenden möchte ich über die Meilensteine der geschichtlichen Entwicklung dieser Region berichten, dabei will ich weniger den Fokus auf die großen Herrscher, ihre Kriege und Schlachten legen wie so viele andere Historiker, jedenfalls soweit dies möglich ist. So ganz kann man das Thema, nicht außer Acht lassen. Vielmehr will ich mich eher auf das fokussieren, was man als (Be-)Siedlungsgeschichte bezeichnen kann. Dass ich dabei zuweilen große Kreise ziehen muss, weit über Thüringen hinaus, liegt in der Natur der Sache, denn Thüringen ist keine isolierte Insel inmitten eines Ozeans. Ich bedauere zuweilen, dass ich oftmals so weite Kreise ziehen musste, dabei oft mich wiederholend, aber ohne diese wäre es einfach unmöglich gewesen, wichtige Sachverhalte und Aspekte hinreichend zu erklären.
Den Fokus will ich auf den einfachen Menschen und sein Leben richten. Denn er war es, der die vielfältigen Kulturdenkmäler dieser Region geschaffen hat, mit seinem Schweiß und seinem Können. Er war es, auch wenn in der Literatur meist nur der Name des Auftraggeber und Finanziers genannt wird. Dem sollten wir uns noch heute gewahr werden, wenn wieder einmal ein Politiker ein Band zur Eröffnung eines Bauwerkes durchschneidet, mit einem Stolz, als hätte er allein dieses gebaut.
Menschen, Clans, Stämme, Völker, Nationen
Eine Bevölkerungsgeschichte Mitteleuropas/-deutschlands mit dem Fokus auf das Saale-Unstrut-Gebiet
Mitteleuropäische Besiedlungsgeschichte
Germanen – Wenden – Slawen … ein Problem
Beim immer intensiveren Befassen mit dem Thema Siedlungsgeschichte des 6-10. Jahrhunderts im Saale-Unstrut-Raum ist mir immer mehr aufgefallen, dass sehr viel davon den Wenden bzw. Slawen zugeschrieben wird. Das bringt ein beträchtliches Problem mit sich - so fand ich. Diese Problematik führte bei mir zu einer Abwendung von der allgemein gültigen Lehrmeinung, nicht nur was die Wenden-/Slawenproblematik betrifft, sondern die gesamte mitteleuropäische Siedlungsgeschichte. Die Gründe, die mich dazu brachten, möchte ich im Nachfolgenden ausführlich darlegen. Mir ist bewusst, in welches Fahrwasser ich mich damit begebe, ich möchte aber schon von vornherein jeglichem Verdacht von Germanen- oder Deutschtümelei entgegentreten und betonen, dass es mir hier genau um das Gegenteil geht. Denn im Folgenden möchte ich meine Ansicht einer hohen Siedlungskontinuität seit dem Ende der Eiszeit, zumindest aber seit der Bronzezeit, an Saale und Unstrut im Besonderen, bzw. in Mitteldeutschland/-europa im Allgemeinen darlegen. Dabei will ich im Prinzip das Rad nicht noch einmal neu erfinden; fast nichts was jetzt folgt, hatten andere nicht schon zuvor geäußert. Was ich aber versuchen will, ist diese Aussagen in einen neuen Zusammenhang zu bringen.
Als unbestritten gilt einerseits die relativ hohe Siedlungsdichte in diesem Raum seit der Bronzezeit, im Grunde aber bereits seit der Steinzeit, zum anderen aber auch eine gewisse Siedlungskontinuität. Sämtliche Kartenwerke, die Kulturen der Stein-, Bronze- oder Eisenzeit aufzeigen, dokumentieren geografische Ausbreitungen, die nichts, aber auch rein gar nichts gemein haben mit den Verbreitungen späterer Völker. Wo immer man aber bisher in Mitteleuropa Genmaterial menschlicher Knochenfunde, die der Vorgeschichte entstammen, untersuchte, zeigte sich, dass dieses Genmaterial in diesen Gebieten noch heute verbreitet ist – wenn auch nicht mehr in den gleichen Häufigkeitsanteilen. Dabei sind viele Verbreitungstypen genetischer Haplogruppen durchaus mit Verbreitungsgrenzen vorgeschichtlicher Kulturen in Verbindung zu bringen, jedoch kaum mit denen der heutigen Völker bzw. Nationen. Mit anderen Worten, es gibt überall in den europäischen Großräumen mehr genetische Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen, die dort schon vor Jahrtausenden lebten und den heute dort Lebenden, als zwischen den Menschen größerer Nationen, die in verschiedenen Teilen ihrer Nation leben. Mit anderen Worten, Mecklenburger und Südschweden, Niederländer und Friesen, Schlesier und Neumärker sind sich genetisch näher, als Mecklenburger und Bayern.
Es dürfte wohl vor deutlich über 7.500 Jahren gewesen sein, als die damaligen Europäer noch Jäger und Sammler waren und gerade dort siedelten, wo ihnen das Jagdglück hold war. Jäger und Sammler brauchen viel Raum, kommen aber auch viel herum und vermischen sich natürlich auch entsprechend häufig und umfangreich. Dies ist aber auch die Epoche, in welcher mit dem Eindringen des Ackerbaues auch eine bis heute bestehende Siedlungskontinuität einsetzt. Mit diesem Teil der Geschichte will ich beginnen, damit hole ich zwar weit aus, denke aber, dass es unumgänglich ist.
Völker kommen und gehen, Menschen bleiben
Erste Besiedlungen
Die Fundstätte von Bilzingsleben, welches nur wenige Dutzend Kilometer westlich des Saale-Unstrut-Gebietes liegt, erschließt einen altsteinzeitlichen Lagerplatz des Homo erectus, genauer gesagt des Homo heidelbergensis. Die Funde werden auf ein Alter von ca. 370.000 Jahren geschätzt. Sie stammen aus Sandschichten, die unter Travertin-Vorkommen lagern und durch diese gut geschützt sind. Neben Steingeräten haben sich erstmals in Mitteleuropa in größerem Umfang Knochen- und Geweihwerkzeuge, Feuerstellen und Arbeitsplätze erhalten. Zahlreiche Pflanzen- und Tierreste erlauben eine genaue Rekonstruktion der Umweltbedingungen jener Zeit. Es ist ein Fundplatz, der gelegentlich als das erste Dorf Europas bezeichnet wird - eine Übertreibung, die dennoch gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt ist, denn dieser Lagerplatz war so optimal gelegen, dass er über einen längeren Zeitraum und von verschiedenen Menschengruppen immer wieder benutzt wurde.
Der erste Mitteleuropäer
Nach allem was wir bisher wissen, war dies wohl der Homo erectus, aus ihm entwickelte sich hier der Homo heidelbergensis und aus diesem der Homo neanderthalensis, der Neandertaler. Alle drei Gruppen haben in Mitteleuropa ihre Spuren hinterlassen, dies vor allem in den weiten Becken, die wohl einst steppenähnlich waren und ideale Jagdgründe darstellten.
Schon der Neandertaler dürfte sich sprachlich differenziert und abstrakt verständigt haben können. Anatomisch war er jedenfalls dazu in der Lage, auch wenn er wohl nicht den Lautumfang moderner Menschen hervorbringen konnte. Der Neandertaler hat wohl auch schon verschiedene Sprachen gesprochen, besiedelte er doch ein Gebiet zwischen Spanien und dem Altai, von Mitteldeutschland bis zum Toten Meer, und war mit Sicherheit auch bereits in verschiedene Populationen gespalten. So dürfte es in der letzten Warmzeit vor 55.000 Jahren, also nach mehreren Jahrzehntausenden Neandertalerdasein, sicherlich mehrere spezielle europäische Neandertalerpopulationen gegeben haben, welche wohl auch schon eigene Sprachen hatten. Immerhin hatten sie über 100.000 Jahre Zeit, ein eigenes Sprachsystem aufzubauen und ihr Siedlungsgebiet war groß. Zum Vergleich, beim modernen Menschen wird eine gemeinsame Ursprache als nicht viel älter als 60.000 Jahre angenommen.
Als der moderne Mensch aus Afrika auswanderte, geschah dies in mehreren Zügen. Die erste größere Auswanderung erfolgte vor etwa 110.000 bis 90.000 Jahren und führte entlang der Küsten des Indischen Ozeans bis etwa Hinterindien, später auch vielleicht schon bis Australien. Weiter kam man nicht, da man überall, vor allem im Norden, auf diverse Gruppen anderer alteingesessener Menschenrassen traf. Diese waren dem modernen Menschen zu dieser Zeit noch ebenbürtig oder gar überlegen, zumindest bezogen auf das Klima der nördlichen Gebiete. Die alteingesessenen Menschenrassen – in Europa der Neandertaler, in Mittelasien der Denisova-Mensch, in Ostasien eine weitere Rasse, die vielleicht mit dem Pekingmenschen identisch ist, sowie mindestens eine weitere, allerdings bisher unbekannte Rasse in Mittelasien bzw. dem Kaukasus - dürften durch das harte Klima im Norden Eurasiens Vorteile gegenüber dem damaligen modernen Menschen gehabt haben und stoppten so fürs erste den modernen Menschen, den Homo Sapiens bei seinem Vordringen.
Abb. 2.: Eiszeitliche Verbreitung der Neandertaler, an Hand ausgewählter Fundstätten
Vor etwa 55.000 Jahren kam es zu einer zweiten großen Auswanderungswelle. Wie vor 90.000 Jahren gab es mal wieder eine Warmzeit, da sich das Klima in Afrika mal wieder wandelte und den dortigen Menschen eine erhöhte Mobilität aufzwang. Der Mensch der zweiten Auswanderungswelle scheint einige zusätzliche Qualifikationen hinzugewonnen zu haben, denn diesen hielten die anderen Alt-Menschengruppen nur relativ kurzzeitig auf. Recht wahrscheinlich, dass sich die zweite Einwanderungswelle in Vorderasien und an anderen Kontaktorten, mit Alt-Menschengruppen mischte und hier die weiteren notwendigen zusätzlichen Qualifikationen erwarb, um nun weiter nach Norden vorzudringen.
Es ist anzunehmen, dass es damals zwei Hauptgruppen von Auswanderern gab, eine nördliche und eine südliche. Die Nördliche kam über das Niltal und saß wohl für einige tausend Jahre zwischen Sinai und Kaukasus fest. Die südliche Gruppe ging entlang der südarabischen Küsten, auch sie saßen wohl für einige Jahrtausende fest, wohl im östlichen Iran und nördlich angrenzenden Gebieten. Beide Gruppen erfuhren in ihren 'Ruhezonen' wohl besondere Evolutionsschübe. Denn in deren technischen Können sind schnell erhebliche Fortschritte festzustellen, welche von nun an stetig zunahmen.
In beiden 'Ruhezonen' scheint er sich mit mindestens zwei dieser Altgruppen auch gemischt zu haben, wie jüngste Genuntersuchungen nachgewiesen haben. Dies passierte wohl zum einen im Nahen Osten mit dem Neandertaler und zum anderen im nördlichen Mittelasien mit dem Denisova-Menschen und dem Neandertaler. Ähnliches geschah mutmaßlich überall in der Welt, bei den Vorfahren der Buschmänner in Südafrika genauso wie bei denen der Nordasiaten. So entstanden offensichtlich die einzelnen, heutigen Menschenrassen. In fast allen ist Erbgut verschiedener Altrassen festzustellen, die diese erst nach dem großen Aufbruch aus Zentral- bzw. Ost-Afrika aufgenommen haben können. Dieses Erbgut aus den Altrassen macht zwar nur wenige Prozent des Gesamtbestandes aus, dürfte aber doch wichtige anthropologische Eigenschaften geliefert haben. Aus dieser Perspektive sind die Schwarzafrikaner die 'reinrassigsten' modernen Menschen, da sie faktisch kaum Einflüsse dieser Altrassen in ihrem Genpool ausweisen.
Bereits für den Neandertaler konnte nachgewiesen werden, dass er eine relativ helle Haut, rote bzw. blonde Haare und wohl auch bereits grüne bzw. blaue Augen hatte. Die beiden afrikanischen Gruppen des modernen Menschen, die vor ca. 55.000 Jahren den Nahen Osten erreichten, besaßen sicherlich noch eine recht dunkle Haut, Haare und Augen – eher schwarzbraun, als ganz schwarz. Es gilt als hochgradig umstritten unter den Forschern, ob die Aufhellung eine eigenständige Entwicklung des Homo sapiens war, oder dieser sie von den Altgruppen übernahm. Die Verteilung der modernen Menschenrassen und das, was von den Altgruppen in diesen bisher nachgewiesen wurde, gibt aber genug Anlass, davon auszugehen, dass wir unseren hellen Teint den Neandertalern zu verdanken haben.
Der Cro-Magnon
Alle Gruppen trafen, wo immer sie hinkamen, bereits auf die ihnen nicht unbekannten Altrassen. Dies war auch so, als der moderne Mensch Mitteleuropa erreichte, dort wohnte bereits der Neandertaler, auch hier dürfte es zu einer Durchmischung gekommen sein, wobei die moderne Genetik den Durchmischungsraum zwischen Neandertaler und Homo sapiens eher irgendwo am Kaspischen Meer sieht, als in Europa. Obwohl im Genom anatomisch moderner Menschen Eurasiens ein Anteil von 2 bis 4 % neandertalerspezifischer Gene festgestellt wurde, ist dies für taxonomische Fragen unerheblich. Eine herkömmliche Hybridisierung fand also nicht statt, wohl aber eine Übernahme von 'Eigenschaften' des Neandertalers durch den modernen Menschen in Folge eines Genflusses. Denn der Homo sapiens war Anfangs deutlich dunkler im Typ.
Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit wurde der Neandertaler im mitteleuropäischen Raum binnen weniger tausend Jahre durch den modernen Homo sapiens verdrängt. Die ältesten 'europäischen Typen' entstanden wahrscheinlich bereits vor 50.000 Jahren in Vorderasien. Neueste genetische Untersuchungen scheinen zu belegen, dass bestimmte Charakteristika der späteren Europäer (blondes, braunes bzw. rotes Haar, blaue bzw. grüne Augen, Körperbehaarung, Schädelformen u. a. m.) in dieser Zeit vom Neandertaler auf den modernen Menschen übergingen. Die beiden so entstandenen neuen Varianten des modernen Menschen, genauer gesagt dessen europäische Variante, waren der sogenannte Cro Magnon-Mensch und der Brünn-Mensch (in der Literatur oft mit Combe Capelle gleichgesetzt, was aber falsch sein dürfte). Von beiden Typen sind zahlreiche Mischlingsformen aufgefunden worden. Beide Typen unterschieden sich körperlich, waren aber bestens an die widrigen klimatischen Verhältnisse in den eiszeitlichen Randgebieten Europas angepasst. Es ist so, dass vor allem aus diesen beiden Typen die europäischen Rassetypen entstanden. Denn während die Neandertaler längst ausgestorben waren, waren zahlreiche Gruppen, bedingt durch die geographische Isolation, die die Eiszeitvergletscherungen mit sich brachten, mehr oder weniger stark voneinander getrennt. Dabei ist zu beachten, dass der 'Cro-Magnon-Mensch' oder 'Brünn-Mensch' keine Bedeutung als Art oder Unterart des Menschen hat, sondern bestenfalls einem Rassebegriff entspricht und damit nur Synonym für einen bestimmten, aber vorherrschenden Typen des 'Alteuropäers' ist.
Abb. 3.: Frühe Verbreitung des Homo Sapiens aus Afrika
Die Cro-Magnon-Menschen, gerne auch als die ersten modernen Europäer bezeichnet, sind nach ihrem ersten Fundort in Frankreich benannt, wo die ersten Knochen 1868 ausgegraben wurden. Sie waren häufig über 180 cm groß und hatten einen relativ feingliedrigen Körperbau. Rein äußerlich kann man sie leicht an dem typischen Mitteleuropäer (alternativ auch am Nord- oder Westeuropäer) festmachen. Der älteste Schädel eines modernen Menschen in Europa stammt aus der rumänischen Höhle 'Peștera cu Oase' und wird als 'Oase 2' bezeichnet. Er wurde auf einen Zeitraum von vor 40.500 Jahren datiert. Zwei Milchzähne aus der 'Grotta del Cavallo' in Apulien wurden sogar auf ein Alter von 45.000 bis 43.000 Jahren vor heute datiert. Eine direkte Datierung von Knochenfunden aus der Fundstelle Buran-Kaya III auf der Halbinsel Krim ergab ein Alter von 31.900 (+240/−220) Jahren. Die nächst jüngeren Fossilienfunde aus Mladeč in Tschechien, der englischen Kent's Cavern sowie einigen französischen Fundstellen haben allesamt ein vergleichbares Alter. Die dazu passende Kultur ist das Aurignacien mit den ältesten Belegen aus Höhlen der Schwäbischen Alb und der Fundstelle Willendorf II in Niederösterreich (bis zu 40.000 Jahre alt).
Der sozusagen zweit älteste moderne Europäer, ist möglicherweise der Brünn-Mensch, aber seine Existenz als eigenständige Rasse ist in jüngerer Zeit unter den Forschern mehr und mehr umstritten. Der Name stammt von einem 1891 in jungpleistozänem Löß bei Brünn (heute Brno/Tschechien) gefundenen Skelett eines männlichen Individuums des frühen Homo sapiens sapiens (Brünn I; Homo sapiens fossilis). Der Brünn-Mensch wirkt moderner, langschädliger und körperlich noch graziler als der Cro-Magnon. Beide Typen haben eine vergleichbare Verbreitung, wobei der Cro-Magnon sich eher verstärkt von Frankreich nach Osten hin ausbreitet, der Brünntyp eher von Mitteleuropa nach Frankreich. Keine dieser Gruppen war aber je absolut isoliert, so sind zum Beispiel eiszeitliche Wanderungen vom eisfreien Süden der Britischen Inseln bis nach Böhmen archäologisch belegt.
Erst mit dem Ende der Eiszeit und dem folgendem Einzug der mesolithischen Wirtschaftsweise in Mitteleuropa wurden die wildbeuterisch lebenden Menschen, die auch in der nacheiszeitlichen Ära für Jahrtausende genetisch fortbestanden, durch eingewanderte neue Populationen abgelöst, was durch molekulargenetische Untersuchungen belegt wurde. Demzufolge entstammen die spät- und nacheiszeitlichen europäischen Jäger und Sammler des Mesolithikums überwiegend der Haplogruppe U, während bei mesolithischen, wie auch heutigen europäischen Menschen die mt-Haplogruppe H dominiert (Verbreitung: 30-50 % der heutigen Europäer). Beim geografisch unscharf definierten Begriff des Cro-Magnon-Menschen als eiszeitlichen, europäischen Typ lässt sich daraus zwar ableiten, dass es in Mitteleuropa zwar einen Bevölkerungswandel gab, dieser sich jedoch nur auf Populationen des modernen Menschen bezieht, deren Haplogruppen aus Skelettmaterial der letzten 20.000 Jahre rekonstruiert wurden. Zum Ende der Eiszeit sind dann aber die eiszeitlichen Rassengruppen wie Cro-Magnon oder Brünn bald passé, aus ihnen werden nun neue Gruppen, die sich in unseren heutigen europäischen Rassen widerspiegeln.
Am Ende der Eiszeit dürfte es aber in Europa eine Reihe von Rassen gegeben haben. Darunter die Dalisch-Fälische Rasse in Nordwesteuropa, welche mehr durch Cro-Magnon beeinflusst wurde, und die Nordische Rasse im östlicheren Zentraleuropa, welche mehr nach dem Brünn-Menschen schlug. Ihre Unterschiede sind dermaßen gravierend, dass sie nur in der Eiszeit in einem relativen Isolat entstanden sein können. Dennoch gibt es dabei zu bedenken, dass es mehr europäische Rassetypen gibt, als man sich überhaupt Isolate denken kann.
'Ancient DNA'
Hinweise gibt auch die moderne Genetik. In der Y-Haplogruppe CT tritt auch der Marker M89 (Y-Haplogruppe F) auf. Dieser koexistiert weder mit M130 (Y-Haplogruppe C), noch mit M40 bzw. M96 (Y-Haplogruppe E), muss also entstanden sein, nachdem die erste Gruppe Menschen bereits Afrika in Richtung Osten verlassen hatte. M89 charakterisiert eine Gruppe von Männern vor rund 40.000 Jahren (+/- 10.000 Jahre), die einstmals irgendwo zwischen Ägypten und dem Iran lebten. Das stimmt mit den ersten Funden von Steinwerkzeugen im Nahen Osten überein, die etwa 45.000 Jahre alt sind (abgesehen von den Funden in Qafzeh und Skhul im heutigen Israel, die aus dem folgenlosen, ersten Vorstoß vor 110.000 Jahren stammen, siehe dazu oben). Die nächsten Mutationen erfolgten anscheinend recht schnell, von F geht es über IJK, K, P zu R. In einer anderen Linie von F über IJK, IJ zu I. So kommt man zu den beiden wichtigsten europäischen Y-Haplogruppen.
In der Folgezeit verbreiteten sich die Menschen über die gesamte Welt. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor ca. 30.000 Jahren hatten sich die beiden nahöstlichen Gruppen teils aufgespalten, teils neu vermischt. Von den (alt-)europäischen Rassen, zu den (alt-)europäischen Sprachen zu springen ist zwar recht verwegen, ist doch das eine wie das andere eher hypothetisch als fundiert. Thesen werden viele geäußert, mal weniger, meist aber mehr sich widersprechend. Die ganze Thematik aber eher grob betrachtet, lässt sich doch einiges festmachen. Es muss vor ca. 40.000 Jahren ein Volk gegeben haben, dessen Sprache man als Nostratisch bezeichnet und welches im oberen Nahen Osten lebte und sich von da aus in die ganze Welt verbreitete. Dieses Volk dürfte dem Y-Haplogruppenkomplex F, mit den Unterkomplexen G, H und IJ entsprechen. Bereits vor 35.000 Jahren trennten sich dann I und J, J verblieb im Nahen Osten und I wanderte über Kleinasien und den Balkan in Europa ein. In jener Phase der Eiszeit hatten sich die präarktischen Steppen Zentralasiens bis ins heutige Frankreich ausgedehnt.
Abb. 4.: Verbreitung des Menschen auf Basis Erforschung Y-DNA – Quelle Wikipedia CC, Autor Chakazul
Die Bevölkerungsgruppe, die man der dravidischen Sprachfamilie zuordnet, wird in sprachlicher Verwandtschaft zur europäisch/nordasiatischen Sprachfamilie gesetzt. Dies passt zum Bild der Y-Haplogruppen, da die Y-Haplogruppen G (Georgier) und H (Draviden), sowie der Komplex IJK vor etwa 40.000 Jahren aus der Y-Haplogruppe F entstanden sind. Über die Y-Haplogruppen K und P muss bereits vor 25.000-30.000 Jahren die Y-Haplogruppe R entstanden sein, sprachlich dürfte diese aber nicht zur Nostratischen zu rechnen sein.
Die Y-Haplogruppe I dürfte etwas älter sein als R, jedenfalls lässt sie sich bereits zur Eiszeit in Europa feststellen, vielleicht ist es sogar die Einzige in Europa entstandene Gruppe. Nun gibt es bisher nur einige wenige Ergebnisse zu den Y-Haplogruppen im eiszeitlichen Europa, so wenige, dass sie kein wirklich statistisch greifbares Bild geben. Sicherlich wird es sehr interessant, was die weitere Erforschung 'archäologischer DNA' in der Zukunft bringt. Das Bild, was die wenigen bisherigen Resultate aufzeigen, ist noch hochgradig unsicher. Danach waren es wohl vor allem Träger der Y-Haplogruppe I die damals in Zentraleuropa gelebt haben, aber auch bis weit bis nach Osteuropa. Südlich von diesen dürften wohl G-Gruppen gelebt haben, genauer gesagt G2a, auf den südlichsten Enden Europas aber eher E3b bzw. J2 Gruppen vorgeherrscht haben. Ötzi selbst hatte die Y-Haplogruppe G2a, welche heute noch sehr stark bei den Georgiern verbreitet ist und bereits im Neolithikum in weiten Teilen Europas festgestellt werden kann. Man nimmt an, dass es sich dabei um Zuwanderungen von Ackerbauern handelt, dagegen spricht aber deren hohe Laktoseintoleranz, wahrscheinlich waren sie schon seit der Eiszeit in weiten Teilen Europas ansässig. Die Karte der heutigen Verteilung der Y-Haplogruppe G jedenfalls, mit seinen zahlreichen mittleren und stärkeren Hotspots im Süden Europas scheinen diese Möglichkeit zu bestätigen. Durch neolithische Einwanderungen (Ackerbauern) kann diese Verteilung eben nicht sinnvoll erklärt werden, da sie dann deutlich jünger wären und keine so lockere und unregelmäßige Verteilung heute aufweisen würden.
Abb. 5.: Verbreitung der Y-Haplogruppe G; Quelle © Eupedia.com, Autor Maciamo Hay
Heute gibt es in Europa neben den Y-Haplogruppen G, R und I, sowie den oben auch schon genannten J2 und E3b, N - heute vor allem in Nordosteuropa und Sibirien, Q - heute bei Germanen, aber vor allem bei Indianern, T - locker verteilt im südlichsten Europa, darüber hinaus im Nahen Osten bis hin nach Somalia und Bengalen. Alle diese Gruppen sind noch heute in Europa vorhanden, aber selbst zusammengenommen; erreichen sie nicht einmal annähernd die hohen Verteilungswerte, die die Y-Haplogruppe R in Europa aufweist.
Abb. 6.: Y-Haplogruppe I in Europa, Quelle © Eupedia.com, Maciamo Hay
Nun ist es leider so, dass sich die Verteilung der Y-Haplogruppen nur in einigen Fällen mit Völkern bzw. Sprachfamilien in Deckung bringen lässt. Der Stammbaum der Sprachen ist daher nicht deckungsähnlich mit dem der Y-Haplogruppen. Dies dürfte daran liegen, dass Sprachen einiger Y-Haplogruppen nicht bis in historische Zeit überlebt haben, als die, die man möglicherweise der Y-Haplogruppe R zuordnen könnte, jedenfalls bis auf das Baskische. Denn alle anderen Gruppen die zum Y-Haplogruppen-Komplex K gehören, sind vor allem eher östlich des Urals und Indiens zu finden.
Abb. 7.: Y-Haplogruppe I1 in Europa,Quelle © Eupedia.com, Maciamo Hay
Die Nostraten
In dem Zeitraum von vor 30.000 bis 60.000 Jahren dürften nicht nur die Grundlagen der heutigen Menschenrassen geschaffen worden sein, sondern auch die der verschiedenen Sprachgruppen. Rassen wie Sprachgruppen nahmen dabei Material aus den Altmenschengruppen auf – auf der einen Seite Gene, auf der anderen Wortschatz, Syntax und Grammatik. Dabei waren die Gebiete beider Gruppen nicht immer identisch, denn den Austausch zwischen benachbarten Randgruppen gab es nämlich schon immer, aber keine scharfen Abgrenzungen zwischen diesen - zumindest soweit die Natur keine solchen schuf in Form von Meeren, hohen Gebirgen, Eisschilden oder sonstigen Ödnissen.
Abb. 8.: Y-Haplogruppe I2a1 . Quelle © Eupedia.com, Autor Maciamo Hay
Die Träger der Y-Haplogruppe I dürften eine sogenannte nostratische Sprache gesprochen haben, genauer gesagt, eigentlich Nostratisch. Dieses spaltete sich bereits während der Eiszeit in verschiedene andere Gruppen. In Europa entstand dabei östlich des bis nach Niederschlesien vordringenden Eiskeils das Alteuropäische, auch deren Y-Haplogruppe entwickelte sich weiter zu I1. Der Eiskeil zog sich mehrfach während der Eiszeit zurück, um sich dann wieder vor zu schieben, den I-Leuten war es also möglich, auch nach Nordwesteuropa vorzudringen. Aber dennoch war es eine andere Gruppe, die Nordwesteuropa besiedelte, und zwar Träger der Haplogruppe I2a, welche dort zu I2a2 wurden. Auch sie sprachen wie die anderen I-Träger eine Nostratische Sprache. Das Piktische, eine bis ins frühe Mittelalter in Schottland gesprochene Sprache, wahrscheinlich auch nostratischer Herkunft, könnte möglicherweise die letzte bekannte Sprache der I2a2 Träger gewesen sein. Bis zum endgültigen Rückzug des Eiskeils dürfte es in Zentraleuropa mindestens zwei sich längst vom Nostratischen abgespaltene Sprachen gegeben haben, eine im Osten Zentraleuropas und eine im Nordwesten Europas.
Diese Alt-Nordwesteuropäer, damals noch lebend zwischen den deutschen Mittelgebirgen und dem nördlichsten Ende Schottlands, waren eher Abkömmlinge des eiszeitlichen Cro-Magnon. Auch in der Genetik lassen sich Spuren dieses, eher rundschädligen Volkes, an der Haplogruppe I2a2 (M223) festmachen. Interessant an I2a2 ist, dass sie ihren weltweiten Hotspot im Saale-Unstrut-Raum hat und sich sonst in seiner Verbreitung hauptsächlich auf Nordwesteuropa beschränkt.
Neben die den genannten Abspaltungen vom Nostratischen, gab es aber noch weitere. Die Abspaltung von Uralisch bzw. Altaisch sprechenden Gruppen (z. B. Japaner) dürfte vor 15.000 bis 20.000 Jahren erfolgt sein, der der Finno-Ugrier (z. B. Samen oder Ungarn) vor 10.000 bis 20.000 Jahren. Das Nostratische muss sich damals bis nach Sibirien und Jakutien hin ausgebreitet haben. Sprachlich also zum nostratischen Komplex gehörend, tun sie es nicht genetisch. Heute ist in beiden Gruppen die Y-Haplogruppe I kaum vorhanden, auch keine andere des IJ-Komplexes. Heutige Japaner und Finno-Ugrier besitzen vor allem Y-Haplogruppen aus dem K-Komplex, aber in der späten Eiszeit dürfte dies noch anders gewesen sein. Dann wurde aber ein Großteil der finno-ugrischen und der mit ihnen verwandten Völker von einer N1-Gruppe asiatisch umgeprägt, also dem heutigen asiatischen Gepräge angenähert. So kommt es auch, dass die modernen Finno-Ugrier den Sino-Tibetern (Y-Haplogruppe O) anthropologisch deutlich näher sind, als den typischen Europäern (bis auf Ungarn, Finnen und Esten). Ein Problem, welches wir auch mit der R-Gruppe haben und dessen Lösung ähnlich gelagert sein dürfte, aber dazu später mehr.
Abb. 9.: Y-Haplogruppe I2a2 , Quelle © Eupedia.com, Autor Maciamo Hay
Zwei uralte Abspaltungen von der Nostratischen Sprachfamilie sind die der Semitisch-Hamitischen und die der Dravidischen Sprachfamilie. Beide Abspaltungen müssen vor mehr als 35.000 Jahren stattgefunden haben, was sich auch in den Aufspaltungen der Haplogruppen widerspiegelt. Sicher gab es noch zahlreiche weitere Abspaltungen und Unterabspaltungen, die heute nicht mehr eruierbar sind. Außerdem muss klar sein, dass die Abspaltungen nicht absolut waren, sondern dass es in den Übergangszonen der einzelnen Gruppen weiterhin einen starken gegenseitigen Austausch gab. Bei den Alteuropäern ist dies vor allem mit den Finno-Ugriern feststellbar, in geringerem Umfang auch mit den Uralischen bzw. Altaischen Gruppen im Osten Eurasiens, und mit einigen Gruppen Nordafrikas, vor allem den Berberischen. Sprachlich gibt es aber auch eine uralte Verbindung zu den semitischhamitischen Sprachen, welche bis zu den oben erwähnten Zeiten einer einstigen Urheimat im Nahen Osten zurückreicht. All die eben genannten Sprachen gehören der Nostratischen Sprachfamilie an, zu welchen auch die Elamo-Draviden und Georgier gehören. Sie steht einer anderen Gruppe gegenüber, der Dene-Kaukasischen, zu welcher neben den Sprachen der Indianer und Ostasiaten, auch einige Sprachen des Kaukasus (z. B. Abchasisch oder Dagestanisch) gehören, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch das Baskische. Deren gemeinsame Zeit aber liegt in einer Zeit von vor ca. 60.000 Jahren, also dem Zeitalter, als diese Gruppen aus Afrika auswanderten und eine Zeitlang im Nahen Osten verharrten.
Erst frühestens mit dem Ende der Eiszeit, wahrscheinlicher aber deutlich später, dürften R-Gruppen nennenswert nach Europa geströmt sein. Sie müssen irgendeinen evolutionären Vorteil gegenüber den I-Trägern gehabt haben, denn binnen weniger Tausend Jahre gewannen sie in weiten Teilen Europas die Oberhand. Dabei drangen die R-Träger von Zentralasien kommend in zwei Gruppen vor. Die Gruppe R1a kam nördlich um das Kaspische Meer, die Gruppe R1b dürfte etwas südlicher gegangen sein. R1b ist heute sehr stark vertreten um das Kaspische Meer und Westeuropa, bei den Armeniern, aber auch am Tschadsee. Wenn nun die Basken heute eine überdurchschnittlich hohe R1b Verteilung aufweisen, andererseits diese sprachlich hauptsächlich zur Dene-Kaukasischen Gruppe gerechnet werden, wozu Chinesen, Indianer und Kaukasier gehören, können die R-Träger auch keine nostratische Sprache gesprochen haben. Gleiches gilt z. B. auch für Samen und Samojeden, welche auch eine nostratische Sprache sprechen, genetisch aber in Verwandtschaft zu den Dene-Kaukasiern gehören.
Die eiszeitlichen Europäerinnen
Anders als bei den Männern, also den Trägern der Y-DNA, zeigen die Frauen ein deutlicheres Bild. Hier gibt es deutlich bessere Resultate aus der DNA-Forschung bei der mütterlichen Mitochondrien-DNA (mtDNA). Neueste Untersuchungen an der mtDNA der Europäer zeigen auf, dass in der Eiszeit vor allem Träger der mt-Haplogruppen R, M, N, vor allem aber U und derer Untergruppen. Alle diese Gruppen sind heute eher gering unter den Europäern verbreitet, dennoch stammt ein großer Teil der heutigen Europäer in weiblicher Linie direkt von diesen Alteuropäern ab, die vor über ca. 35.000 Jahren aus dem Nahen Osten nach Mitteleuropa einwanderten. Heutzutage haben mehr als 40 % aller Europäer die mt-Haplogruppe H bzw. einer ihrer Untergruppen. Bei den Zentraleuropäerinnen ist der Prozentsatz noch höher. Der Rest verteilt sich vor allem auf die mt-Haplogruppen T1 und T2 (zusammen gut 10 % aller Europäer) und I, J, K, W, sowie die Gruppen U4 und U5 (alle um die 5 %). H und auch T sind aber wohl in Europa entstanden, die eine aus HV → R0 → R bzw. JT → R.
Die heutigen Basken unterscheiden sich bei den mt-Haplogruppen nur geringfügig von den anderen Europäern, allerdings lassen sich bei zwei mt-Haplogruppen gewisse Hotspots bei den Basken finden. Dies sind H1/H3, welche einen weiteren, aber viel deutlicheren Hotspot in Südskandinavien haben. Darüber hinaus U5, welche bei den südwestlichen Finno-Ugriern einen ebenso viel deutlicheren Hotspot hat. U5 tritt bereits bei den ältesten mtDNA-Funden Europas mit auf, zu einer Zeit, als Y-DNA R1b noch mit Sicherheit nicht in Europa ansässig war, damit wohl auch nicht die Vaskonen (Basken), da diese Westeuropa nicht vor 15.000 Jahren erreicht haben könnten. Ähnlich H1 und H3, diese entstammen über H und HV von R0 bzw. R, von welchem auch so alte Datierungen für Europa gemacht werden konnten, wie für U5. Tatsächlich müssen die beiden obengenannten mtDNA-Hotspots ein Zufall sein, auch wenn das historisch gesicherte Siedlungsgebiet der Basken früher viel größer war. Ein Sachverhalt, der sich aus den mtDNA-Verteilungskarten nicht so einfach herauslesen lässt. Daraus ist zu schließen, dass die Vaskonen zwar ihre Sprache und ihre Y-DNA mit nach Europa brachten, aber dabei sich vor allem hiesige Frauen nahmen. Irgend einen kleinen erblichen Vorteil müssen die Vaskonen, zumindest die vaskonischen Männer gehabt haben, dass sie ihre Haplogruppe so gut über Europa verbreiten konnten.
Die Alteuropäer
Das Ende der Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren dürfte auf den Menschen in Europa keine positiven Effekte gehabt haben, denn damals wurde es sehr schnell recht warm, bald war es in Mitteleuropa sogar deutlich wärmer als heute. Das an sich war natürlich nicht so schlimm, schlimm für den damaligen Menschen war aber, dass dadurch ebenfalls sein die Kühle liebendes Jagdwild - Mammuts, Pferde, Wisente … - verschwand, woran er wahrscheinlich selbst auch noch einen eigenen Anteil hatte. Die überaus schnell abschmelzenden Gletscher hatten ihre Wirkung auf den Meeresspiegel, besonders auf die Nord- und Ostsee, sowie das Schwarze und Kaspische Meer, welche sich in wenigen Jahrhunderten in ihren Ausmaßen massiv vergrößerten bzw. auch verkleinerten, andere wie der Persische Golf entstanden erst. Vor allem für die Nordsee ist dies bis heute noch nicht abgeschlossen. Möglich, dass die Sintflutlegenden einiger Völker aus diesen Geschehnissen stammen.
Abb. 10.: Verbreitung der Haplogruppe R1b; Quelle © Eupedia.com, Autor Maciamo Hay
In den archäologischen Befunden von vor 12.000 Jahren lässt sich für Mitteleuropa vielleicht keine Stagnation der Entwicklung, aber auch kein wirklicher Aufbruch feststellen – anders als zum Beispiel im Nahen Osten, Indien oder China. Erst vor 9.000 Jahren ist auch im südlichen Europa ein zivilisatorischer Fortschritt festzustellen und dieser strahlt später auch nach Mitteleuropa aus.