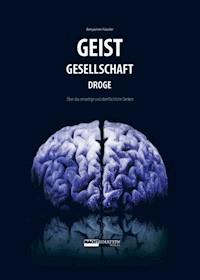
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nachtschatten Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anhand der beiden grundlegenden Denkformen, des 'linkshemisphärischen' Verstandes und der 'rechtshemisphärischen' Intuition wird aufgezeigt, dass die Probleme unserer Zivilisation auf einem 'erkenntnistheoretischen' Grundproblem basieren: Das einseitige, auf das verstandesmässige konzentrierte Denken, das zudem noch sehr oberflächlich und durch Vorurteile beherrscht erfolgt. In einer umfassenden Analyse werden die Aspekte des Verstandes und der Intuition besprochen. Bei Letzterer werden vor allem das Unbewusste und die veränderten Bewusstseinszustände mit ihren verschiedenen Aspekten wie Traum, Meditation und drogeninduzierten Zuständen beleuchtet. Dazu werden Beispiele wie die Kreativität, die Mythen und der Schamanismus herangezogen. Erkenntnisse aus der Hirnforschung verhelfen uns, diese Aspekte zusammen mit der Funktion der Gefühle zu einem Ganzen zu vereinigen. Des Weiteren wird aufgezeigt, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte das Übergewicht des vielfach unkorrekt durchgeführten Verstandes-Denkens und die daraus sich ergebenden Folgen zustande gekommen sind. Schliesslich wird zur Illustration der Ausführungen die Drogenpolitik herangezogen, die wie kaum ein anderes Thema das einseitige und oberflächliche Denken aufzeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benjamin Fässler
GEIST
GESELLSCHAFT
DROGE
Über das einseitige und oberflächliche Denken
Benjamin Fässler
GEIST
GESELLSCHAFT
DROGE
Über das einseitige und oberflächliche Denken
IMPRESSUM
Verlegt durch:
NACHTSCHATTEN VERLAG AG
Kronengasse 11
CH-4502 Solothurn
Tel +41 32 621 89 49
Fax +41 32 621 89 47
www.nachtschatten.ch
www.nachtschattenverlag.ch
© 2008 Benjamin Fässler und © 2008 Nachtschatten Verlag
Grafik / Typografie: Sven Sannwald, Barbara Blankart, Solothurn
Lektorat: Erick van Soest, Solothurn
Druck: Druckerei&Verlag Steinmeier GmbH, Deiningen
Printed in Germany
ISBN 978-3-03788-138-5eISBN 978-3-03788-257-3
Wir danken der Gemeinde Feldbrunnen und der Bertold-Suhner-Stiftung (Herisau) für ihre grosszügige finanzielle Unterstützung.
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronischer digitaler Medien und auszugsweiser Nachdruck nur unter Genehmigung des Verlages erlaubt.
INHALTSVERZEICHNIS
Impressum
Vorwort von Albert Hofmann
Vorwort des Autors
Einleitung
ERSTER TEIL: GEIST UND GESELLSCHAFT
1. Zwei Wege zur Erkenntnis: RATIO und INTUITION
Die Arbeitsmethode
Informationsquelle und Bewusstseinszustand
Der Umgang mit der Welt
Das Paradigma
2. Die RATIO
Allgemeines zur Evolution
Die stammesgeschichtliche Entwicklung der RATIO
Grundprinzipien und Grundstrukturen
Von den Reflexen zum ratiomorphen Apparat
Vom ratiomorphen zum rationalen Denken
Die Entwicklung von Bewusstsein, Denken und Sprache
Bemerkungen zur RATIO
Die individuelle Entwicklung der RATIO
Die Problematik des „Angeborenen”
Die Entwicklung der Intelligenz des Kindes
Das Denken der „Primitiven”
3. Die INTUITION
Das Unbewusste
Sigmund Freud und das persönliche Unbewusste
C.G. Jung und das kollektive Unbewusste
Das transpersonale Unbewusste
Stanislav Grof und die perinatalen Matrizen
Aussergewöhnliche Bewusstseinszustände
Spontane aussergewöhnliche Bewusstseinszustände
Provozierte aussergewöhnliche Bewusstseinszustände
Gemeinsamkeiten aussergewöhnlicher Bewusstseinszustände
Ansichten über Rausch und Ekstase
Der Traum
Der Nacht- oder Schlaftraum
Der Tagtraum
Die Kreativität
Mythen, Märchen und Rituale
Die Mythen
Die Märchen
Die Rituale
Der Schamanismus
Ansichten über „Primitive” und „ Wilde”
Die Schamanen
Erfahrungen in Todesnähe
Ansichten über Sterben und Tod
Nah-Tod-Erfahrungen (NTE)
Erfahrungen Sterbender
Mystik, Spiritualität und Meditation
4. Die Gefühle
Herkunft und Bedeutung der Gefühle
Über die Seele
5. Die Ganzheit des Menschen
Erkenntnisse aus der Hirnforschung
Aufbau und Grundfunktionen des Gehirns
Entwicklung und Reifung des Gehirns
Die Wahrnehmung
Die Rolle der Gefühle
Über Stress
Bewusstsein und Unbewusstes
Linke und rechte Hemisphäre
Hirn und Geist
Die Ganzheit des Geistes
Die Ganzheit des Organismus
Die Einheit mit der Mitwelt
6. Über Wahrheit
Wahrnehmung und Wahrheit
RATIO und Wahrheit
Sprache und Wahrheit
Die Konstruktion der Wahrheit
Wissenschaft und Wahrheit
INTUITION und Wahrheit
ZWEITER TEIL: DER WANDEL VON GEIST UND GESELLSCHAFT
7. Eine kleine Religions- und Kulturgeschichte
Von der Steinzeit zum Christentum
Aspekte des Christentums
8. Über Selbstverwirklichung und die moderne Gesellschaft
Die verhinderte Selbstverwirklichung
Aspekte der modernen Gesellschaft
Die sekundäre Selbstverwirklichung
9. Unser Umgang mit dem Drogenthema
10. Über Drogen
Definition und Herkunft der Drogen
Wirkung und Gefahren der Drogen
Dämpfende Drogen
Stimulierende Drogen
Psychedelische Drogen
Die Motive zum Drogenkonsum
11. Drogen gestern
Drogen in der frühen Kulturgeschichte
Drogen in der westlichen Zivilisation
12. Drogen heute und morgen
Das heutige Drogenproblem
Wie weiter?
Über den Autor
Quellenverzeichnis
VORWORT VON ALBERT HOFMANN
An dieser Stelle sei das Vorwort wiedergegeben, das Albert Hofmann zu meinem Buch „Drogen zwischen Herrschaft und Herrlichkeit“ geschrieben hat. Dies einerseits darum, weil das Grundthema im Prinzip dasselbe ist wie im neuen Buch „Geist – Gesellschaft – Droge“, nur dass hier die Gewichtung der einzelnen Themen stark geändert wurde. Andererseits soll es eine Hommage an Albert Hofmann sein, den grossen Forscher, Denker und Menschen, der kürzlich im 103. Lebensjahr verstorben ist.
Im vorliegenden Buch, das sich zur Hauptsache mit dem Drogenproblem befasst, sind zwei erkenntnistheoretische Kapitel vorangestellt, »Über Erkenntnis und Wahrheit« und »Über Selbstverwirklichung und spirituelle Wege«, die mit Bezug auf die Drogenproblematik abgefasst sind. Sie liefern eine Basis, von der aus der grosse Fragenkomplex rund um die Drogen tiefer begründbar, sozusagen von höherer Warte behandelt werden kann. Das ist von grosser Bedeutung, denn nur allzuhäufig werden Drogendiskussionen von einem engen, von persönlichen Interessen bestimmten Standpunkt aus geführt und ergeben daher nur selten sachlich begründete Resultate, die allgemein anerkannt werden können. Das gilt nicht nur für Diskussionen auf dem Gebiet der Drogen, sondern fast überall, wo es um die Allgemeinheit betreffende Probleme geht. Es kann daher nicht genug auf die Notwendigkeit der Beachtung der von Menschenmeinung unabhängigen, natürlichen Gegebenheiten und Wahrheiten hingewiesen werden und auf die Notwendigkeit der immer wieder und überall zu stellenden Sinnfrage.
Wenn man die Sinnfrage in ihrer allumfassenden Bedeutung stellt, nämlich die Frage nach dem Sinn unserer menschlichen Existenz, dann, glaube ich, kann man sie auf eine Art beantworten, die allgemeine Zustimmung finden dürfte. Alle grossen Religionen und Philosophien sind im Grunde aus der Suche nach dem Sinn der Schöpfung und dem Sinn des menschlichen Lebens hervorgegangen, und sie geben auch eine Antwort auf die allesumfassende Sinnfrage. Die Antworten, so verschieden sie sind, enthalten alle ein Glücksversprechen: Das Glück der ewigen Seligkeit im christlichen Himmel, das Glück im sinnenfrohen Paradies des Islam, das irdische Glück der Epikuräer. Und schon vor über 2000 Jahren stellte Aristoteles an den Anfang seiner Nikomachischen Ethik die Frage: Was suchen die Menschen? – und er befand: Sie suchen Glück als höchstes Gut und letztes Ziel.
Auch bei den Philosophen der Neuzeit geht es letztlich um die Suche nach Glück und Sinn. Um nur einen der modernen Philosophen zu zitieren, Ludwig Markuse kommt in der Einleitung seines Buches »Philosophie des Glücks, zum Schluss: »Wer aber auf das Glück verzichtet, erfüllt sein Dasein nicht.« Was Religionsgründer und Philosophen vom letzten Sinn unseres Daseins sagen – Glück sei Sinn und Endziel unseres Lebens – muss wahr sein, denn der gegenteiligen Verkündigung – der Sinn unseres Lebens sei, unglücklich zu sein – könnte wohl niemand beistimmen. Es gibt zwei Bereiche, in denen die Menschen das Glück suchen, im Bereich des Habens oder des Seins, auf materiellem oder auf spirituellem Gebiet. Heute wird, vor allem in der westlichen Welt, das Glück hektisch im Haben gesucht, im materiellen Besitz; mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt immer mehr Reiche und Superreiche, aber kaum immer mehr Glückliche; auf der anderen Seite aber immer mehr arme, gar im Elend lebende Menschen, die meistens sehr unglücklich sind. Was hat die Anhäufung von Geld, und damit Macht, bei Einzelpersonen oder Konzernen, die keine Verantwortung tragen für das öffentliche Wohl, für einen Sinn? Die Verantwortung für das öffentliche Wohl liegt beim Staat, zum Beispiel die Sorge um die Arbeitslosen. Der Staat hat aber keine Macht in der Wirtschaft, von der das Wohl der Bevölkerung entscheidend abhängt. Verantwortung und Macht triften heute immer mehr auseinander, mit katastrophalen Folgen. Die Frage nach Sinn in der heutigen Entwicklung im Hinblick auf Menschenglück ist unschwer zu beantworten.
Was ist Glück? Glück lässt sich wissenschaftlich nicht definieren. Es ist ein Letztes, nicht weiter Erklärbares. Glück lässt sich nur umschreiben, als ein besonderer Zustand des menschlichen Bewusstseins. Glück gehört in die Kategorie des Seins. Es ist also nicht etwas, das man haben kann. Was man auf der Suche nach Glück sucht, ist in Wirklichkeit nicht das Glück selbst, sondern man sucht das, von dem man glaubt oder hofft, dass es uns glücklich macht. Was die Ursache von Glück sein könnte oder sein sollte, darüber ist schon seit der Antike diskutiert worden. Von den Ansichten über: Was ist Glück? – oder eben richtiger, über das, was glücklich macht, möchte ich aus unserer Zeit nur eine herausgreifen, jene des Philosophen, der zwar selber nicht glücklich war, der aber sehr tief über das Wesen der menschlichen Existenz und über das Glück nachgedacht hat, jene von Friedrich Nietzsche. Er schrieb: »Das Glück des Menschen beruht darauf, dass es für ihn eine undiskutierbare Wahrheit gibt.«
Früher, in vielleicht glücklicheren Zeiten, galten die Dogmen der Kirchen als undiskutierbare Wahrheiten. Heute sind es die Ergebnisse der Naturwissenschaft, die als undiskutierbare Wahrheiten gelten, und die das alte, religiöse Weltbild unglaubwürdig gemacht haben. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse erwiesen ihre Wahrheit dadurch, dass sie sich praktisch anwenden liessen. Sie bildeten die Basis, auf der sich alle die Technologien und Industrien aufbauten, die zum materiellen Reichtum und Komfort der westlichen Welt geführt haben. Das naturwissenschaftliche, einseitig materialistische Weltbild ist zum Mythos unserer Zeit geworden. Dieses Weltbild ist zwar undiskutierbar wahr, aber es beinhaltet nur die eine Hälfte der Wirklichkeit, nur ihren materiellen, messbaren Teil; alle physikalisch und chemisch nicht fassbaren Dimensionen des Daseins, zu denen die wesentlichen Merkmale des Lebens gehören, fehlen: Liebe, Freude, Schönheit, Schöpfergeist sind weder wäg- noch messbar, sind also im materialistischen naturwissenschaftlichen Weltbild nicht vorhanden. Das materialistische Weltbild beruht auf einem folgenschweren Dualismus, auf einer Weltsicht, in der sich der Mensch als getrennt von der Umwelt erlebt. Ein solches dualistisches Welterleben hat sich zuerst in Europa herausgebildet. Es war schon wirksam im jüdisch-christlichen Weltbild: Ein über der Schöpfung thronender Gott, sein »Macht euch die Erde Untertan…«. Die Naturwissenschaften sind ein Produkt des europäischen Geistes. Sie bildeten die Grundlagen für die Entwicklung von Technik und Wissenschaft und der sich darauf aufbauenden weltweiten Technisierung und Industrialisierung. Die dualistische, titanenhafte Einäugigkeit, die nur noch das von Menschenhand Gemachte sieht und als die eigentliche Wirklichkeit betrachtet, ist die Grundursache der heutigen weltweiten ökologischen, ökonomischen, sozialen und geistigen Probleme und Krisen. Eine solche einseitig materialistische Weltsicht entwickelt sich besonders in einer toten, technischen Umwelt in den grossen Städten, und sie wächst mit ihnen. Es wäre sinnlos und dumm, wenn man die Wirklichkeit von all dem, was man täglich erlebt und durch die Massenmedien zu hören und zu sehen bekommt, bestreiten würde. Es stellt aber, wie schon erwähnt, nur die Hälfte der menschlichen Wirklichkeit dar. Was daher heute dringend notwendig, not-wendend ist, ist ein heller, klarer Blick, mit dem wir der Ganzheit der Welt und des Lebens und unseres Eingebundenseins gewahr werden. Wer offene Augen und ein offenes Herz hat, sieht auf unserem wunderbaren Raumschiff trotz grosser Zerstörung immer noch ursprüngliches Leben: Die geheimnisvolle Welt der Ozeane, die begrünten Kontinente und die Schönheit ihrer wundervollen Geschöpfe der Pflanzen- und Tierwelt. Aber meistens schauen wir mit trüben Augen und mit durch Gewohnheit abgestumpften Sinnen in die Welt, erkennen nur noch den von Menschenhand geschaffenen Teil der Wirklichkeit und suchen in ihr, wie in einem selbst angefertigten Mandala, Glück und Sinn. Blickten wir doch besser in den Kelch einer Blume, einer Blüte, die an Vollkommenheit und Schönheit alles von Menschen Erzeugte tausendmal übertrifft, denn sie ist mit Leben erfüllt; vom gleichen Leben wie der Schauende; und beide, der Schauende und was er betrachtet, sind Manifestationen des einen, gleichen Schöpfergeistes. Als Augenöffner, als Hilfsmittel, um die Fähigkeit eines vertieften, visionären Erlebens der Wirklichkeit zu erlangen, sind die verschiedenen Methoden der Meditation entwickelt worden: Yoga, Fasten, Atemübungen, Isolation und so weiter.
Besonders wirkungsvoll lässt sich die Meditation durch Zuhilfenahme von entheogenen Drogen gestalten, denn die pharmakologische Wirkung dieser Psychopharmaka besteht in einer enormen Steigerung der Sinnesempfindungen, vor allem des Sehens und Hörens und in einer Veränderung des Bewusstseins im Sinne einer Erweiterung und Steigerung der Sensibilität. Weil dabei die Höhen und Tiefen des Seins in ungewohnter Intensität erlebt werden, besteht die Gefahr, dass das Erlebte nicht sinnvoll ins Bewusstsein integriert werden kann. Der Gebrauch entheogener, oder wie sie auch genannt werden, psychedelischer Drogen ist daher in alten Kulturen stets in einen religiös-zeremoniellen Rahmen eingebaut worden. Dann kann das Erlebnis zu dem werden, wonach der Mensch seit jeher im Tiefsten sucht, zur unio mystica und der damit verbundenen Glückseligkeit. Die auf Meditation beruhende Entfaltung von persönlicher Religiosität, die durch die Anwendung entheogener Drogen unterstützt werden kann, beginnt den kirchlichen Glauben zu ersetzen. Das alte religiöse Weltbild, das auf dem Glauben an Dogmen beruht, verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit, weil es, wie schon ausgeführt, der objektiven Wahrheit und Wirklichkeit, die von der Naturwissenschaft erschlossen wurde, widerspricht.
Der evolutionäre Sinn der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse besteht daher wahrscheinlich nicht in erster Linie darin, dass sie die Grundlagen für die weltweite Technisierung und Industrialisierung lieferten, sondern dass sie das Bild der universell gültigen materiellen Wirklichkeit enthüllten, das bei meditativer Betrachtung und Erleuchtung transzendiert und zur Grundlage einer neuen universalen Geistigkeit werden könnte.
Publikationen wie das vorliegende Buch, die die Rolle der entheogenen Drogen in diesem Prozess darlegen, verdienen daher grosse Verbreitung und Beachtung.
Albert Hofmann
VORWORT DES AUTORS
Nachdem mein erstes Buch „Drogen zwischen Herrschaft und Herrlichkeit“ bald vergriffen war, trug ich mich lange mit dem Gedanken, das Buch nach den notwendigen Korrekturen neu herausgeben zu lassen. Irgendwann reifte dann die Überzeugung, dass das Buch mit einer völlig anderen Gewichtung neu geschrieben werden sollte. Und zwar sollte das Hauptgewicht auf den „erkenntnistheoretischen“ Teil, nämlich auf das Verhältnis zwischen Verstand und Intuition, insbesondere auf das einseitige und oberflächliche Denken gelegt werden und das Drogenthema sollte nur noch als kurze Illustration des Grundthemas dienen. Nach erneutem intensiven Literaturstudium wurde dann das Buch völlig neu umgearbeitet. Dabei fanden verschiedene im ersten Buch besprochene Themen wieder Eingang, wurden aber stark erweitert. Zudem wurden einige neue Aspekte eingeführt, die das Grundthema näher zu beleuchten im Stande sind.
Auf die ständige Aneinanderreihung männlicher und weiblicher Formen wurde bei Personen ebenso verzichtet als auf die etwas mühsame Formulierung wie etwa „LeserInnen“ – wo nicht besonders erwähnt, sind natürlich die Frauen auch mitgemeint. Um den Lesefluss nicht zu sehr zu behindern, wurden die an den hochgestellten Zahlen ersichtlichen Quellenangaben nur relativ spärlich eingestreut – vor allem an wichtigen Stellen und bei Zitaten. Die interessierte Leserschaft kann sich im ausführlichen Literaturverzeichnis am Ende des Buches einen Überblick über die Quellen verschaffen. Ich habe mich bemüht, möglichst wenige wissenschaftliche Fremdwörter zu benutzen und wo es nicht zu umgehen war, diese zu erklären bzw. zu beschreiben. Obwohl das bildhafte Element in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt, musste leider auf Bilder verzichtet werden, da das Buch sonst viel zu umfangreich geworden wäre.
Ohne eine finanzielle Fremdunterstützung hätte dieses Buch nicht erscheinen können. Hauptsponsor ist meine Wohngemeinde Feldbrunnen, und einen namhaften Betrag hat auch die Bertold-Suhner-Stiftung (Herisau) aus meinem Heimatkanton geleistet. Diesen Institutionen bin ich für ihre Unterstützung zu grossem Dank verpflichtet.
Einen herzlichen Dank gebührt auch meinen Freunden Max Schreier, Bruno Rossi und Rolf Bühler, die das Manuskript gelesen und mir viele wertvolle Rückmeldungen und Anregungen gegeben und bei der Korrekturlesung mitgeholfen haben. Ein besonderer Dank geht auch an meinen Lektor, Erick van Soest, mit dem mich eine angenehme Zusammenarbeit verband und dessen Arbeit weit über die übliche Lektoratsarbeit hinausging. Schliesslich danke ich auch dem Verlegerteam Roger Liggenstorfer und Barbara Blankart für die Herausgabe des Buches.
Benjamin Fässler
EINLEITUNG
Hauptthema dieses Buches ist der menschliche Geist, wobei „Geist“ bzw. „geistig“ – analog zum englischen „mind“ bzw. „mental“ – mit „Psyche“ bzw. „psychisch“ gleichgesetzt wird. Nach dem hier verwendeten Konzept besteht der Geist oder die Psyche aus drei Anteilen: aus dem Verstand oder der Ratio, aus der Intuition und aus den Gefühlen. Diese drei Teile sind nicht nur untrennbar miteinander verwoben, sondern auch in engem Wechselspiel mit der Umwelt, insbesondere mit der menschlichen Gesellschaft verknüpft.
Die Kernthese des Buches besteht darin, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten und Möglichkeiten viel zu wenig ausschöpfen und vor allem unausgewogen nutzen. Die gewaltigen Probleme unserer modernen Welt, vornehmlich die ökologischen und gesellschaftlichen Probleme, haben ihre Wurzeln im einseitigen und oberflächlichen Denken. Einseitig ist das Denken, weil keine Harmonie zwischen der Ratio und der Intuition besteht, sondern vielmehr das Hauptgewicht auf dem Verstandesmässigen liegt und das intuitive Element stark verkümmert ist – hinzu kommt ein vielfach mangelhafter bewusster Umgang mit den Gefühlen. Oberflächlich ist das Denken, weil das Rationale oft nicht korrekt durchgeführt wird, was bedeutet, dass es häufig kein sorgfältiges, hinterfragendes Denken, sondern ein automatenhaftes und stark durch Vorurteile beherrschtes Denken ist.
Um diese These zu untermauern, werden Wesen und Funktionsweise der psychischen Elemente – Ratio, Intuition und Gefühle – zunächst mehr oder weniger voneinander getrennt in ausführlicher Weise besprochen, um dann wieder zu einer Einheit, zur Ganzheit des Menschen, zusammengefügt zu werden. Im Weiteren wird gezeigt, wie sich – in groben Zügen betrachtet – im Laufe der Zeit ein Wandel in Geist und Gesellschaft vollzogen hat, in dem der Verstand immer mehr die Oberhand über die Intuition gewonnen hat. Die gewandelte Denkweise bewirkte zunehmende Veränderungen im Handeln der Menschen, was in der Folge zu den immer grösser werdenden Problemen führte. Das oberflächliche und einseitige Denken lässt sich schliesslich am Drogenthema und hauptsächlich an der Drogenpolitik eindrücklich illustrieren.
Obwohl ein ganzes Kapitel dem Thema „Wahrheit“ gewidmet ist, sei hier schon die Überzeugung ausgesprochen, dass es für uns keine absolute Wahrheit, sondern nur verschiedene relative Wahrheiten, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Das gilt natürlich auch für all das in diesem Buch Vorgebrachte. Für praktisch alle hier dargelegten Sichtweisen gibt es auch andere Ansichten – naturgemäss musste eine Auswahl getroffen werden, die natürlich subjektiv ist: meine Auswahl. Die Leserinnen und Leser sind eingeladen, sich in die dargelegten Ansichten zu vertiefen und herauszufinden, wo für sie „etwas dran“ ist und sich gegebenenfalls näher damit zu befassen. Auch werden keine Patentrezepte vorgelegt, vielmehr werden alle Interessierten dazu angehalten, eigene Erfahrungen zu machen: Selber intensiv wahrzunehmen, eigenständig und sorgfältig zu denken, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und all die Bereiche der Intuition selber zu erfahren – um dann daraus eigene Schlüsse und Konsequenzen zu ziehen.
Für jeden Menschen, der sich anschickt, ein Handwerk zu erlernen, dürfte es selbstverständlich sein, sich als Erstes mit den dazu notwendigen Werkzeugen vertraut zu machen, das heisst deren Funktionsweise und Anwendungsbereich kennenzulernen. Es ist nicht einzusehen, warum dies nicht auch im Bereich der geistigen Werkzeuge gelten sollte. Will man seinen Erkenntnis- und Denkapparat richtig einsetzen, müssen auch dessen Funktionsweise und dessen Grenzen bekannt sein. Und damit sollten sich eigentlich alle Menschen befassen, denn jeder braucht ständig seine geistigen Werkzeuge. Aus diesem Grund sollen in den folgenden Kapiteln diese Werkzeuge eingehend behandelt werden.
Angesichts der Vielfalt und der Komplexität der Themen können verschiedene Themen nur angeschnitten werden; auch werden gewisse Vereinfachungen nicht zu umgehen sein.
Ich habe mich dabei um oberflächliche Genauigkeit, um genaue Oberflächlichkeit bemüht. Ebenso muss betont werden, dass wir in gewissen Bereichen – etwa bei der Psychologie von Tieren oder unserer Vorfahren – vielfach auf Mutmassungen angewiesen sind. Auch wenn es sich nicht um „gesicherte Erkenntnisse“ handelt, sind es doch Vorstellungen, wie es sein oder gewesen sein könnte.
ERSTER TEIL:GEIST UND GESELLSCHAFT
1. Zwei Wege zur Erkenntnis: RATIO und INTUITION
An den Beginn dieses Kapitels seien fünf Beispiele gestellt, die erahnen lassen, was mit den zwei Wegen zur Erkenntnis gemeint ist. Die Beispiele werden zunächst nur kurz oder überhaupt nicht kommentiert, sodass die Leserinnen und Leser sich ihre eigenen Gedanken dazu machen können. Im weiteren Verlaufe wird dann auf diese Beispiele zurückzukommen sein.
Beispiel 1:
b)
Zeichnung: Claudia Jossi
Bei 1a), der Rechenaufgabe, gelangen wir zur Lösung, indem wir schrittweise logisch denkend vorgehen. Bei 1b), der Abbildung der Mickey Mouse hingegen, erkennen wir diese Figur schlagartig – sofern sie uns bekannt ist.
Beispiel 2: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“
Beispiel 3: „Das Herz öffnen“
Für den Herzchirurgen bedeutet dieser Satz, das körperliche Organ „Blutpumpe“ mit dem Skalpell aufzuschneiden – für den Verliebten, den Dichter und für den Mystiker bedeuten diese Worte etwas völlig anderes…
Beispiel 4: „Die Welt besteht nicht aus Atomen, sondern aus Geschichten.“
Beispiel 5: Was ist nun wahr: Die naturwissenschaftliche Evolutionstheorie oder die Schöpfungsgeschichte der Bibel?
Hirnforschungen des letzten Jahrhunderts haben ergeben, dass die linke und die rechte Hirnhemisphäre unterschiedlich funktionieren, dass der Mensch so etwas wie ein „Zwei-Geist-Wesen“ ist. Ganze Listen gegensätzlicher Funktionen der beiden Grosshirn-Hemisphären wurden aufgestellt. Mit der Zeit erkannten die Wissenschaftler, dass das Trennende und Andersartige der beiden Hirnhälften bis hin zum „gespaltenen Bewusstsein“ allzu stark betont worden war. Wohl bestehen gewisse Unterschiede zwischen den Funktionen der beiden Hemisphären, doch besitzen beide auch Eigenschaften ihrer „Gegenseite“, vor allem aber muss die sich ergänzende, gegenseitig abhängige Zusammenarbeit beider Hemisphären hervorgehoben werden: Das Hirn ist ein untrennbares Ganzes. So ist es sinnvoller, nicht von zwei gegensätzlichen Hemisphären, sondern von zwei verschiedenen Arten des Denkens zu sprechen. Dabei ist hier der Begriff des Denkens in einem umfassenderen Sinne als sonst üblich gemeint: Er umfasst nicht nur die logischrationale Tätigkeit, sondern die gesamte psychische Tätigkeit, die zu einer Erkenntnis führt – und das Ziel des Denkens ist ja Erkenntnis.
Die beiden Arten des Denkens werde ich mit zwei Begriffen belegen, welche ebenfalls in einem weiter gefassten Sinne als allgemein üblich zu verstehen sind und deswegen gross geschrieben werden sollen: RATIO* („linkshemisphärisch“) und INTUITION* („rechtshemisphärisch“). Und wenn doch hin und wieder von links- oder rechtshemisphärischem Denken die Rede sein wird, so sollen diese Begriffe in Anführungszeichen gesetzt werden, um daran zu erinnern, dass es sich um unterschiedliche Denktypen handelt, die nicht einfach einer Hirnhälfte zugeordnet werden können. Im Grunde genommen ist es nicht einmal korrekt, die RATIO der linken und die INTUITION der rechten Hemisphäre zuzuordnen, denn dies stimmt nur etwa für zwei Drittel der Menschen196.
Die psychischen Vorgänge, die wir Denken nennen, gehen im Spannungsbereich zweier Pole vonstatten, nämlich der beiden Grundtypen des Denkens: RATIO und INTUITION. Wir werden diese beiden Begriffe nicht genau definieren, da jede genaue Definition* den Fehler in sich birgt, künstliche Grenzen zu ziehen und damit natürliche Zusammenhänge zu zerreissen. Vielmehr werden wir die beiden Begriffe näher erläutern, indem wir sie einander gegenüberstellen und sie beschreibend umkreisen. Dies bietet auch Gelegenheit, einige wesentliche Grundbegriffe in groben Zügen zu beleuchten – verschiedene Themen werden später dann ausführlicher zur Sprache kommen. Bei der Gegenüberstellung der beiden Denktypen werden wir sehen, dass nicht nur die „linkshemisphärische“ und die „rechtshemisphärische“ Funktion, sondern auch RATIO und INTUITION nicht klar zu trennen sind, was wiederum Ausdruck dessen ist, dass die beiden Denkformen nicht einfach Gegensätze sind, sondern sich zueinander komplementär verhalten, sich gegenseitig zu einem Ganzen ergänzen.
RATIO
INTUITION
ARBEITSMETHODE
linear-sukzessivanalytisch dualistisch-polar
simultan-synthetisch holistisch monistisch
Sprache, Begriffe
Bilder, Symbole, Metaphern
digital
analog
BEWUSSTSEIN
„Normal-Bewusstsein“
„Aussergewöhnliche Bewusstseinszustände“
QUELLE
Aussen (Sinnesorgane)
Innen (Unbewusstes)
UMGANG MIT DER WELT
„Haben“, „Macher“ Überleben
„Sein“ Leben
PARADIGMA
Altes Paradigma
Neues Paradigma
Die Arbeitsmethode
Das erste Unterscheidungsmerkmal der beiden Denkformen zeigt sich in der Arbeitsmethode, in der Art und Weise, wie die Inhalte des Denkens verarbeitet werden. Eine der Grundbedeutungen des lateinischen Wortes „ratio“ ist „Rechnung, Berechnung“. Die RATIO ist also eine Art der Verrechnung, sie ist die Art und Weise, wie Informationen verrechnet oder behandelt werden, also eine Art des Denkens. Und diese Verrechnungsart besteht darin, dass sie die Informationen linear und sukzessive, das heisst in einer Linie und Stück um Stück, Schritt um Schritt verarbeitet. Damit ist verbunden, dass dies analytisch geschieht, das heisst die Informationen werden zergliedert, in einzelne Teile zerlegt, wodurch Grenzen gezogen werden.
Diese Vorgehensweise zeigt sich nicht nur beim eigentlichen Denkprozess, sondern schon bei der Wahrnehmung, insbesondere beim Vorgang des Sehens. Betrachten wir beim obigen Beispiel 1 die dargestellte Rechenaufgabe, so wandert unser Augenmerk schrittweise von einem Zeichen zum nächsten, bis wir schliesslich zur Lösung gelangen.
Für das lineare Denken ist charakteristisch, dass es ein „Wenn-dann-Denken“ ist: Wenn etwas so ist, dann folgt daraus, dass… Es ist ein monokausales* Denken, das nur eine Ursache in Betracht zieht. Damit ist oft auch ein besonderer, starrer Wahrheitsanspruch verbunden, indem nur eine Wahrheit gilt, was den Boden für Intoleranz darstellt.
Das sukzessive Element, das heisst das schrittweise, nach und nach sich vollziehende Vorgehen dieses Denktyps bedeutet, dass der Erkenntnisvorgang Zeit benötigt.
Das analytische Moment zeigt sich besonders augenfällig in den modernen Naturwissenschaften. Die Welt wird in immer kleinere Teile aufgeteilt: Wie mit einem Teleobjektiv richtet sich der scharfe Blick auf die einzelnen Details. Bei dieser streng fokussierten Sichtweise besteht die Gefahr, dass die Beziehungen zwischen den Teilen übersehen werden und die Übersicht auf das Ganze verloren geht.
Die INTUITION geht einen anderen Weg: Sie verarbeitet die Informationen simultan, also gleichzeitig, und synthetisch*-holistisch*, also ganzheitlich, was bedeutet, dass die Informationen zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Wiederum kann dies auch an der Wahrnehmung beim Beispiel 1 illustriert werden, und zwar am Bild der Mickey Mouse. Der Blick wandert nicht von einem Detail zum anderen. Vielmehr wird die Figur als Ganzes auf einen Schlag erkannt – vorausgesetzt natürlich, dass man sie überhaupt kennt.
Der „rechtshemisphärische“ Denktyp zerlegt nicht in Teile, sondern fügt Teile zu einem übergeordneten Ganzen zusammen, er nimmt Ganzheiten, Zusammenhänge, Beziehungen, Muster, Gestalten wahr.
Zum Beispiel 2: Der Ausspruch „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, der auf Aristoteles (384 bis 322 v. u. Z.) zurückgeht, soll an einem Beispiel veranschaulicht werden: Gibt man mehreren Künstlern je hundert weisse und schwarze Mosaiksteine mit dem Auftrag, damit ein Bild zu schaffen, bleibt die Summe der Mosaiksteine jeweils dieselbe – die erarbeiteten Bilder dürften sich aber deutlich voneinander unterscheiden. Je nach der Anordnung der Steine innerhalb der Fläche des jeweiligen Mosaiks ergibt sich ein anderes Muster, ein anderes Ganzes. In diesem Ganzen sind also nicht nur die Summe aller Teile, sondern auch deren Beziehungen zueinander enthalten – das „Mehr“ ist nicht quantitativer, sondern qualitativer Natur. Das Vorgehen der INTUITION ist kein lineares, monokausales „Wenn-dann-Denken“, sondern es erkennt – oder „erspürt“ – Beziehungen, vielfältig verbundene Ursache-Wirkungsnetze und damit anerkennt es auch, dass es viele Wahrheiten gibt, was die Grundlage für Toleranz darstellt.
Ein besonderes Merkmal der INTUITION besteht darin, dass der Erkenntnisvorgang keine Zeit benötigt, das heisst, dass er plötzlich geschieht. Wir kennen diese Plötzlichkeit des Auftauchens der Erkenntnis beim „Ah-Erlebnis“ durch das Überwältigtwerden von etwas sehr Schönem, beim „Aha-Erlebnis“ des plötzlichen Bescheidwissens und beim „Haha-Erlebnis“ beim Verstehen eines Witzes. Obwohl der Begriff einen negativen, „esoterischen“ Beigeschmack hat, kann durchaus von „Erleuchtung“ gesprochen werden, zumal man ja gerne sagt: „Es ist mir ein Licht aufgegangen“. Dies ist nicht nur ein subjektiver Prozess, sondern er ist bisweilen auch objektiv von aussen erkennbar, indem sich das Gesicht in dem Augenblick „erhellt“, in dem sich der „erleuchtende“ Verstehensprozess abspielt. Bei einem besonders intensiven Erlebnis kann es dazu kommen, dass das Gesicht förmlich „strahlt“. Wie eng die beiden Hirnhemisphären zusammenarbeiten, erkennt man auch daran, dass das „linkshemisphärische“ linear-analytische Denken – etwa bei der Lösung der obigen Rechenaufgabe – immer wieder durch die „rechtshemisphärischen“ Elemente des Verstehens, der kurzen Erleuchtungen, unterbrochen wird.
Während sich die RATIO auf Details fokussiert und dabei Gefahr läuft, die Übersicht zu verlieren, verhält es sich bei der INTUITION umgekehrt. Wie in einem Weitwinkelobjektiv nimmt sie Übersichten, Gesamtsituationen, Zusammenhänge, Harmonien wahr, während sie die präzisen Details aus den Augen verliert. Sie ergibt also ein eher unscharfes, verschwommenes oder gar nebulöses Bild, was noch dadurch unterstrichen wird, dass Ganzheiten und Beziehungs-Netzwerke häufig eher als vages Gefühl oder als ein „Gespür“ denn als klare Gedanken erfasst werden.
In Zusammenhang mit dem Analytischen, Trennenden der RATIO steht auch ihre Tendenz zum dualistischen, polaren Denken. Dieses teilt in Zweiheiten, in gegensätzliche Pole auf wie etwa „gut – böse“ oder „richtig – falsch“. Im Gegensatz dazu ist für die INTUITION das Monistische*, das Einheitsprinzip, kennzeichnend, das aus der ganzheitlichen Verarbeitungsmethode erwächst. Nun sind wir natürlich tatsächlich überall von Gegensätzen umringt. Es geht nicht darum, diese Gegensätze zu verneinen. Probleme ergeben sich aber dann, wenn die Gegensätze auf ein „Entweder-Oder“ fixiert werden, anstatt zu anerkennen, dass es sich um ein „Sowohl-als-Auch“ handelt und die Gegensätze nur verschiedene Aspekte desselben sind. Wie die Gegensätze zusammengehören, lässt sich augenfällig an jenem Ding illustrieren, auf den sich der Begriff „Polarität“ bezieht, nämlich an einem Magneten. Jeder Magnet besitzt einen Nordpol und einen Südpol, die an sich völlige Gegensätze darstellen und sich nicht vereinigen lassen. Und dennoch gehören sie untrennbar zusammen. Zerteilt man einen Magneten nämlich in zwei Teile, haben wir nicht je einen Nord- und einen Südpol vor uns, sondern zwei neue Magneten mit wieder je einem Nord- und einem Südpol. Es gibt keine gesonderten Nord- und Südpole. Ein Magnet wird dadurch zu einem solchen, dass er die beiden Pole in sich vereinigt. Ein anderes Beispiel sind die Begriffe „Leben“ und „Tod“, die wohl den krassesten Gegensatz überhaupt darstellen. Aber auch sie hängen zweifellos untrennbar zusammen: ohne Leben kein Tod – ohne Tod kein Leben. Gegensätze sind nichts weiter als die sich ergänzenden Pole einer Einheit.
Das analytisch-polare Moment der RATIO hat noch eine weitere Konsequenz: Die Subjekt-Objekt-Trennung. Dem Subjekt, dem Ich oder Ego, im Zentrum steht die übrige Welt als Objekt* – als Gegenstand – gegenüber. Das holistisch-monistische Element der INTUITION führt hingegen dazu, dass man sich mit der Welt verbunden, in sie eingebunden fühlt. Dem Ich-Gefühl der RATIO steht ein ausgeprägtes Wir-Gefühl der INTUITION entgegen.
An dieser Stelle soll ein Thema zur Sprache kommen, das uns immer wieder beschäftigen wird und das ich das „Pfortenproblem“ nennen möchte. Es ist die Polarität „Offenheit – Geschlossenheit“, ein grundlegendes Dilemma, das alles Lebendige betrifft: Von der Zelle zum Organismus, vom Individuum zu sozialen Systemen: von der Familie bis zu Staaten. Jedes lebende System, zum Beispiel eine Zelle, muss zu seiner Erhaltung eine innere Ordnung aufrechterhalten. Dabei ist es darauf angewiesen, von aussen Elemente in sich hereinzunehmen: Einerseits Energie in Form von Materie – Nahrung – und eigentlicher Energie – Sonnenenergie –, andererseits Informationen, um sich in einer sich verändernden Welt behaupten zu können. Es gilt nun, die richtige Balance zwischen Offenheit und Geschlossenheit zu finden. Ist die Pforte des Systems „zu offen“, wird es von aussen überschwemmt, sodass es seine innere Ordnung nicht mehr aufrechterhalten kann, was zum Untergang, zum Tod führt. Ist die Pforte hingegen „zu geschlossen“, können zur Bewahrung der inneren Ordnung zu wenig Energie und Informationen Einlass finden, was wiederum zum Tod führt. Das Dilemma lautet demnach: Soviel Offenheit wie möglich, soviel Geschlossenheit wie nötig – oder umgekehrt. Gefragt ist also das rechte Mass und dieses rechte Mass lässt sich nie dauerhaft festlegen, sondern muss immer wieder aufs Neue je nach der bestehenden Situation und nach den vorausgehenden Erfahrungen gesucht und bestimmt werden.
Beziehen wir das Pfortenproblem auf RATIO und INTUITION, so steht der stärkeren – oder zu starken – Geschlossenheit des fokussierenden „linkshemisphärischen“ Denkens die stärkere – oder zu starke – Offenheit des ganzheitlichen „rechtshemisphärischen“ Denkens gegenüber.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied in der Arbeitsmethode der beiden Denkformen besteht darin, dass die RATIO mit Sprache, das heisst mit Begriffen arbeitet, während für die INTUITION Bilder, Symbole und Metaphern typisch sind.
Diese Gegenüberstellung ist eng mit dem Begriff „Abstraktion“* und mit der damit in Zusammenhang stehenden Lehre von den Zeichen verknüpft. Die wohl elementarste Definition des Zeichens im weiten Sinne ist die, dass ein Zeichen etwas ist, das für etwas anderes steht. Es ist also ein Stellvertreter, es repräsentiert oder be-zeichnet etwas, es deutet auf etwas hin, hat also Bedeutung, ist Bedeutungsträger. Eine oft verwendete Einteilung der Zeichen im weiten Sinne, die auf den Sprachforscher Ferdinand de Saussure (1857 bis 1913) zurückgeht, ist jene in Signale, Symbole und Zeichen im engeren Sinne. Signale, auch Anzeichen genannt, sind Bedeutungsträger, die vom Signalisierten nicht zu trennen sind, da sie Teil von ihm sind oder mit ihm in einer kausalen Beziehung stehen. Beispiele sind etwa die Stimme eines Menschen oder der Rauch eines Feuers. Symbole oder Sinnbilder sind zwar von dem, was sie bezeichnen, verschieden, haben aber eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten bewahrt, sie haben einen gewissen Anteil am Symbolisierten, sind also durch dieses irgendwie begründet. Schliesslich sind Zeichen im engen Sinne Bedeutungsträger, die vom Gemeinten völlig verschieden und losgelöst sind, keine Ähnlichkeit mit und keinen Anteil an dem Bezeichneten haben, sondern willkürlich und durch Übereinkunft festgelegt worden sind. Wichtigste Beispiele für solche Zeichen sind die Wörter der Sprache, insbesondere aber die Zeichen der Schrift, die Buchstaben.
Dabei ist zu betonen, dass zwischen Signalen, Symbolen und Zeichen fliessende Übergänge bestehen. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass in der Literatur gelegentlich „Symbol“ als das verwendet wird, was wir „Zeichen im weiten Sinn“ genannt haben. Im Folgenden seien hier unter „Symbol“ und „Zeichen“ die im engeren Sinne verwendeten Begriffe gemeint.
Eng verknüpft mit der Abstraktion ist das Gegensatzpaar „analog – digital“. Analogie* bedeutet das Verhältnis von Ähnlichkeit oder Entsprechung zwischen zwei oder mehreren Dingen. Analoges Denken beruht auf Assoziationen, also auf gedanklicher Verknüpfung von Vorstellungen. Charakteristisch für das Analoge sind fliessende Übergänge ohne Stufen und damit auch Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit. Im Gegensatz dazu bedeutet „digital“*, dass nicht stetig veränderliche Werte vorliegen, sondern dass diese stufenförmig in Einzelschritte aufgelöst sind. Es findet nicht nur eine Zergliederung in einzelne Teile statt, sondern es werden einzelne Teile herausgelöst, abstrahiert, und diese einzelnen Ausschnitte stehen nun unzweideutig und klar bestimmt nebeneinander. So stehen etwa in der Reihe der ganzen Zahlen klar definierte Einheiten nebeneinander – zwischen den Zahlen Eins und Zwei existieren keine Übergänge. Im Extremfall kommt es zu einer einfachen Wahl zwischen lediglich zwei Einheiten, etwa zwischen A und B, Ja und Nein oder – beim Computer – zwischen Ein und Aus beziehungsweise zwischen Eins und Null. Der Unterschied zwischen analog und digital kann gut am Beispiel der Uhr veranschaulicht werden. Die digitale Uhr zeigt die Zeit an, indem eine ganze Zahl zur nächsten springt. Bei der analogen Uhr hingegen bewegen sich die Zeiger – wenigstens von blossem Auge gesehen – kontinuierlich im Kreise herum.
Betrachten wir nun das Spektrum vom Bild bis zum Zeichen etwas näher im Lichte der Abstraktion und des Gegensatzpaares „analog-digital“. Wenn wir einen Gegenstand betrachten, erzeugen unsere Augen zusammen mit dem Gehirn ein inneres Bild. Schon dieser Vorgang stellt einen Abstraktionsprozess dar, da das Bild nicht alle physikalischen Daten der Aussenwelt enthält. Analog ist dieses Bild in dem Sinne, als es einen grossen Spielraum mit fliessenden Übergängen offen lässt. So sind zum Beispiel beim Betrachten eines Gemäldes unzählige Sicht- und Interpretationsweisen möglich. Vom Bild zum Symbol hat ein weiterer Abstraktionsschritt und schon eine gewisse Digitalisierung stattgefunden. Das Symbol hat noch Anteil an dem, was es bedeutet, sein Erscheinungsbild ist aber durch Abstraktion vereinfacht worden. Auch sind seine Interpretationsmöglichkeiten deutlich geringer geworden – es ist eindeutiger, aber immer noch vieldeutig. Nach C.G. Jung enthält das Symbol etwas Unbestimmtes, Unbekanntes, einen „unbewussten“ Aspekt, der sich dem Zugriff des Verstandes entzieht und bei dessen Deutung es der INTUITION bedarf253. Das Symbol weist auf etwas hin, lässt aber – zumindest auf den ersten Blick – vieles im Dunkeln und Geheimnisvollen: Es ist Offenbarung und Verhüllung zugleich. Der zum Symbol synonyme Begriff „Sinnbild“ weist darauf hin, dass ihm ein tieferer Sinn innewohnt. So berühren viele der unzähligen Symbole, die die Menschheit geschaffen hat, tiefe Schichten der Seele und setzen etwas in Bewegung – denken wir etwa an das christliche Symbol des Kreuzes, das tiefreligiöse Gefühle auslösen kann. Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass nicht nur optische Bilder, sondern auch akustische Phänomene symbolische Bedeutung haben können, indem etwa eine Landeshymne das Gefühl heimatlicher Verbundenheit hervorrufen kann.
Unter „Metapher“* versteht man einen bildhaften sprachlichen Ausdruck. Durch eine Analogie wird eine Bezeichnung auf eine andere herangetragen, womit Ähnlichkeit in der Bedeutung entsteht. Die Metapher vergleicht das Bekannte mit dem Unbekannten und macht dieses damit vertraut und fassbar. Sie ist eines der wichtigsten Mittel zur Schöpfung von Benennungen für Dinge und Geschehnisse, für die noch keine entsprechende Bezeichnung existiert. Und sie kann Bedeutungen vertiefen und betonen, indem Vergleiche herangezogen werden. So wirkt im Ausdruck „Er ist stur wie ein Ochse“ die Sturheit intensiver, als wenn man einfach sagt: „Er ist stur“. Und im Wort „Wirtschaftskrieg“ wird das Kämpferische und Brutale des Krieges zur Steigerung des einfachen und harmlosen Begriffes „Wettbewerb“ herausgestrichen. Wenn die Metapher in der Gegenüberstellung auf die Seite der INTUITION gerückt wurde, ist dies nicht ganz korrekt, denn sie verbindet das „rechtshemisphärische“ Analoge mit dem „linkshemisphärischen“ Digitalen der Sprache.
Sprache besteht aus Wörtern oder Begriffen und diese stellen einen weiteren Schritt im Abstraktions- und Digitalisierungsprozess in Richtung Zeichen dar. Gesprochene Worte haben mit dem, was sie bezeichnen, in der Regel nichts gemein. Ausnahmen bilden die lautmalerischen Wörter wie etwa „murmeln“ oder „zischen“, deren Aussprache das Bezeichnete in gewissem Masse nachbilden. Hingegen haben etwa die Laute, aus denen das gesprochene Wort „Haus“ bestehen, mit dem Gegenstand „Haus“ keine erkennbare Beziehung. So ist der grösste Teil der sprachlichen Begriffe willkürlich und durch Übereinkunft festgelegt. Es wäre nun aber falsch, Wörter und Begriffe als rein digital zu bezeichnen. Denn ihnen sind viele Nebenbedeutungen und Unschärfen eigen, indem sie von verschiedenen Individuen mit teils feinen Nuancen, teils aber auch mit relativ grossen Unterschieden aufgefasst werden. Auch die Sprache hat demnach ein gewisses analoges Element bewahrt.
Als eigentliche „Zeichen“ können indessen die Elemente der Schriftsprache, die Buchstaben, bezeichnet werden, die aus dem letzten Schritt der Abstraktion und Digitalisierung hervorgegangen sind. So hat etwa der Buchstabe „A“ mit dem gesprochenen Laut „A“ gar nichts mehr gemeinsam Zwischen den Zeichen „A“ und „B“ gibt es keine Übergänge, sie sind klar getrennt, also gleichsam „voll digitalisiert“. Und trotzdem hat sich auch bei diesen Zeichen ein Rest von Analogie, von Variabilität und Unbestimmtheit bewahrt. So kann etwa der Vokal „O“ offen oder geschlossen gesprochen werden.
Die wohl abstraktesten und digitalisiertesten Zeichen stellen die mathematischen Zeichen dar. Zumindest innerhalb jener Länder, die unser Alphabet benutzen, bedeutet das Pluszeichen „+“ immer eine Aufforderung zum Addieren.
Es ist nun an der Zeit, auf die eingangs aufgeführten Beispiele 3 bis 5 etwas näher einzugehen.
Zum Beispiel 3: „Das Herz öffnen.“ Dem Chirurgen steht das Herz als klar definierter Begriff im Geist und als klar definiertes und abgegrenztes, gleichsam „digitalisiertes“ körperliches Organ vor Augen, das es zu öffnen, mit klar definierten Instrumenten aufzuschneiden gilt. Für den Verliebten, den Dichter und den Mystiker bedeuten die Worte jedoch etwas völlig anderes. Das Herz stellt hier ein Symbol dar, und zwar für die Liebe. Damit kommt das später noch ausführlich zu besprechende dritte Element des Geistes neben RATIO und INTUITION, nämlich die Gefühle, ins Spiel. Die Öffnung des Herzens, also der Bereich des durch die Liebe Erfassten, nimmt dabei vom Verliebten über den Dichter zum Mystiker stetig zu, die Pforte öffnet sich immer mehr, die Liebe wird zunehmend ganzheitlicher. Die Liebe der Verliebten geht über die eigene Person hinaus und richtet sich auf ein anderes menschliches Wesen. Für manchen Dichter erweitert sich das Ziel seiner Liebe auf viele oder alle Menschen und auf die uns umgebende Natur. Schliesslich öffnet sich die Pforte beim Mystiker vollständig und seine Liebe richtet sich auf Gott, der die Unendlichkeit, den ganzen Kosmos umfasst.
Zum Beispiel 4: „Die Welt besteht nicht aus Ato men, sondern aus Geschichten.“ Dieser provokative Satz will natürlich nicht die wissenschaftliche Tatsache, dass die Welt aus Atomen besteht, verleugnen, sondern zu einer anderen Sicht auf die Welt auffordern. Die Erkenntnis, dass die Welt aus Atomen besteht, ist die Folge des „linkshemisphärischen“ analytischen Denkens, das die Welt in immer kleinere Teile bis hin zu den Atomen auflöst. Eine Welt, die aus Geschichten besteht, bringt uns eine andere Sicht. Wesentliche Elemente von Geschichten sind einerseits, dass sie von Beziehungen handeln, und andererseits, dass es sich nicht um einen Zustand, sondern um ein Geschehen, um einen Prozess handelt. Es sind Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Menschen und der Natur. Die Beziehungen verweben die Dinge in der Geschichte zu einem Ganzen, woran wir den „rechtshemisphärischen“ Aspekt erkennen. Zudem sind die Beziehungen nicht statisch, sondern dynamisch; sie ändern sich im Verlauf der Geschichte. Hinzu kommt das symbolisch-metaphorische Element der Geschichte: Dieses schafft Sinn und Bedeutung. Das analoge Element einer Geschichte äussert sich auch darin, dass es bei den Interpretationen einen grossen Spielraum gewährt, sodass es den verschiedenen Individuen einen anderen Sinn offenbaren kann.
Zum Beispiel 5: „Was ist nun wahr: Die naturwissenschaftliche Evolutionstheorie oder die Schöpfungsgeschichte der Bibel?“ Diese Frage knüpft an das Beispiel 4 an. Die Evolutionstheorie ist wiederum das Resultat des vorwiegend analytischen Denkens. Sie zeigt auf, wie die Natur aus immer höheren biologischen Formen schliesslich den Menschen hervorgebracht hat. Die Schöpfungsgeschichte der Bibel und die unzähligen übrigen Schöpfungsgeschichten der Welt hingegen sind Geschichten, die nie wortwörtlich als historisch-naturwissenschaftliche Tatsachen hinzunehmen sind. Vielmehr haben sie symbolisch-metaphorischen Charakter und vermitteln eine Bedeutung, einen Sinn. Sie erklären die Herkunft des Menschen aus anderer Sicht und vermitteln ihm in dem Sinne Bedeutung, als sie ihm seine Stellung in der Natur und zu den Mitmenschen klären und ihm so einen Sinn für sein Leben verleihen. Die Erkenntnis, dass die Natur – und damit auch wir Menschen – aus Atomen besteht, ist sicher interessant. Sie vermag dem Menschen jedoch keinen Sinn für sein Leben zu vermitteln. Dasselbe gilt für die Evolutionstheorie. Ausser der Erkenntnis, dass wir mit den übrigen Tieren verwandt sind – und sie dementsprechend auch behandeln sollten – ergibt das Wissen, dass wir von Affen und schliesslich von immer niedrigeren Tieren abstammen, für unser Leben wenig Sinn. Es geht hier nicht darum, naturwissenschaftliche Theorien gegen Mythen oder umgekehrt auszuspielen, sondern darum, verschiedene Sichtweisen auf das Gleiche zuzulassen. Warum nicht die Evolutionstheorie neben der Schöpfungslehre stehen lassen – im Wissen darum, dass es nur verschiedene Perspektiven sind?
Informationsquelle und Bewusstseinszustand
Weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen RATIO und INTUITION sind die Quellen, aus denen sie die Informationen beziehen, und der Bewusstseinszustand. Erstere empfängt die Informationen mittels der Sinnesorgane von der Aussenwelt, Letztere von der Innenwelt, dem Unbewussten. Während die Quelle der RATIO also aussen liegt, liegt jene der INTUITION im Inneren. Obwohl diese plakative Aussage nicht unproblematisch ist, wollen wir sie zunächst einmal so stehen lassen und uns dem Phänomen des Bewusstseins zuwenden.
Bewusstsein heisst bewusstes Sein, Wissen um das Sein, Wissen, dass etwas ist. Es ist ein Gewahr-Sein der Dinge und Situationen um mich herum ebenso wie ein Gewahrsein meiner selbst, meines Denkens und meiner Aktionen. Bewusstsein ist immer „Bewusstsein von etwas“, das heisst Bewusstsein ist gerichtete Aufmerksamkeit. Bewusst ist nur das, worauf wir gerade aufmerksam sind88.
Nach landläufiger Meinung ist man im „normalen“ Wachzustand bei Bewusstsein, während man dieses im Schlaf oder bei Bewusstlosigkeit verloren hat. Nach uralten Erkenntnissen fernöstlicher Psychologie und nach der modernen westlichen Bewusstseinsforschung ist Bewusstsein aber nicht ein Zustand, den man hat oder nicht hat. Wie alles in der Natur ist auch das Bewusstsein ein Prozess, es ist Bewegung, stetige Veränderung. Es ist ein Prozess, ein ständiges Fliessen, das sich facettenreich in die verschiedensten Formen ergiesst, die ein weites Spektrum darstellen. Es gibt also nicht ein Bewusstsein, sondern unzählige Bewusstseinsformen, die sich innerhalb desselben Individuums in fliessenden Übergängen unterscheiden. Solange der Mensch lebt, ist ihm stets irgendeine Bewusstseinsform eigen.
Das Spektrum der Bewusstseinszustände reicht vom „normalen“ Tages- oder Wach-Bewusstsein über Tag- und Nachtträume, krankhafte Zustände wie etwa bei Delirien oder Psychosen bis hin zu den vielfältigen Formen, die durch verschiedene Methoden, wie etwa durch Meditation oder gewisse Drogen, herbeigeführt werden können. Das Wachbewusstsein macht dabei nur einen geringen Teil der Bewusstseinsformen aus, alle übrigen Bewusstseinszustände stellen den Hauptteil des Spektrums dar. Sie werden „veränderte“ oder „aussergewöhnliche“ Bewustseinszustände genannt. Während dem Begriff „verändert“ ein eher abwertender Beigeschmack anhaftet und vor allem für krankhafte Zustände angebracht ist, hebt der Begriff „aussergewöhnlich“ das Besondere und – vielfach auch berechtigterweise – das Aufwertende hervor. Leider werden auch heute noch aussergewöhnliche Bewusstseinszustände von vielen Menschen, zum Teil auch von Psychologen und Psychiatern, als krankhaft abgestempelt und nicht ernst genommen.
Die Definition des Bewusstseins als Gewahrsein, als gerichtete Aufmerksamkeit, trifft nun hauptsächlich für das normale Tages- oder Wachbewusstsein zu. Und diese Form ist es nun, die mit der RATIO verbunden ist. Die gerichtete Aufmerksamkeit bedingt ein „Ich“ als willentlich steuerbaren Mittelpunkt. Das Ich oder Ego ist das Zentrum des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Handelns. Das Ich-Bewusstsein bedeutet ein Sich-Unterscheiden und Distanzieren von der Aussenwelt, also eine Subjekt-Objekt-Trennung, die ja für die RATIO charakteristisch ist. Gerichtete Aufmerksamkeit kann mit dem kleinen Lichtkegel einer Taschenlampe verglichen werden: Alles was in den Lichtkegel eintritt, wird klar und scharf aufgenommen. Gleichzeitig bedeutet es indessen auch, dass die Wahrnehmung eingeengt ist, dass alles, was sich ausserhalb des Lichtkegels befindet, ausgeschlossen ist.
Alles, was in einem gewissen Moment ausserhalb des Lichtkegels des Bewusstseins liegt, kann vereinfacht als das Unbewusste, das derzeit Nicht-Bewusste, bezeichnet werden. Zugang zu diesem Unbewussten gewähren jene als verändert oder aussergewöhnlich bezeichneten Bewusstseinszustände. Und diese aussergewöhnlichen Bewusstseinszustände sind nun charakteristisch für die INTUITION. Da diese so eng mit den aussergewöhnlichen Bewusstseinszuständen verbunden ist, die ihrerseits den Zugang zum Unbewussten gewähren, ist sie gleichzeitig in enger Verbindung mit dem Unbewussten. INTUITION* bedeutet unmittelbare Anschauung des Inneren, Versenkung ins Unbewusste. Oder umgekehrt ausgedrückt: Bei der INTUITION brechen Inhalte des Unbewussten in das Bewusstsein ein, finden Einbrüche oder Einfälle ins Bewusstsein statt. Das Unbewusste kann in verschiedene Schichten unterteilt werden. Die Schicht des persönlichen Unbewussten enthält alles, was einmal bewusst gewesen war, aber vergessen oder verdrängt wurde, aber auch unterschwellige Wahrnehmungen und anderes mehr. Zu der tieferen Schicht des kollektiven Unbewussten gehören Dinge, die der Menschheit als ganzer eigen sind, etwa Motive der alten Mythen und Märchen. Nach der modernen Psychologie reicht nun das Unbewusste noch viel weiter. Mit der tiefsten, der transpersonalen* Schicht geht das Unbewusste nicht nur über die Person, sondern auch über Raum und Zeit hinaus und steht mit dem ganzen Kosmos in Verbindung. Je tiefer wir in das Unbewusste tauchen, desto weiter entfernt es sich vom Ich und desto allgemeiner und „globaler“ werden die Inhalte. Im Allgemeinen gilt, dass je tiefer die Elemente im Unbewussten liegen, desto schwieriger ist es, sie in die Helligkeit des Bewusstseins zu holen und deshalb desto stärker veränderte Bewusstseinszustände dazu notwendig sind. Und je tiefer die Quelle liegt, aus der die Informationen ins Bewusstsein aufsteigen, desto schwieriger wird es, sie in das Tagesbewusstsein zu integrieren, das heisst sie in Sprache zu kleiden, zu beschreiben und an andere Menschen weiterzugeben.
Die Themen „Unbewusstes“ und „aussergewöhnliche Bewusstseinszustände“ sind hier nur ganz kursorisch und oberflächlich behandelt worden – sie werden später viel ausführlicher zur Sprache kommen. Bei genauerem Hinsehen ist jedoch bei diesen Themen schon jetzt offensichtlich, wie schwierig, ja gar unmöglich es ist, klare Grenzen zu ziehen. So wird etwa deutlich, wie sich die Begriffe durchdringen, wenn „Bewusstsein“ einmal als Oberbegriff von Geisteszuständen und dann als Spezialfall eines Bewusstseinszustandes, nämlich des Tagesbewusstseins, verwendet wird. Noch viel stärker als die Begriffe vermischt sich das, was mit ihnen gemeint ist. So ist es kaum möglich, eine scharfe Grenze zwischen Bewusstsein und Unbewusstem zu ziehen. Die Ränder des Lichtkegels des Bewusstseins sind nicht scharf, sondern stark ausgefranst. So treten immer wieder erlernte Elemente unseres Gedächtnisses, also Dinge, die im Moment nicht im Bewusstsein sind, aus den oberflächlichen Schichten des Unbewussten in das Bewusstsein ein. Dieser Vorgang könnte mit der Funktionsweise eines Computers verglichen werden, der Daten, die er vorher aus dem Arbeitsspeicher in die Auslagerungsdatei verschoben hat, nun wieder in den Arbeitsspeicher zurückholt.
Die Prozesse des Tagesbewusstseins sind nicht nur ständig begleitet, sondern auch öfters geleitet, gefördert und unterbrochen von unbewussten Vorgängen. Spontan treten Gedanken, Ideen und Erinnerungen auf, und Ängste, Launen, Absichten und Hoffnungen befallen uns aus unersichtlichen Gründen254. Ständig besteht eine Wechselwirkung, eine gegenseitige Beeinflussung von Bewusstsein und Unbewusstem.
Problematisch ist auch die Aussage, dass die RATIO ihre Informationen über die Sinnesorgane aus der Aussenwelt bezieht, während die Quelle der INTUITION das Unbewusste darstellt. Dass das mit der RATIO verbundene Tagesbewusstsein sich nur mit den über die Sinne aufgenommenen Wahrnehmungen beschäftigt, stellt einen Extremfall dar, nämlich die „reine“ Sinneswahrnehmung, das „sinnliche Bewusstsein“. Praktisch immer gesellen sich dabei Elemente des „denkenden Bewusstseins“, das heisst sprachliche Begriffe hinzu, die zwar irgendwie aus einer Wahrnehmung abstrahiert worden sind, mit den ursprünglichen Wahrnehmungen aber nichts Ersichtliches mehr gemein haben. Während beim rationalen Denken, dem denkenden Bewusstsein, der Geist sich selbst zugewandt ist – nach Platon ist Denken ein Zwiegespräch der Seele mit sich selbst382 –, wendet sich sein „Blick“ bei der INTUITION in seine eigene Tiefe, versenkt er sich in sich selbst und durchforscht die Tiefen des Unbewussten. Das sinnliche und das „intuitive Bewusstsein“ stellen die Extreme dar: Das Erstere blickt nur nach aussen, das Letztere nur nach innen. Indessen darf bezüglich der Quelle der INTUITION nicht vergessen werden, dass viele Elemente des Unbewussten ursprünglich einmal über die Sinnesorgane in das Bewusstsein gelangt waren, bevor sie dann ins Unbewusste verlagert wurden. Wir sehen also, wie sich Innen und Aussen, Unbewusstes und Tagesbewusstsein durchdringen.
Der Umgang mit der Welt
Je nachdem, ob das Denken mehr von „linkshemisphärischer“ oder mehr von „rechtshemisphärischer“ Art ist, unterscheidet sich auch die Art des In-der-Welt-Seins und der Umgang mit der Welt. Die Art und Weise, wie man erkennend an die Welt herantritt und wie man über sie denkt, beeinflusst auch die Art und Weise, wie man in der Welt ist, wie man sich ihr gegenüber verhält, wie man mit ihr umgeht.
Das analytische und polare Denken der RATIO setzt Grenzen, es führt zur Subjekt-Objekt-Trennung in dem Sinne, als das Subjekt, das Ich, das Zentrum darstellt, das der Welt als einem Objekt distanziert gegenübertritt, die Welt in einzelne Teile zerlegt und über die Welt und ihre Teile denkt. Der RATIO ist auch das Besitzergreifende eigen, was zunächst einmal durch die Sprache geschieht. Indem wir etwas Unbekanntem einen Begriff, einen Namen verleihen, wird das Benannte aus der Anonymität herausgelöst, es wird sprachlich „einverleibt“, wir nehmen es geistig in Besitz. Der Akt der Namensgebung ist der erste Schritt, um etwas zu beherrschen. Die RATIO ist zudem eng mit dem Handeln verbunden. Dadurch, dass wir ein Ding ergreifen, in die Hand nehmen, ergreifen wir von ihm Besitz. Das Aktions-zentrierte Element äussert sich auch darin, dass der Mensch die Teile der Welt zunächst abstrakt-gedanklich im Kopf und dann konkret in der äusseren Wirklichkeit manipuliert*, mit ihnen handelt, auf sie einwirkt und umgestaltet, um die Dinge in den Griff zu bekommen und sie den Ich-zentrierten Bedürfnissen verfügbar, untertan zu machen. Die auf der RATIO basierende Art des In-der-Welt-Seins ist eine Ich-zentrierte, aktive, besitzergreifende, zupackende, eingreifende und verändernde Grundhaltung. Sie verkörpert die auf Besitz gerichtete Existenzweise des „Habens“ nach Erich Fromm149 und die Haltung des „Machers“, die Macht und Besitz verspricht. Dies kommt nicht von ungefähr, denn die RATIO ist nicht – wie wir noch sehen werden – entstanden, um die Welt zu erkennen und zu verstehen, sondern um in der Welt zu überleben. Die RATIO ist primär nicht ein Wahrheitsapparat, sondern ein Überlebensapparat.
Bei der auf der INTUITION ruhenden Haltung rückt wegen der fehlenden Subjekt-Objekt-Trennung das Ich in den Hintergrund und die Verflochtenheit mit der Welt, das In-die-Welt-Eingebundensein steht im Vordergrund. Bei dieser Existenzweise sieht sich der Mensch der Welt nicht distanziert gegenüber und er denkt nicht analytisch über sie, sondern er denkt synthetisch in und mit der Welt. An die Stelle des für das „linkshemisphärische“ Denken typischen Aktionsmodus tritt beim „rechtshemisphärischen“ Denken der Rezeptionsmodus, die Wahrnehmungs-zentrierte Haltung, der passive, empfangende Lebensstil. Der Mensch lässt die Welt auf sich einwirken, gibt sich der Erfahrung hin, lässt etwas mit sich geschehen, wodurch er viel tiefer in die Welt eindringt und so die inneren Zusammenhänge besser zu erblicken imstande ist. Diese Art des In-der-Welt-Seins vermittelt keine distanzierende Macht über die Welt, dafür aber das Gefühl der Geborgenheit in der Welt, was jedoch gleichzeitig auch Verantwortung für die Welt bedeutet. Die auf der INTUITION ruhende Haltung zielt nicht auf Haben und Machen, sondern auf Sein. Es ist die passive, empfangende, sinnlich anschauende und bewahrend-belassende Seinsweise. Sie ist nicht auf das Überleben ausgerichtet, sondern bedeutet einfach Leben: Sein im Hier und Jetzt.
Es besteht kein Zweifel, dass unsere moderne westliche Zivilisation stark durch die RATIO beherrscht wird, also sehr „linkslastig“ ist. Dies soll an zwei besonderen Aspekten verdeutlicht werden, nämlich an der Dominanz des Auges über das Ohr und an der übergrossen Bedeutung der Zeit.
Während die Menschen früherer Zeiten nur zu einer begrenzten Anzahl von Bildern Zugang hatten, ist es vor allem im Laufe des letzten Jahrhunderts zu einer immer massiveren Flut an Bildern gekommen, die uns überschwemmt. Stark dazu beigetragen hat natürlich der technische Fortschritt – insbesondere Fotografie, Drucktechnik und Fernsehen. Die Bilderflut ist aber auch Ausdruck eines zunehmenden Übergewichts des „linkshemisphärischen“ Denkens. Denn der Sehvorgang ist stärker mit der RATIO verbunden, indem er mehr zielgerichtet, nach aussen schauend, analytisch, aktiv und besitzergreifend ist. Demgegenüber erweist sich der Hörvorgang als eher rezeptiv, aufnehmend, ganzheitlich erfahrend und passiv. Auf den ersten Blick scheint es ein Widerspruch zu sein, wenn gesagt wird, dass das Sehen, das ja zu Bildern führt, mit dem „linkshemisphärischen“ Modus assoziiert ist, während weiter oben Bilder als Merkmal des „rechtshemisphärischen“ Denkens dargestellt wurden. Es geht hier aber nicht um bildhaftes Denken, sondern um den Vorgang des Sehens. Ein weiterer Unterschied zwischen Auge und Ohr besteht darin, dass das Sehen die Oberfläche erfasst, das Hören jedoch die Tiefe, und zwar in dem Sinne, dass Gehörtes uns innerlich stärker zu bewegen vermag, oftmals viel intimer ist. So kann etwa Musik unsere Seele viel stärker in Wallung bringen als noch so schöne Bilder dazu imstande sind. Vermutlich haben sich die zunehmende Bilderflut und die zunehmende Betonung der RATIO gegenseitig emporgeschaukelt: Immer mehr Bilder – immer stärkere Betonung der RATIO – immer mehr Bilder und so weiter.
Sobald wir zu irgendeinem Thema Bilder zur Verfügung haben, sind wir der Überzeugung, genauere Kenntnis davon zu haben – was ja bis zu einem gewissen Grade auch der Wahrheit entspricht. Aber zu glauben, dass das Auge dem Ohr überlegen sei, weil es viel präziser sei, ist ein Irrtum, denn näher besehen verhält es sich genau umgekehrt. Einerseits ist die Bandbreite des Hörbereichs viel grösser als jene des Sehbereichs: Das Ohr kann gegenüber dem Auge das Zehnfache an Frequenzen aufnehmen – auch wenn die Frequenzen nicht aus dem gleichen physikalischen Spektrum stammen. Andererseits übertrifft das Ohr das Auge auch bezüglich Genauigkeit. Das Auge kann Farben nur ungenau erfassen, es muss Vergleiche ziehen, etwa indem wir etwas kornblumenblau oder olivgrün nennen. Demgegenüber kann das geübte Ohr einen musikalischen Ton genau erkennen, und selbst unmusikalische Menschen hören auf Anhieb, ob eine Oktave stimmt oder nicht. Das Auge schätzt, das Ohr hingegen misst34. Es mutet ziemlich paradox an, dass der mit dem „rechtshemisphärischen“ Modus assoziierte Gehörsinn viel analytischer, digitaler ist, während der Gesichtssinn viel analoger arbeitet – einmal mehr ein Beispiel, wie „links-“ und „rechtshemisphärisch“ keine klaren Gegensätze darstellen. Wie so oft kann auch beim Thema „Auge-Ohr“ die Sprache Hintergründe erhellen. Sie deutet darauf hin, dass das Auge ungenau ist, indem viele Wörter für Täuschung aus dem Seh-Bereich stammen, wie etwa Ver-sehen oder Ein-bildung. Und der Begriff „Vernunft“ – das parallel gebildete Wort zu Versehen – kommt von „Vernehmen“, also von einem Hörvorgang her.
Bei der Besprechung der Arbeitsmethode haben wir gesehen, wie die RATIO durch ihr schrittweises Vorgehen eng mit der Zeit verknüpft ist. Die Geschichte des Umgangs der Menschheit mit der Zeit illustriert nun die zunehmende Betonung des Faktors „Zeit“ und damit auch der RATIO. In ganz frühen Epochen richtete sich das Leben der Menschen nach den natürlichen Zyklen der Tages- und Jahreszeiten. Vor Jahrtausenden wurden Wasser- und Sonnenuhren geschaffen, die aber einerseits ungenau und andererseits wohl nur wenigen Menschen zugänglich waren, sodass sie kaum von grösserer Bedeutung für den menschlichen Alltag waren. Dies änderte sich schlagartig gegen Ende des 13. Jahrhunderts, als die Räder-Uhr erfunden wurde. Vermutlich wurde deren Idee in Klöstern geboren, weil es für die Mönche wichtig war, die genaue Zeit zu kennen, um die Gebetsstunden einhalten zu können. Während sich die Menschen in der Ur-Zeit nach den Rhythmen der Natur gerichtet hatten, wurde nun die Uhr-Zeit immer mehr zum bestimmenden Mass alles menschlichen Tuns. Die durch den Gebrauch der RATIO erfundene mechanische Uhr zwang der Gesellschaft in steigendem Masse den Gebrauch der RATIO auf. Indem die kirchlichen und weltlichen Herrscher weithin sichtbare Uhren an Kirchtürmen und Ratshäusern anbrachten, schufen sie eine allgemein verbindliche Zeit und brachten so eine rationale Ordnung in das gesellschaftliche und private Leben. Die Uhr schuf aber nicht nur eine Gesellschafts-Ordnung, sondern sie wurde im 17. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften auch zum Vorbild der Welt-Ordnung, indem man sich die Welt als einen Mechanismus nach dem Muster eines Uhrwerks vorstellte.
Waren in den Urzeiten die Tages- und Jahreszyklen die grundlegende Zeiteinheit, so wurden die massgebenden Zeiteinheiten in der Folge immer kleiner: Mit den Anfängen der Uhrzeit trat zunächst die Stunde, allenfalls die Viertelstunde ins Bewusstsein, mit den Eisenbahnen die Minute, mit den sportlichen Wettkämpfen anfangs des 20. Jahrhunderts die Sekunde, während nun seit längerem Rennen jeglicher Art mit Hundertstelsekunden gemessen werden. Diese ständig kürzer werdenden Zeiteinheiten sind Ausdruck der stetig zunehmenden Geschwindigkeit, mit der die Menschen in vielen Lebensbereichen konfrontiert waren und sind. Besonders sichtbar ist diese Beschleunigung im Bereich des technischen Fortschritts. Denken wir etwa an das ungeheure Tempo, mit dem sich die Computertechnologie in den letzten zwanzig Jahren entwickelt hat. Aber auch in vielen anderen Bereichen erleben wir die Geschwindigkeit von Entwicklungen, was dazu führt, dass ständig Neues an uns herantritt, das dann – noch bevor es sich richtig bewährt hat – von wiederum Neuem abgelöst wird. Dies ist ein Aspekt unserer Wegwerfgesellschaft, die nicht nur fortwährend Gegenstände wegwirft, sondern auch Ideen und Ordnungen verwirft. All dies hat zur Folge, dass viele Menschen keinen Halt mehr haben und sich in völliger Desorientierung befinden. Das sich laufend steigernde Tempo ist auch im Bereich der Bilderflut anzutreffen. Sowohl im Fernsehen wie auch in den Kinofilmen folgen sich Bild- und Szenenwechsel viel rascher als früher. Deshalb wirken alte Filme mit ihren viel längeren Szenen auf uns manchmal geradezu langweilig.
Ähnlich wie bei den Bildern scheinen sich auch die Bedeutung der Zeit und die RATIO gegenseitig emporgeschaukelt zu haben. Überhaupt ist man anzunehmen geneigt, dass die RATIO eine Eigendynamik in sich trägt. War sie einmal richtig in Gang gekommen, so hat sie sich selber immer mehr verstärkt, sodass das „Immermehr“ zu einem ihrer wesentlichen Merkmale geworden ist: Nicht nur immer mehr Bilder und Geschwindigkeit, sondern allgemein das Immer-mehr-Haben-und-Machen. Ein besonderer Aspekt des Immer-mehr-Habens liegt in der Verknüpfung von Geld und Zeit, was durch den Zins erfolgt. Dieser hat zur Folge, dass sich Geld einfach durch die Zeit vermehrt. Das Immer-mehr-Machen zum Ziele des Immer-mehr-Habens stösst nun an Grenzen, weil die Zeit unseres Lebens begrenzt ist. Dies bedeutet, dass die knappe Zeit wertvoll wird, was neben dem Zins einem weiteren Aspekt von „Zeit-ist-Geld“ entspricht. Der Endlichkeit der verfügbaren Zeit versuchen wir auszuweichen, indem wir praktisch ständig – und schnell – in Aktion sind und zudem oft verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Den Kult der „Vergleichzeitigung“ hat der Wirtschaftspädagoge Karlheinz Geissler in seinem Buch „Alles. Gleichzeitig. Und zwar sofort.“ 155 beschrieben. Sowohl das ständige und schnelle Tun wie das gleichzeitige Tun verschiedener Dinge hindern uns nicht nur oft daran, die Dinge auch seriös und richtig zu tun, sondern hindern uns auch am Denken, etwa am Nachdenken, ob das auch gut ist, was wir tun. Geopfert wird „die Erfahrung des Augenblicks, die Intensität tief gehender Beziehungen zu Mitmenschen sowie das neugierige „Eintauchen“ in Dinge und Prozesse“.
Das Paradigma
Eigentlich gehört das Folgende in den vorhergegangenen Abschnitt, nämlich zur Art und Weise des In-der-Welt-Seins, im Besonderen zur Art und Weise, wie wir die Welt ansehen und über sie denken. Es wurde gesagt, dass das moderne westliche Denken vorwiegend „linkshemisphärischer“ Natur ist. Nun gibt es aber einen Sonderfall, bei dem innerhalb der westlichen Kultur ein Wechsel der Denkform – ein so genannter „Hemisphärenshift“ – stattgefunden hat. Gemeint ist der „Paradigmenwechsel“, der im letzten Jahrhundert stattgefunden hat. Ein Paradigma* ist eine Art grundlegender Weltanschauung, ein System von Grundannahmen über die Welt, eine Art „Super-Theorie“ darüber, wie wir sie betrachten, eine Sammlung von Regeln, nach denen wir sie untersuchen. Das „alte“ Paradigma beruhte in erster Linie auf der Physik des 17. Jahrhunderts. Mit der Zeit traten in der wissenschaftlichen Forschung immer mehr Probleme und Widersprüche auf, die mit dem herrschenden Paradigma nicht zu lösen waren, weswegen sich ein Wandel gewisser Grundannahmen über die Welt, ein Wandel des Paradigmas aufdrängte. Das „neue“ Paradigma basiert auf der modernen Physik des 20. Jahrhunderts, vor allem auf der Relativitätstheorie und der modernen Atomphysik. Im Folgenden seien in groben Zügen einige wichtige Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Paradigma aufgeführt.
Erstens: Von den Teilen zum Ganzen. Nach dem alten Paradigma ist die Welt ein mechanisches System aus getrennten Teilen, wobei das Ganze aus den Eigenschaften der Teile ableitbar ist. Die Wissenschaft zerteilt die Welt in immer kleinere Teile, die für sich untersucht werden, und je genauer wir diese Teile kennen, desto besser haben wir das Ganze verstanden. Das neue Paradigma kehrt nun das Verhältnis zwischen Teilen und Ganzem um, indem das Ganze als primär gilt und die Eigenschaften der Teile durch die Gesamtübereinstimmung des Ganzen verständlich werden. Weil alles mit allem zusammenhängt, gibt es im Grunde gar keine einzelnen, getrennten Teile, sondern nur Muster in einem untrennbaren Gewebe von Zusammenhängen.
Zweitens: Von der Struktur zum Prozess. Für das alte Paradigma gab es fundamentale Strukturen, einzelne Teile, die aufeinander wirken, wodurch es zu Vorgängen, zu Prozessen kommt. Auch hier kehrt das neue Paradigma die Verhältnisse um, indem der Prozess als das Primäre gilt. Alles ist Vorgang, Veränderung, Prozess. Und das, was wir als Struktur, als einzelnes Objekt wahrnehmen ist nur ein Vorgang, der langsam abläuft, das heisst eine gewisse Dauerhaftigkeit aufweist.
Drittens: Vom Gebäude zum Netzwerk





























