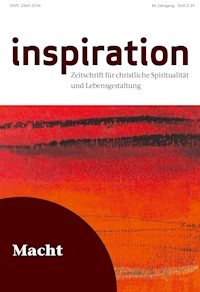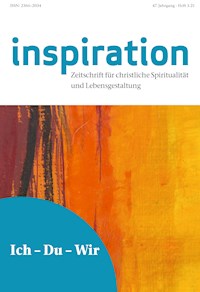Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das letzte Heft des Jahrgangs 2020 wird mit einer Notiz von Bernhard Bürgler SJ eröffnet, der sich im Anschluss an Papst Franziskus für eine "verbeulte" missionarische Kirche der Zukunft ausspricht. Passend zur Advents- und Weihnachtszeit gewährt Sr. Anna Elisabeth Rifeser den Leser(inne)n unter der Rubrik "Nachfolge" interessante Einsichten in die Jesuskindverehrung der Frühen Neuzeit. Werner Löser SJ und Peter Becker bilden mit ihren Beiträgen zum spirituellen Lebensweg Charles Péguys einen inhaltlichen Schwerpunkt dieses Heftes. Sodann präsentieren Arndt Büssing und Mareike Gerundt die zentralen Erkenntnisse ihres bereits seit einigen Jahren laufenden Forschungsprojekts zur "Geistlichen Trockenheit", das nun im Rahmen einer Kooperation zwischen "IUNCTUS - Kompetenzzentrum für Christliche Spiritualität" an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster und der Professur "Lebensqualität, Spiritualität und Coping" an der Fakultät für Gesundheit der Universität Witten/Herdecke weiter vertieft wird. Angesichts des gegenwärtigen Ringens um Reform innerhalb der katholischen Kirche legt sich für manch enttäuschte Kirchenmitglieder der Gedanke an Austritt nahe. Warum Claudia Gerstner-Link sich dennoch fürs Bleiben entscheidet, erläutert sie anhand ihrer religiösen Biographie. Die "Junge Theologie" wird in dieser Ausgabe von Dieter Fugger bespielt, der der performativen Wirkung des Lesens auf den Grund geht. Seit Beginn dieses Jahres werden wir unverkennbar von der Corona-Pandemie in Atem gehalten. Bislang hat die Theologie darauf nur mit einer Reflexion struktureller und kirchenpolitischer Fragen reagiert. Martin Breul hingegen wagt unter der Kategorie "Reflexion" eine systematisch-theologische Auseinandersetzung mit der Krise, die das Potenzial haben könnte, die Verhältnisbestimmung von Gott und Welt nachhaltig zu verändern. Olaf Rölver untersucht die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes sowie der Verantwortlichkeit des Menschen in Krisensituationen anhand von drei Parabeln des Matthäusevangeliums, während Daniel Remmel Michel Henry mit Meister Eckhart, der in Henrys Werken eine wichtige Rolle spielt, ins Gespräch bringt. Im Anschluss wendet sich Claudia Bergmann dem symbolischen Gehalt von Essen und Trinken in eschatologisch ausgerichteten frühjüdischen Texten zu. Im Lektüre-Teil finden sich schließlich eine Umschau zu aktueller Pilger-Literatur von Michael Hainz SJ sowie der zweite Teil der Übersetzung des Aufsatzes "Vom Beteiligen und Unterscheiden" von Michel de Certeau, den wir Andreas Falkner SJ verdanken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Heft 4 | Oktober–Dezember 2020Jahrgang 93 | Nr.
Notiz
Kirche – wohin?
Bernhard Bürgler SJ
Nachfolge
Spiel und Autorität. Über die Jesuskindverehrung der Frühen Neuzeit
Sr. Anna Elisabeth Rifeser
Schmerz, Hoffnung und Barmherzigkeit. Maria bei Charles Péguy
Peter Becker
Charles Péguy und die Hoffnung
Werner Löser SJ
Geistliche Trockenheit. Eine Projektbeschreibung
Arndt Büssing/Mareike Gerundt
Nachfolge | Kirche
Kirchenaustritt: Nein. Ein biographischer Essay
Claudia Gerstner-Link
Nachfolge | Junge Theologie
Wende durch Lesen
Dieter Fugger
Reflexion
Handelt Gott in der Pandemie?
Martin Breul
„Gott in uns“. Michel Henry im Gespräch mit Meister Eckhart
Daniel Remmel
Perspektiven nach der Krise. Gottes Gerechtigkeit in drei Parabeln des Matthäusevangeliums
Olaf Rölver
„Essen für Heute und Morgen“. Die kommende Welt in frühjüdischen Texten
Claudia D. Bergmann
Lektüre
„… dass ich in dich hineinlaufe in deine Gegenwart“. Pilger-Literatur im Überblick
Michael Hainz SJ
Vom Beteiligen zum Unterscheiden (Teil II). Aufgabe der Christen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Michel de Certeau SJ
Buchbesprechungen; Jahresinhaltsverzeichnis
Impressum
GEIST & LEBEN – Zeitschrift für christliche Spiritualität. Begründet 1926 als Zeitschrift für Aszese und Mystik
Erscheinungsweise: vierteljährlich
ISSN 0016–5921
Herausgeber:
Deutsche Provinz der Jesuiten
Redaktion:
Christoph Benke (Chefredakteur)
Britta Mühl (Lektorats-/Redaktionsassistenz)
Redaktionsbeirat:
Bernhard Bürgler SJ / Wien
Margareta Gruber OSF / Vallendar
Stefan Kiechle SJ / Frankfurt
Bernhard Körner / Graz
Edith Kürpick FMJ / Köln
Ralph Kunz / Zürich
Jörg Nies SJ / Stockholm
Klaus Vechtel SJ / Frankfurt
Redaktionsanschrift:
Pramergasse 9, A–1090 Wien
Tel. +43–(0)664–88680583
Artikelangebote an die Redaktion sind willkommen. Informationen zur Abfassung von Beiträgen unter echter.de/zeitschriften/geist-und-leben. Alles Übrige, inkl. Bestellungen, geht an den Verlag. Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis. Werden Texte zugesandt, die bereits andernorts, insbesondere im Internet, veröffentlicht wurden, ist dies unaufgefordert mitzuteilen. Redaktionelle Kürzungen und Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Beiträge stimmt nicht in jedem Fall mit der Meinung der Schriftleitung überein.
Für Abonnent(inn)en steht GuL im Online-Archiv als elektronische Ressource kostenfrei zur Verfügung. Registrierung auf echter.de/zeitschriften/geist-und-leben.
Verlag: Echter Verlag GmbH,
Dominikanerplatz 8, D–97070 Würzburg
Tel. +49 –(0)931–660 68–0, Fax +49– (0)931–660 68–23
[email protected], www.echter.de
Visuelle Konzeption: Atelier Renate Stockreiter
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Bezugspreis: Einzelheft € 12,50
Jahresabonnement € 42,00
Studierendenabonnement € 28,00
jeweils zzgl. Versandkosten
Vertrieb: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt beim Verlag. Abonnementskündigungen sind nur zum Ende des jeweiligen Jahrgangs möglich.
Kirche – wohin?
Wie viele andere, treibt auch mich immer wieder die Frage um: Kirche – wohin? Vom Schreibtisch in meinem Büro fällt mein Blick oft auf eine kleine, verbeulte Aluminiumschüssel, eine Lota. Ich habe sie bei einem Indienaufenthalt auf einem Markt erstanden. Nur ein paar Rupees hat sie gekostet. Mir ist sie sehr wertvoll. Sie erinnert an eine Begebenheit, die Krishna Das in seinem Buch Mit den Augen der Liebe berichtet und die mir zu einer wichtigen spirituellen Einsicht geworden ist. Er schreibt: „Dada packte mich am Arm, zog mich in den Raum, den er für Maharajji bereitet hatte, und schloss die Tür hinter uns. ‚Krishna Das, ich muss dir etwas zeigen.‘ Im Zimmer stand ein alter Almirah (Schrank). Er langte oben auf den Schrank, zog einen Schlüssel herunter und öffnete damit die Tür. Er griff tief hinein und holte etwas heraus, das in ein schäbiges altes Tuch gewickelt war. Er hielt es vor mich und fragte: ‚Siehst du das?‘ ‚Nein. Was?‘ Er wickelte es aus und zeigte mir eine matte, zerbeulte, billige kleine Lota (Aluminiumschüssel). Eindringlich blickte er mich an und fragte wieder: ‚Siehst du das? Er hat es mir überlassen, als er gegangen ist. Siehst du das?‘ ‚Nein, Dada, ich sehe nicht, was du meinst.‘ Er schaute mich mit blitzenden Augen an. ‚Du brauchst nicht zu glänzen. Du brauchst nicht zu glänzen.‘ Dann wickelte er die Schüssel wieder in das schäbige Tuch und legte sie ganz zuunterst in den Schrank, verschloss die Tür, versteckte den Schlüssel oben auf dem Schrank und verließ den Raum. Mir klang noch sein ‚Du brauchst nicht zu glänzen‘ in den Ohren, während ich da stand. Ich werde es nie vergessen. (…) Eine Schale muss nicht aus Gold sein, um mit dem Nektar der Liebe gefüllt zu werden.“2
Die verbeulte Aluminiumschüssel stellt für mich diese Erfahrung im Alltag dar. Seit sie in mein Provinzialsbüro mitübersiedelt ist, tut sie es auch für meine Mitbrüder, meine Besucherinnen und Besucher. Sie ermutigt und fordert zugleich heraus.
Kirche – wohin? Bei Gisbert Greshake habe ich eine wichtige Unterscheidung gefunden. Er weist darauf hin, dass es zwei Weisen des Handelns gibt, eine herstellende und eine darstellende.3 Diese sind verschieden, wenngleich sie sich gegenseitig durchdringen und ergänzen. In der ersten, der herstellenden Weise unseres Handelns, stellen wir, wie das Wort schon sagt, etwas her. Wir tun, wir machen, wir produzieren etwas. In der zweiten, der darstellenden Weise, geht es weniger bzw. gar nicht um Machen, um Leistung, um Effizienz. Greshake wählt als Bild das Überreichen eines Rosenstraußes. Es stellt die vorgegebene, unsichtbare Liebe zweier Menschen dar. So wie das Überreichen von Rosen, so soll seelsorgliches Handeln sein. Denn Jesu Handeln war darstellendes Handeln schlechthin. Sein Verhalten, sein Tun, seine Worte – das war nichts als Ausdruck dessen, wer und wie Gott ist. Nur so kann die Frohe Botschaft, die Botschaft von der bedingungslosen Liebe Gottes glaubhaft bezeugt werden. – Wir müssen nicht glänzen! Es reicht, wenn wir zu einer Schale werden, die die Liebe Gottes aufnimmt und weitergibt. Empfangen ist wichtig, allein aber zu wenig. Nicht nur Jesus ist das Licht der Welt, auch wir sind es, können und sollen es sein. Unsere Berufung als Christinnen und Christen ist das Weitergeben, das Ausstrahlen, das Leuchten.
Den Seelen helfen, das wollte auch Ignatius von Loyola. Zusammen mit anderen wollte er Jesus, das Licht, das ihnen geschenkt wurde, hinaustragen in die Welt, zu allen Menschen. Er wollte Gefährte Jesu werden und wurde ein Mensch, der „ganz Liebe scheint“, wie einer seiner Gefährten einmal schrieb. „Die Liebe muss mehr in die Werke als in die Worte gelegt werden“ (GÜ 230). Daran erinnert Ignatius nachdrücklich. Ist das nicht die Triebfeder der Caritas als Grundfunktion von Kirche? Wir sind berufen, Menschen für andere zu sein, uns für sie einzusetzen „im Kampf für den Glauben, der den Kampf für die Gerechtigkeit miteinschließt“ (34. GK, D.2, 2). Diese Unteilbarkeit des Einsatzes ist Qualitätskriterium all unseres seelsorglichen Bemühens in der Kirche. „Indem wir Jesus betrachten, der heilt, befreit und sein ganzes Leben der Verkündigung der Guten Nachricht widmet, machen wir uns bereit, als seine Gefährten gemeinsam zu unterscheiden, auf welche Weise wir uns am besten an seinem Werk beteiligen können“ (36. GK, D.1,39–40).
Wir müssen nicht glänzen! Es reicht, wenn wir die Liebe Gottes aufnehmen und weitergeben. Papst Franziskus ermutigt uns, das auch zu tun: „Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um allen das Leben Jesu Christi anzubieten! (…) Mir ist eine ‚verbeulte‘ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist“ (EG I/49). Kirche – wohin? Hinaus, unter die Menschen, hinein, mitten in die Welt. Ohne Beulen wird das nicht zu machen sein!
1 Krishna Das, Mit den Augen der Liebe. Eine Autobiografie. Burgrain 2010.
2 Ebd., 189 f.
3 Vgl. G. Greshake, Kirche wohin? Ein real-utopischer Blick in die Zukunft. Freiburg i. Br. 2020, 133–135.
Spiel und Autorität
Über die Jesuskindverehrung der Frühen Neuzeit1
Das Jesuskind war jahrhundertelang Gegenstand einer innigen und affektiven Spiritualität, die unzählige Frauen und Männer tiefer zu Gott geführt hat. Diese Frömmigkeitspraxis hat nichts mit der jüngst in Mode gekommenen, populärwissenschaftlich vermarkteten Beziehung zum „Inneren (göttlichen) Kind“ zu tun. Vielmehr geht es um die Hinwendung zum menschgewordenen Gott als kleinem Knaben, häufig in Form einer Statue. Derartige, von anderen Figuren (etwa Maria und Joseph) isolierte Objekte werden „Jesulein“ genannt. Das berühmteste ist das „Prager Jesulein“ aus dem frühen 16. Jh., das Fürst(inn)en sowie Liebhaber(innen) aus Europa und der ganzen Welt mit unzähligen, reich ausgestatteten Kleidchen bedachten. Die wundersame „Entdeckung“ bzw. Wiederauffindung der Statue ist legendenhaft ausgeschmückt: Als der Karmelit P. Cyrill(us) von der Muttergottes (1590–1675) zufällig dieses Jesulein mit abgeschlagenen Händchen fand, soll es ihm mit der Bitte, neue zu bekommen, prophezeit haben: „Je mehr ihr mich verehrt, desto mehr werde ich euch segnen!“2 Diese Erzählung verhalf dem Kult um das „Prager Jesulein“ nicht nur zu einer ungeahnten Blüte, sondern sie zeigt neben dem Tun-Ergehen-Zusammenhang präzise den tiefsten Kern der Verehrung des Jesuskinds auf: Zwar wirkt es äußerlich wie ein kleines Wesen, schwach, auf die Fürsorge, die Liebe der Menschen und somit auf Beziehung angewiesen. Gerade aber in dieser Ohnmacht zeigt sich seine Macht und Stärke als göttlicher König und Weltenherrscher. Anschaulich wird dieses Paradox wohl am besten anhand der Worte Edith Steins (1891–1942), die sie wenige Monate vor ihrem grausamen Tod in Bezug auf das „Prager Jesulein“ und die nationalsozialistische Terrorherrschaft schrieb: „Ist es [das Jesuskind] nicht der ‚heimliche Kaiser‘, der einmal aller Not ein Ende machen soll? Es hat ja doch die Zügel in der Hand, wenn auch die Menschen zu regieren meinen.“3
Historische Einbettung4
Die Wurzeln der Jesuskind-Frömmigkeit reichen bis ins Hochmittelalter, in dem Eucharistiewunder tradiert wurden. Legenden, wonach sich die Hostie auf wundersame Weise ins lebendige Jesuskind verwandelte, erfreuten sich großer Beliebtheit. Vollends entfaltete sich die an der Menschheit Jesu orientierte Verehrungskultur im klösterlichen, mystisch affinen italienischen und deutschen Sprachraum in Form eines geistlichen Spiels. Im 12. Jh. fokussierten sich die Verehrerinnen und Verehrer bewusst auf innere Visionen und verzichteten absichtlich auf materielle Figuren und reale Spielrequisiten. Gertrud von Helfta (1256–1301/02) etwa lehnte diese dezidiert ab, weil solche Utensilien vom eigentlichen Geheimnis und der ungehinderten Schau Gottes ablenken.
Wann und warum eine Transformation zu einer stark objektorientierten Frömmigkeit einsetzte, kann die Forschung bislang nicht eindeutig beantworten. Gesichert ist aber, dass die ältesten Kunstwerke italienischen und deutschen Ursprungs sind sowie aus dem späten 13. bzw. frühen 14. Jh. stammten. Bernhard von Clairvaux (1090–1153) gab der geistlichen Praxis das entsprechende theologische Fundament. Es gibt stehende, liegende oder thronende, bekleidete oder nackte Objekte zwischen neun und fünfzig Zentimetern. Im Laufe der Zeit wurde die realitätsnahe Gestaltung immer wichtiger. Beim kleinen Knaben durften deshalb kleine Speckröllchen um den Bauch, fein geschwungene Ringellöckchen, wie sie nur Prinzen tragen durften, ein präzis ausgearbeitetes Geschlechtsteil sowie vielfältige Accessoires (Kreuz, Passionsfrucht etc.) nicht fehlen. Ab dem 15. Jh. setzte sich die typische stehende Figur, genannt „Weltheiland“, durch, mit Ringellöckchen-Frisur, leicht vorgestelltem linken Bein sowie mit der Weltkugel in der rechten Hand bzw. dem zur Segensgeste erhobenen Arm. In diesem Sujet war die einzigartige Verbindung der menschlichen und göttlichen Natur Jesu Christi angedeutet. Italien, Spanien und Portugal stiegen zu führenden Herstellerzentren auf.
Die Frauengemeinschaften behielten ihre Vorreiter- und Vorbildfunktion bei, aber die Frömmigkeit breitete sich weit über die Klostergrenzen hinaus aus. Berühmte Statuen wie der „Bambino Gesù“ von Aracoeli, das „Reutberger Jesulein“ oder das „Salzburger Lorettokindl“, die der Mittelpunkt weltberühmter Wallfahrtszentren wurden, zeugen von der Beliebtheit dieser Jesusknaben. Im 17. und 18. Jh. hatten sich die kleinen Statuen längst ihren Stammplatz in Klöstern, adeligen Häusern und Pfarrkirchen erobert. Die Verehrungskultur war nicht auf die Weihnachtszeit beschränkt. Sie sollte das gesamte Jahr und das ganze Leben prägen. Jede Familie, die es sich leisten konnte, schenkte der Tochter zum Klostereintritt bzw. zur Hochzeit ein „himmlisches Trösterlein“. Nicht selten reichte man dieses von Generation zu Generation weiter und stattete es mit verschiedenen Kleidchen, je nach liturgischem Festkreis, sowie kostbaren Accessoires aus. In Klöstern war das Jesulein meist obligatorischer Bestandteil der Mitgift. Interessanterweise ordnete man es aber nicht liturgischen Utensilien wie Gebetbüchern u.a. zu; es wurde an oberster Stelle aufgelistet. Es gehörte eben zur bräutlichen Ausstattung und sollte der anfangs wohl von Heimweh geplagten jungen Frau Heimeligkeit, Geborgenheit und zuallererst einen Gesprächspartner schenken. Im Kloster galt die Betrachtung der Inkarnation ebenso wie die Meditation der Passion als höchste Stufe im geistlichen Leben. Insofern waren diese Statuen ein vorzügliches Mittel, um eine tiefe Beziehung zum menschgewordenen Gott aufzubauen und in der Interaktion mit dem Sujet gleichzeitig in Tugenden, Demut, Sanftheit, Geduld o.Ä. zu wachsen und so zur ersehnten Heiligkeit zu gelangen.
Das geistliche Spiel
Häufig wurde und wird diese Frömmigkeit als infantiles Puppenspiel für unreife, einfältige Ordensschwestern diffamiert. Klar ist, dass diese Statuen in der Frühen Neuzeit als eine realpräsente Darstellung Gottes galten und somit Frauen und Männern die Möglichkeit boten, Jesus Christus sinnlich, ungezwungen, persönlich und individuell anzubeten und zu lieben. Im Unterschied zur Eucharistischen Anbetung, welche sich im Katholizismus ab dem 16. Jh. großer Beliebtheit erfreute, aber nur in einer öffentlichen Kirche und lediglich bei Anwesenheit eines Priesters abgehalten werden durfte, konnte etwa die Nonne in ihrer Klosterzelle – im einzigen Rückzugsort, in dem sie ungestört allein war – das göttliche Kindlein nicht nur ostentativ verehren, sondern es ganz nach Belieben umkleiden, wiegen, küssen und sich somit einem sakralen Spiel ohne Grenzen hingeben.
Die papstorientierte, streng hierarchisch aufgebaute Institution fokussierte sich in der Frühen Neuzeit immer mehr auf den Priester als Autoritätsfigur und Repräsentanten der Römischen Kirche. Diesem übertrug sie die Verwaltung des Allerheiligsten, die Monstranz, und stellte ihm auf diese Weise – wie Michel de Certeau5 betont – ein „pastorales Werkzeug“ zur Verfügung. Daher kann man sagen, dass der zur Anbetung ausgesetzte Leib Christi das „‚Sakrament‘ der Institution“ darstellte. Ohne Priester gab es keine Eucharistische Anbetung. Folglich lag es in seiner Macht und Kompetenz, den Gläubigen den Kontakt mit dem in der Monstranz realpräsenten Gott zu gestatten oder zu verweigern. Mit dieser Eucharistiepraxis konnten die Kleriker die Laien gewissermaßen unterjochen und ihre eigene Person als priesterlicher Verwalter des höchsten Guts in den Vordergrund rücken. Doch Jesus Christus wirklich, unmittelbar, direkt geistlich zu „sehen“ und ihm die eigenen Bitten und Nöte vorbringen zu dürfen, war unzähligen Christ(inn)en ein echtes Anliegen und geistliches Bedürfnis.
Insbesondere Ordensfrauen, die sich nach einer innigen Gottesbegegnung sehnten, ließen sich durch diesen instrumentalistischen Gebrauch des Leibes Christi über die Messfeier hinaus nicht zufriedenstellen. Sie suchten eigenwillig und eigenständig nach neuen spirituellen Wegen, um ihre Sehnsucht nach Gottes Gegenwart zu stillen. In der Jesuskind-Statue fanden sie neben einer Lösungsstrategie einen unmittelbaren sakralen Spiel- und Gesprächspartner. Im Jesulein schufen sie sich eine, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, private (Quasi-)Monstranz. Ich schlage dafür in Anlehnung an Michel de Certeau die Bezeichnung „Sakrament des Individuums“ vor. Es fungierte als göttliches Du, mit dem die Beziehung zu Gott leidenschaftlich, den rigiden und einengenden Anforderungen des streng reglementierten klösterlichen Lebens enthoben, realisiert werden konnte. Hier, in der Statue, war Jesus da, anwesend, präsent, ansprech- und verfügbar. In diesem intimen Zusammensein zwischen Gott und Mensch bekam all das Raum, was die Kirche als Aberglauben, Sentimentalität und Kitsch verpönt, aus der Liturgie ersatzlos gestrichen und den gläubigen Christ(inn)en verboten hatte. In dieser misslichen Lage garantierte das göttliche Kindlein die Anwesenheit Gottes in der Welt. Noch dazu wirkte es wie ein lebendiger Beweis, dass sich Jesus mit den Menschen solidarisch zeigte. Die realitätsnahen Objekte blicken mit großen, erwartungsvollen Augen und sprechendem Mund das Gegenüber an, haben die Arme häufig weit ausgestreckt oder zum Segen erhoben, so als ob sie sich nach Kommunikation, einer Umarmung, kurzum nach echter Begegnung sehnen. Die Statuen ermöglichten es, mit Gott zu „spielen“, d.h. in einer unverzweckten, bedingungslosen Beziehung mit ihm zu leben. Sie wirken schwach, bedürftig, verheißen gleichzeitig als Inbegriff göttlicher Präsenz Vergebung, bedingungslose Liebe sowie die greif- und fühlbare Nähe Jesu.
Heimlicher Widerstand
Das subversive Potenzial dieser Spiritualität sowie die damit einhergehende Möglichkeit, eine eigene private Monstranz mit dem realpräsent geglaubten Jesus Christus zu besitzen, war allerdings untrennbar mit der kirchlichen Institution verbunden. Denn diese hatte durch das Bilderdekret des Konzils von Trient (1545–1563) zwar einerseits emotionale Auswüchse bei der Verehrung drosseln wollen, andererseits berühmte, Gnaden und geistliche Zuwendungen schenkende Statuen materiell sowie ideell rege unterstützt und dadurch die Devotion implizit gefördert. Die Liebhaber(innen) des Jesuleins verehrten das göttliche Kind aber nicht „nach Vorschrift“ und offizieller Handreichung; sie verwendeten das kirchliche Produkt nach eigenem Belieben. Sie wussten um den Supplementcharakter der Objekte, verfielen nicht einer naiven Gleichsetzung von Gott und toter Materie, aber sie arrangierten sich mit dem, was ihnen zur Verfügung stand, sowie der Beamte im Roman Witold Gombrowiczs, als er sagt: „Wenn man nicht hat, was man liebt, [s]o liebt man, was man hat.“6 Michel de Certeau7 zeigt im Zusammenhang mit Alltagspraktiken und dem Konsumverhalten des modernen Menschen auf, dass die Produzenten als Mächtige ihre Produkte anbieten, wobei der Verbraucher diesen Anbietern dennoch keineswegs passiv und hilflos ausgeliefert ist. Denn er ist in der Lage, durch geschickte Kombination einen kreativen Umgang mit den angebotenen Waren eine neue, seinen Bedürfnissen entsprechende Kultur zu schaffen. Dieselbe List erfolgte bei der frühneuzeitlichen Jesuskind-Verehrung: Man verwendete die Statuen weder genau gemäß den institutionell vorgeschriebenen Regeln noch als Ersatz für die Katholische Kirche, denn die Verehrer(innen) wandten sich nicht offiziell von der Institution ab. Aber sie bauten eine, den ursprünglichen Zweck „pervertierende“ Beziehung mit dem Jesulein auf und fanden im unbeschwerten, leidenschaftlichen Umgang mit dem Objekt eine ganz neue Freiheit von der Kirche und deren Angeboten. Die unmittelbare Interaktion mit dem göttlichen Kindlein war eine Form des Widerstands, eine bewusst unverschämte Taktik, mit deren Hilfe religiös affine Menschen den „Mächtigen“, d.h. den kontrollierenden, normierenden und teils manipulativ agierenden klösterlichen bzw. kirchlichen Institutionen, ausweichen konnten, indem sie sich eine eigene, nach ihren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtete Devotionskultur schufen, und zwar mit den offiziell angebotenen „Produkten“, den Jesulein.
Eine göttliche Autorität
Diese selbst geschaffene Frömmigkeitskultur mit dem Jesusknaben im Zentrum beschränkte sich aber nicht auf die eigene Zelle als privates Refugium. Im Kloster galt das Jesulein als „himmlischer Bräutigam“ der Ordensfrau. Nachweislich legten viele Schwestern ihre Profess keineswegs nur vor der Oberin ab. Auf dem Altar wurde vielmehr neben dem Allerheiligsten – und damit in unübersehbarer Konkurrenz – die persönliche Statue platziert. Auge in Auge versprach die Betreffende Gott als ihrem Lebensgefährten Armut, Gehorsam und Keuschheit. Zeichen göttlicher Präsenz inmitten dieser sakralen Zeremonie war nicht ein Kruzifix oder dergleichen, sondern das kleine Jesuskind. Die gesamte Feier und vor allem der liturgische Auszug hatten zweifellos Anklänge an eine weltliche Hochzeit, denn die Ordensfrau zog wie eine Braut feierlich mit dem Jesulein aus der Kirche. Der Übergang in die Klausur, also in jenen sakralen Raum, den sie nach ihrer Einkleidung bzw. Profess nicht mehr verließ, geschah ebenfalls samt „Trösterlein“, was darauf hindeutet, dass es in Krisenphasen und Lebensübergängen präsent war und die Ordensfrau an die liebende Nähe Jesu erinnern sollte. In ähnlicher Weise hatte Teresa von Ávila (1515–1582) während ihrer Reisen immer eine Statue bei sich, wiegte das Kindlein in der Kutsche, sang ihm Lieder und unterhielt sich mit ihm. Laut einer Mitschwester war Teresa der Meinung, dass für eine Klostergründung vier Dinge notwendig seien: ein Miethaus, ein kleines Glöcklein, der hl. Joseph und das Jesuskind. Außerdem sind zwei Namen ihrer persönlichen Objekte bezeugt. Eines hieß „el Parlero“ („der Gesprächige“), denn es plauderte mit ihr. Das zweite nannte sie „el Lloroncito“ („der Weinende“), weil es beim Abschied Tränen vergossen hatte. In ihren eigenen Werken finden sich lediglich geistliche Erfahrungen mit dem göttlichen Kind, etwa Visionen, und keine Hinweise auf Praktiken mit Statuen. Aber ersichtlich ist, dass die Jesulein-Verehrung in der karmelitischen Spiritualität eine zentrale Rolle einnimmt.8
Auch die Mystikerin und Gründerin der Brixner franziskanischen Regulierten Tertiarinnen, Maria Hueber (1653–1705), schildert in einem Brief, dass sie unbedingt mit ihrem Beichtvater sprechen wolle. Als dieser sie mit dem Einwand, keine Zeit zu haben, abwies, ging sie in ihre Zelle, kniete sich vor ihrem persönlichen Jesulein hin, bat es unter Tränen um geistlichen Rat und flehte es an, es möge ihr doch sagen, was sie tun solle. Daraufhin erhielt sie interessanterweise keine Handlungsanweisung, sondern sie spürte neue Kraft in ihrem Leib und ihrer Seele und erfuhr die Befreiung von ihren Ängsten. Offensichtlich nahm das Objekt eine Autoritätsrolle ein, nämlich als Bräutigam, Versorger, Ratgeber, Erzieher, Tröster, als göttlicher Freund und teils gleichberechtigter Partner, der auf Gegenliebe und Zuwendung angewiesen war sowie mit geistigen Augen geschaut, sinnlich erlebt, ja gleichsam ertastet werden konnte und wollte.9
Neben den privaten Statuen gab es außerdem kollektiv verehrte Sujets, die in weiblichen Gemeinschaften, sicherlich nicht zufällig patriarchal-protegierend, „Hausvater“, „Herrlein“ u.Ä. genannt wurden, den geistlichen Mittelpunkt des Konvents bildeten und die Rolle als Oberhaupt desselben einnahmen. Die Karmelitinnen legten ihre Gelübde vor dem privaten Jesulein Teresas ab, das man „el Mayorazgo“ („der Familienälteste“) nannte. Ihm schenkten die Schwestern außerdem am Jahresende ein Säckchen, damit er im neuen Jahr in seiner unübersehbaren Rolle als Hauspatron und Versorger weiterhin für die Frauen Sorge trage.10
Ebenso erhoben die Maria-Hueber-Schwestern das Jesulein der Gründerin gleichsam zum „Gnadenkind“ der gesamten Gemeinschaft. Denn neben wundersamen Legenden ist belegt, dass die Anwärterinnen dem Sujet als Mitgift ihren Schmuck, vor allem ihre Ringe, vermachten, der am Postament befestigt wurde. Außerdem „bestellten“ Frauen der Stadt beim Jesulein Novenen, sodass sich seine Strahl- und Wirkkraft nicht nur auf das Kloster beschränkte.11
Klar ist, dass diese kollektiv verehrten Statuen eine spirituelle Bezugsperson sowie die (geistlich präsente) „symbolisch-rituelle Autorität“12 der Kommunität bildeten. Der Umstand, dass in manchen Gemeinschaften der „Hausherr“ des Klosters auf dem Platz der Äbtissin positioniert wurde, zeigt, dass er in der klösterlichen Hierarchie die oberste Stelle einnahm und damit in Konkurrenz zur Oberin, aber auch zum Superior, dem die Frauengemeinschaft unterstellt war, trat. Auf diese Weise konnten sich die Schwestern von unliebsamen Leitungsinstanzen distanzieren und emanzipieren, indem sie – zwar nur symbolisch – subtil an die Stelle der Klostervorsteher eine andere, mächtigere, von menschlichen Interessen unabhängige und sich um das Wohl jeder einzelnen Schwester sorgende Figur setzten, und zwar Gott selbst in Gestalt des Jesuleins. Dieses, und eben nicht die oftmals allzu menschlichen Vorgesetzten, die Oberin oder der Superior, war nun das Oberhaupt des Klosters, der oberste Befehlshaber, der Weisung gab, Recht sprach und dem Gehorsam gebührte; alle anderen Autoritäten waren nur dessen Stellvertreter. Die Hinwendung zum Jesuskind sowie die Anerkennung seiner universalen Macht boten den Verehrer(inne)n eine ungehinderte Begegnung mit dem Göttlichen, eine neue, grenzenlose Freiheit ohne Scheu vor gesellschaftlichen sowie kirchlichen Zwängen.
Eine Spiritualität für die heutige Zeit?
Spiritualität ist Gottsuche, das Voranschreiten im Leben, Glauben und Fühlen mit der drängenden existenziellen Frage: „Wo bist du, Gott?“ Die sehnsuchtsvolle Suche, also der Mangel, nicht der Reichtum, ist der Ausgangspunkt. Michel de Certeau13 weist darauf hin, dass sich die Menschen (der Neuzeit gleichermaßen wie heute?) stets neue Körper schufen und schaffen, um den Schmerz, dass Jesus Christus nicht direkt greifbar, nicht leibhaftig anwesend ist, zu kompensieren: Devotionalien, Statuen, Riten, Orte, Persönlichkeiten, Glaubensmeinungen usw. Es geht nicht darum, diesen Wunsch zu verleugnen oder gar zu verurteilen. Die Jesulein-Devotion zeigt dieses elementare Bedürfnis nur präzise auf und bietet Bewältigungsmöglichkeiten, insofern die Objekte eine haptische Erinnerung an das Charakteristikum des christlichen Glaubens sind: dass Gott in der Person Jesu Christi Mensch geworden ist und seine Welt – so wie sie ist, samt ihrer elenden Misere – bejaht.
Die winzigen, aufwendig bestickten Kleidchen sowie die mütterlich-protegierenden Rituale des Kindleinwiegens, -bettens und -küssens konfrontieren uns mit unseren inneren Widerständen, unseren Grenzen im Verstehen und Nachvollziehen sowie unserem Unvermögen, uns in historisch ferne Frömmigkeitsformen, in das Empfinden und Erfahren frühneuzeitlicher Frauen und Männer einfühlen zu können. Diese Fremdheit gilt es auszuhalten. Handelt es sich bei diesen Praktiken um subtile Sublimation unterdrückter sexueller Gefühle oder nicht ausgelebter Mutterinstinkte? Zeugen diese Statuen, Kleidchen und Accessoires von einem infantil gebliebenen Glaubensleben? Hier sind vorschnelle Urteile fehl am Platz. Denn die Jesuskind-Spiritualität motiviert zu einer reflektierten, möglichst unvoreingenommenen, vorurteils- und wertfreien Auseinandersetzung mit Frömmigkeitsformen vergangener Zeiten, die Generationen unserer Vorfahren jahrhundertelang geprägt und geistlich genährt haben. Diese Spiritualität kann uns schmerzlich unser oft zwanghaftes Bedürfnis, Personen, deren Glauben und religiöse Praxis zu kontrollieren, vor Augen führen, d.h. im Grunde unser Streben, Gott und seiner Macht habhaft zu werden. Die spielerische, sinnliche Interaktion mit den materiellen Objekten zeigt auf, dass es jenseits der offiziell vorgeschriebenen, nach außen besonders tugendhaft wirkenden, teils zur Schau gestellten Frömmigkeit immer Nischen sowie Refugien gibt und geben muss, in denen die zutiefst persönliche Beziehung zum menschgewordenen Gott fern aller Normen und (sinnvollen) Riten auf intime Weise praktiziert und vollzogen wird.
Die Aktualität der Jesuskind-Frömmigkeit liegt nicht darin, frühneuzeitliche Praktiken zu imitieren und sie irgendwie, mehr schlecht als recht zu „modernisieren“, sondern im Eingeständnis der Notwendigkeit, phasenweise im Rahmen der Gottsuche auf materielle Hilfen als Zeichen der göttlichen Präsenz im eigenen Leben zurückgreifen zu müssen und zu dürfen. In der Beschäftigung mit dem Jesulein wird das Angewiesensein auf ein göttliches Du, das sich menschlicher Sprache und Kommunikation bedient, um sich verständlich zu machen, bewusst. Wir erfahren in unserer erlösungsbedürftigen Schwachheit und Begrenztheit die solidarische Nähe Jesu, der sich freiwillig als wehrloses Kind den Menschen und der Welt aussetzt und uns seine bedingungslose Liebe offenbart. Inmitten unserer Unzulänglichkeit sind wir jederzeit gehalten und mit seiner Gegenwart beschenkt. Niemandem sind unfrei machende, einengende Strukturen und Beziehungen fremd. Sich als christlich gesinnter Mensch Gott restlos und vorbehaltslos anzuvertrauen, befreit und entlastet, denn er ist die uneingeschränkte göttliche Autorität, die jede menschliche Macht überragt. Das Jesulein, das wehrlose, bedürftige, sich nach unserer Liebe sehnende Kind ist der absolute Herr. Dieses Paradox kann Leben und Wirken nähren, Kraft schenken sowie neue Horizonte eröffnen.