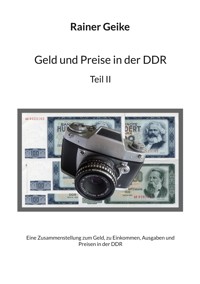
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
2014 war ein erstes Buch zu diesem Thema fertig geworden, seit 2020 ist es im Handel: "Geld und Preise in der DDR - Was bekamen wir für unser Geld?". Kein anderes Buch widmet sich so intensiv dem Thema Preise und der ganzen Breite der Ausgaben. Die Resonanz im Bekanntenkreis war sehr gut, alle steuerten Dokumente und Erinnerungsstücke bei. Also ging die Beschäftigung mit dem Thema weiter. Es wurde um neue Aspekte erweitert, um "Stipendium" und "Rente" als Einstieg in das Gebiet der Einkommen, ergänzt um Lohnstreifen, Lohnsteuern und SV-Beitrag. Außerdem wurde das Thema zeitlich nach "vorn" erweitert, um die Abschnitte zur Währungsreform 1948, zum Geldumtausch 1957, zu Wohnungsbau-Obligationen ab Ende der 1950er Jahre. Mit der ebenfalls behandelten Abschaffung der Lebensmittelkarten 1958 war auch eine umfassende Preisreform verbunden, viele der bis zum Ende der DDR gültigen Preise wurden damals festgelegt. Ein ebenfalls umfangreicher und sehr interessanter Abschnitt beschäftigt sich mit dem Hauskauf, dem dazu gehörigen Kredit und den notwendigen Handwerkerleistungen. Die zusammengestellten Handwerkerrechnungen machen den ungeheuren bürokratischen Aufwand deutlich, der mit dem Festhalten an konstanten Preisen für die Bevölkerung trotz steigender Material- und Personalkosten verbunden war. Der "rote Faden" wird im zweiten Teil durch das Thema "Preise" gebildet. Ein Ausweis der über lange Zeit konstant gehaltenen Preise sind die vielen heute noch vorhandenen Sachzeugen aus Kunststoff oder Metall mit "eingeprägtem" Preis. Mit vielen Dingen sind zusätzliche Erinnerungen verknüpft. Das betrifft beispielsweise Werbung / Propaganda auf Rechnungen oder das Ausfuhrverbot für hochwertige Konsumgüter. Oder einfach auch die Veränderung von Gepflogenheiten - kommt der Gasmann jeden Monat und kassiert den fälligen Beitrag oder werden Monatspauschalen vom Konto abgebucht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Gedanken zur Einführung
2. Neues Geld brauchte das Land
2.1 Währungsreform 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
2.2 Oktober 1957
3. Obligationen der Kommunalen Wohnungsverwaltungen
4. Einkommen: Stipendium
5. Einkommen: Renten der Sozialversicherung
6. Lohnstreifen - Lohnsteuern und SV-Beitrag in der DDR
7. Haus- und Grundstückskauf, Kredite, Handwerkerrechnungen
7.1 Haus- und Grundstückskauf
7.2 Kredite für Kauf, Bau bzw. Instandsetzung eines Einfamilienhauses
7.3 Handwerkerrechnungen in der DDR
8. 1958 - Abschaffung der Lebensmittelmarken und umfassende Preisreform
9. Preise, Preise, ...
9.1 ... dafür den richtigen Preis
9.2 Spirituosenpreise - ein kleiner Ausschnitt aus dem Thema Preise
9.3 Preise fixiert in Kunststoff und Metall
10. Freizeit, Hobby, Spielen,
10.1 Früh übt sich ... – Spielgeld und Postspiel in der DDR
10.2 Spielzeugeisenbahn Electra
10.3 Karten- und andere Gesellschaftsspiele
10.4 Buchreihen und ihre Preise
11. Theater
12. Besondere Erinnerungen und Erinnerungsstücke
12.1. Ein Lottogewinn: Trabant 601
12.2 Solidarität
12.3 Fotoapparat Exa II a
12.4 Wenn der Gasmann kommt
12.5 Münzschatz aus der Räucherkammer
13. Gedanken zum Schluss
Bisher vom Autor erschienene Bücher
Anmerkungen
1. Gedanken zur Einführung
Im vorgerückten Alter - so etwa, wenn man die 50 überschritten hat - kommen die Fragen nach der Vergangenheit. Man sucht die alten Fotos raus und stellt fest, das so vieles nie fotografiert wurde: die Wohnung, die Arbeit in der Küche und im Garten, die Arbeit in Büro oder Werkhalle - der Alltag eben.
Aber auch andere Fragen tauchen vielleicht auf. Was haben die Wohnung und deren Einrichtung gekostet? Und wie teuer war das erste Auto? Was hat dieses und jenes gekostet? Und wie viel Geld haben wir damals eigentlich verdient? Und wenn das eigene Hobby mit Münzen und Geldscheinen zu tun hat – und man häufig gefragt wird – was es denn damals für das Geld zu kaufen gab, beschäftigt man sich auch mit den letztgenannten Fragen nach Einkommen und Preisen. Die Beantwortung dieser Fragen ist aufwendig, aber mindestens ebenso interessant wie die Beschäftigung mit Bildern und Texten auf den Geldzeichen.
Viele Dinge scheinen so fest im Gedächtnis verankert, dass sie nicht vergessen werden können. Das Geld, mit dem man täglich bezahlt, gehört sicher dazu. Aber wie viele aus der Generation 75+ wissen noch, dass es bis 1964 DM-Ost und DM-West gab, das erste Geld in der DDR eben auch „Deutsche Mark“ hieß?
Aus der Beschäftigung mit diesem Thema entstanden 2008 ein Vortrag zum Thema „Das Geld - was war es wert?“ im Numismatik-Verein und 2010 ein erster Überblicksartikel im Jahrbuch des Vereins. Die Vereinsfreunde erzählten, es wäre der erste Artikel gewesen, den auch ihre Frauen gern gelesen hätten. Im Laufe der Jahre haben viele Vereinsfreunde, Nachbarn, Kollegen, Freunde und Verwandte Material zum Thema beigesteuert. 2012 erschien ein zweiter Beitrag zum Thema „Ehekredit“.
Das gesammelte Material ist im Laufe der Jahre mehr geworden. Die von Freunden und Bekannten beigesteuerten Dokumente und Belegstücke füllen mittlerweile etliche Ordner und Kisten. Und auch für jede beantwortete Frage sind mindestens zwei neue aufgetaucht. Sehr schnell kamen zu den zwei ersten Beiträgen viele weitere Seiten Text und Abbildungen zusammen. 2014 war daraus ein ganzes Buch geworden, gedruckt in der Hochschuldruckerei und verteilt an Verwandte und Bekannte. 2020 habe ich das Buch noch einmal geringfügig überarbeitet und als „richtiges“ Buch drucken lassen.
In diesem ersten Buch „Geld und Preise in der DDR - Was bekamen wir für unser Geld?“ waren die Schwerpunkte
Münzen und Geldscheine „Brutto“ und „Netto“ sowie die festen monatlichen Ausgaben, Sparen auf Sparbuch und im Wäscheschrank Ehekredit Öffentlicher Personenverkehr Autokauf Zeitungen und Fernsehen - Bezug über den Postzeitungsvertrieb Gaststätten und Speisekarten / Preise für dies und das.
Von Käufern, die das Buch über den Handel erworben haben, habe ich keine Rückmeldung. Bekannte aber, die das Buch von mir erhalten haben, sind begeistert. Und forderten die Beschäftigung mit vielen weiteren Themen und auch mit der Zeit vor 1970, der ungefähren zeitlichen Grenze im ersten Buch.
Angeregt durch entsprechende Sachzeugnisse habe ich das auch getan. Die dabei erhaltenen Ergebnisse für die Zeit vor 1970 sind sicher genau so interessant wie die die 1970er und 1980er Jahre betreffenden. Aber man kann eben nicht beim Lesen nicken und sagen, ja so wars. Auch heute 80jährige waren zur Währungsreform 1948 noch Kinder. Und auch 1958 bei der Abschaffung der Lebensmittelmarken noch sehr jung.
Die Menge der seit 2015 neu dazu gekommenen Beiträge, teils gedruckt, teils (nur) im Bekanntenkreis verteilt, füllt nun ein zweites Buch. Die Mehrzahl der Themen basiert entweder wieder auf persönlichen Daten und Erinnerungen oder auf „Sachzeugnissen“ aus dem Bekanntenkreis einschließlich der dazu gehörigen Geschichten.
Neu dazu gekommen sind die Themen „Stipendium“ und „Rente“ als Einstieg in das Gebiet der Einkommen, ergänzt um Lohnstreifen und das Thema Lohnsteuern und SV-Beitrag.
Ein ebenfalls umfangreicher und sehr interessanter Abschnitt beschäftigt sich mit dem Hauskauf, dem dazu gehörigen Kredit und den notwendigen Handwerkerleistungen. Die zusammengestellten Handwerkerrechnungen machen den ungeheuren bürokratischen Aufwand deutlich, der mit dem Festhalten an konstanten Preisen für die Bevölkerung trotz steigender Material- und Personalkosten verbunden war.
Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt also zunächst wieder in den 1970er und 1980er Jahren, allerdings ergänzt um die oben bereits genannten Abschnitte zur Währungsreform 1948 sowie zur Abschaffung der Lebensmittelkarten 1958. Denn damit war auch eine umfassende Preisreform verbunden, viele der bis zum Ende der DDR gültigen Preise wurden damals festgelegt.
Der „rote Faden“ wird im zweiten Teil, nach Währungsreform, Renten und Stipendien durch das Thema „Preise“ gebildet. Spannend finde ich, dass mit vielen Dingen zusätzliche Erinnerungen verknüpft sind. Das betrifft beispielsweise die Werbung / Propaganda auf Rechnungen oder das Ausfuhrverbot für hochwertige Konsumgüter. Oder einfach auch die Veränderung von Gepflogenheiten - kommt der Gasmann jeden Monat und kassiert den fälligen Beitrag oder werden Monatspauschalen vom Konto abgebucht?
Immer wieder wird versucht, Einkommen oder Preise aus vergangenen Zeiten umzurechnen oder mit heutigen Werten zu vergleichen. Bei gleicher Preisstruktur kann das funktionieren, bei völlig anderer Preisstruktur ist es praktisch aussichtslos. Je nach dem zum Vergleich herangezogenen Produkt - Gegenstand oder Dienstleistung - ergeben sich unter Umständen völlig unterschiedliche „Bilder“.
Bier war im Laden vergleichsweise teuer. Ein halber Liter normales Pils kostete in der Flasche 0,91 M. Das entsprach 18 einfachen Brötchen a 5 Pfennig. Oder man vergleicht den Bierpreis mit der Miete unserer ersten 2½-Zimmer-Wohnung (54,95 m2) in Halle-Neustadt, in der wir von 1977 bis 1985 gewohnt haben. Die Warmmiete für unsere Genossenschaftswohnung - also inkl. Warmwasser und Heizung - betrug 81,30 M. Davon hätte man 89 Halbliterflaschen Pils kaufen können. Verglichen mit heutigen Preisen war entweder das Bier sehr teuer oder die Miete sehr niedrig - beides ist mit Sicherheit zutreffend.
Der Einzelpreis einer Berliner Zeitung betrug 15 Pfennig und der der BZ am Abend (heute Berliner Kurier) 10 Pfennig. Der Gegenwert von 6 Ausgaben der Berliner Zeitung oder von 9 Ausgaben der BZ am Abend ergab jeweils eine Flasche Pils!
Wie auch im ersten Buch habe ich mich bemüht, wo immer sinnvoll und möglich, den Text durch Anmerkungen zu ergänzen, teils zur Erklärung von heute nicht mehr verständlichen Begriffen oder Sachverhalten, teils als Quellenangabe für weitere Recherchen.
Abschließend gilt mein ganz herzlicher Dank all denen, die mit Dokumenten, Sachzeugnissen und / oder Informationen zum Entstehen des Buches beigetragen haben. Danke! Danke! Danke!
2. Neues Geld brauchte das Land
2.1 Währungsreform 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ)
Eine Währungsreform war im Nachkriegsdeutschland dringend notwendig, das war allen klar - Besatzungsmächten und Bevölkerung. Warenangebot und vorhandene Geldmenge passten überhaupt nicht zusammen. Die vier Alliierten hatten sich bis 1948 auf Grundsätze einer solchen Reform geeinigt. Parallel bereiteten die westlichen Alliierten jedoch eine separate Währungsreform vor. Auch in der Sowjetunion wurden erste Vorbereitungen für eine Währungsreform in Deutschland getroffen.
Abb. 2.1: Titelthema der Berliner Zeitung vom Mittwoch, dem 23. Juni 1948
Am 19. Juni 1948 wurde sie angekündigt, die Deutsche Mark, am 21. Juni wurde sie in den Westzonen eingeführt. Damit war Deutschland, lange vor der Gründung der beiden deutschen Staaten, endgültig gespalten.
Als sich die Gerüchte über eine bevorstehende separate Währungsreform im Westen verdichteten, waren eigene Arbeiten zur Herstellung neuer Geldscheine noch längst nicht abgeschlossen. Es musste eine sehr schnelle Lösung gefunden werden. Diese „schnelle“ Lösung für den Osten bestand in Klebemarken oder Kupons, mit denen die bisher genutzten Rentenmark- und Reichsmarkscheine beklebt wurden, sie bildeten für vier Wochen eine Übergangslösung. Nicht beklebt wurden die ebenfalls im Umlauf befindlichen Scheine, die auf Mark der Alliierten Militärbehörden lauteten. Ohne diese schnelle Aktion wären gewaltige Massen von im Westen ungültig gewordenem Geld in den Osten geströmt.
Abb. 2.2: Auszug aus dem Befehl des Obersten Chefs der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland Nr. 111 (Berliner Zeitung 23.6.1948)
Die Grundsätze der Währungsreform wurden am 22. Juni in den Tageszeitungen vorgestellt, am 23. Juni war es das dominierende Thema (Abb. 2.1). Entsprechend dem Befehl Nr. 111 des Marschalls Sokolowskij sollte im Zeitraum vom 24. bis zum 28.6. der komplette Geldumtausch stattfinden (Abb. 2.2). Im Handel waren die alten - nicht beklebten - Scheine nur bis zum 25.6. zugelassen.
Noch während die Vorbereitungen zur Währungsreform im Osten Deutschlands inkl. der Stadt Berlin liefen, ordneten die Militärkommandanten der drei Westmächte am Morgen des 23.6. die Einführung der D-Mark auch in den westlichen Sektoren Berlins an, die bisher von der Währungsreform der westlichen Besatzungszonen ausgenommen waren.1
Die Währungsreform im Osten diente zunächst, wie auch im Westen Deutschlands, der Reduzierung der Bargeldmenge. Pro Kopf wurden 70 Mark im Verhältnis 1:1 getauscht. Beträge bis 5000 Mark pro Familie wurden im Verhältnis 10:1 getauscht, für darüber hinaus gehende Beträge musste der rechtmäßige Erwerb nachgewiesen werden. Spareinlagen bis 100 Mark wurden im Verhältnis 1:1, bis 1000 Mark im Verhältnis 5:1 getauscht. Weitere Regelungen betrafen Versicherungen (Umwertung 3:1) und seit Mai 1945 gesperrte Konten. Löhne, Gehälter, Renten und Preise von Waren und Dienstleistungen blieben unverändert. Die Konten staatlicher / kommunaler Betriebe wurden 1:1 umgestellt, für andere Betriebe hing die zu Vorzugsbedingungen umgestellte Geldmenge von Umsatz und Lohnmenge ab. Als „Personaldokument“ musste beim Geldumtausch die Lebensmittelkarte für den laufenden Monat vorgelegt bzw. abgegeben werden.
Abb. 2.3: Aushang vom 23.6.1948 zur Währungsreform, [SLUB, Deutsche Fotothek, Foto von Renate & Roger Rössing]
Abb. 2.3 zeigt ein Foto aus Leipzig mit einem Aushang vom 23. Juni, der über wichtige Punkte der Währungsreform informiert. Aushänge waren zu dieser Zeit sicher ein wichtiges Informationsmedium, neben Radio und Zeitung. Unter der Überschrift „Die Stadtverwaltung teilt mit“ heißt es
„Alle städtischen Kassen- und Zahlstellen sind am 23. Juni 1948 für fällige Zahlungen bis 18 Uhr geöffnet; nur Steuerzahlungen dürfen nicht mehr angenommen werden.
Alle Geschäfte, Theater, Kinos usw. sind heute wie üblich geöffnet. Die Theater-, Kinokassen usw. verkaufen die Eintrittskarten heute, am 23. Juni 1948, zu den bisherigen Preisen, am 24. und 25. Juni 1948, gegen Neugeld bzw. zum zehnfachen Betrag des bisherigen Geldes.
Ab 23. Juni 1948, 15 Uhr, befindet sich in jedem Verwaltungsgebäude der 8 städtischen Verwaltungsbezirke eine Auskunftsstelle über die Währungsfragen für die Bevölkerung. Die Stadtverwaltung bittet in allen Zweifelsfragen diese Auskunftsstellen aufzusuchen. Diese sind am 23. Juni 1948 bis 21 Uhr, in den folgenden Tagen von 8 bis 21 Uhr geöffnet.
Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben kommen am 24. Juni 1948 neue Fahrscheine zur Ausgabe. Diese dürfen nur gegen Neugeld bzw. am 24. und 25. Juni 1948 zum zehnfachen Betrag des bisherigen Geldes verkauft werden. Gültig bleiben lediglich die Wochen-, Monatskarten und die grünen 16-Fahrtenkarten für Berufstätige bis zum 30. Juni 1948.“
In Abb. 2.4 werden vier mit Kupons beklebte Scheine gezeigt, diese selbst stammten aus den Jahren 1933 bis 19422. Die Basisscheine waren als Zahlungsmittel gültig bis zur Währungsreform. In den Westzonen waren sie nach der Währungsreform noch bis Ende August zu einem Zehntel des Nennwerts gültig, in der SBZ galten sie mit Kupon bis zum 28.7.1948, zum Nennwert.
Viele Menschen befürchteten damals, dass sich die aufgeklebten Kupons von den Geldscheinen lösen könnten, das Geld wäre dann wertlos gewesen. Und auch ein schief aufgeklebter Kupon wie auf dem abgebildeten 10-RM-Schein konnte Ärger bringen.3
Abb. 2.4: Beispiele für mit Kupons beklebte Scheine, sie waren vier Wochen gültig
Nach der vom 24. bis 28. Juni 1948 durchgeführten ersten Etappe der Währungsreform mit der Ausgabe der „Kuponmark“ war es vier Wochen später so weit. Die mit Kupon beklebten Scheine wurden in neue, auf 1948 datierte Geldscheine der „Deutschen Notenbank“ getauscht. Die neue Währungsbezeichnung lautete „Deutsche Mark der Deutschen Notenbank“ bzw. kurz „Deutsche Mark“. Bis 1964 gab es damit DM (West) und DM (Ost).
Gesetzliche Grundlagen für diese zweite Etappe waren die „Verordnung zur Regelung des Umtausches der im Umlauf befindlichen Reichsmark und Rentenmark mit aufgeklebten Spezialkupons in Deutsche Mark der Deutschen Notenbank“ vom 20.7.1948 und der Befehl des Obersten Chefs der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland Nr. 124 vom 24.7.1948.
Die genannte Verordnung sah zwei Varianten für die praktische Umsetzung des Geldumtausches vor. Zum einen natürlich der Umtausch in der Sparkasse oder der Bankfiliale. Hier überprüfte der Buchhalter das ausgefüllte Formular und übergab es dem Kassierer. Die das Geld abliefernde Person übergab das Geld dem Kassierer und erhielt von diesem das neue Geld.
Abb. 2.5: Erklärung zum Umtausch in neue Banknoten, S. 1 des Formulars - Angabe von Namen, Adresse und Betrag
Die zweite Variante war vorgesehen für die Arbeiter und Angestellten von Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten. Hier wurde der Geldumtausch im Betrieb durchgeführt. Der Beschäftigte gab sein Formular, den Stammabschnitt seiner Lebensmittelkarte und sein Geld im Betrieb ab. Der Betrieb rechnete anschließend mit dem Kreditinstitut ab und erhielt, nach Prüfung der Unterlagen, das Geld für seine Beschäftigten.
Abb. 2.5 zeigt die erste Seite des in dieser zweiten Etappe auszufüllenden Formulares. Einzutragen waren „Namen und Vornamen der haushaltsangehörigen Personen, denen die abgelieferten Geldscheine gehörten“.
Dazu kamen auf Seite 4 des Dokumentes (Abb. 2.6) die Nummern der abgelieferten Geldscheine von 5 bis 100 Renten- bzw. Reichsmark (RM) und, quasi als Personaldokument, die Stammabschnitte der Lebensmittelkarten für den aktuellen Monat Juli (Abb. 2.7), aufgeklebt auf S. 3. Das Problem: die abgetrennten, losen Abschnitte der Lebensmittelkarten waren laut Aufschrift ungültig.
Abb. 2.6: Erklärung zum Umtausch in neue Banknoten, S. → mit der Auflistung der abgelieferten Geldscheine
Man hatte die Abschnitte entweder vor dem Monatsende alle aufgebraucht, was sicher immer mal vorkam, oder man musste hier Ende Juli in diesem Jahr eine Ausnahme machen. Denn die Erklärung ist am Sonntag, dem 25. Juli, abgestempelt worden, mit den aufgeklebten Stammabschnitten der Lebensmittelmarken für Juli. Und die Marken sollten eigentlich noch eine ganze Woche reichen. Ein Blick auf die zu beanspruchenden Lebensmittelmengen - hier der Gesamtlebensmittelkarte II/4 - zeigt die folgenden Tagesrationen: Brot 300 g, Nährmittel, Zucker und Fleisch je 20 g, Fett 10 g und Marmelade 30 g. Dazu kam eine Monatsration von Kaffee-Ersatz von 125 g. Ortskategorie II betraf die Dörfer und die kleineren Städte der SBZ, Personengruppe 4 war zu dieser Zeit die am schlechtesten gestellte Gruppe. Das Thema Lebensmittelkarten wird in Abschnitt 8 noch einmal etwas ausführlicher aufgenommen.
Herr und Frau Sachse, Kuno und Agnes, aus Hohndorf im Landkreis Glauchau verfügten als Ehepaar über ein Barvermögen von 65 RM, bestehend aus einem 50-Mark-Schein und drei 5-Mark-Scheinen. 1- und 2-Mark-Scheine hatten sie offensichtlich nicht. Diese wären zwar in der Summe auf Seite 1 aufgetaucht, aber nicht in der Auflistung der Banknoten-Nummern auf Seite 4 des Formulars. Die alten im Umlauf befindlichen Scheine lauteten auf Rentenmark und Reichsmark, beide abgekürzt mit „RM“, vergl. dazu die erste ausgefüllte Zeile auf Seite 1 des Beleges.
Die Erfassung der Kontrollnummern der abgegebenen Scheine auf der letzten Seite des Beleges (Abb. 2.6) erlaubte es im Bedarfsfall - wenn bei einer nachfolgenden Prüfung eine Fälschung festgestellt wurde - den Einreicher des Scheines zu ermitteln. Wobei vermutlich eher die Marken als die Scheine gefälscht worden waren.4
Die auf Seite 2 des Formulars vorgesehene Möglichkeit, größere Summen einem Konto gutzuschreiben, wurde sicher nicht so sehr häufig gebraucht. In der ersten Etappe der Währungsreform wurde ja nur ein kleiner Anteil „bar“ gegen mit Kupon versehene Scheine getauscht, darüber hinaus gehende Beträge wurden einem Konto gutgeschrieben. Nur wenn sich in den seitdem vergangenen vier Wochen größere Mengen an Bargeld angesammelt hätten, wäre eine Gutschrift nötig geworden.
Eine Gesamtbilanz nennt die Ausgabe von 4,123 Milliarden „Kupon-Mark“, 11 Millionen davon (etwa ¼ %) wurden anschließend nicht in die neuen DM-Scheine getauscht.
Abb. 2.7: Lebensmittelkarten vom Juli 1948 (ohne Abschnitte) als Berechtigungnachweis, aufgeklebt auf S. 3 des Formulars
Die neuen Scheine? Ausgegeben wurden Scheine in neun Wertstufen: 50 Deutsche Pfennig sowie 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 und 1000 Deutsche Mark. Abb. 2.8 zeigt drei der neuen Scheine mit der Summe 65 DM, so wie sie das Ehepaar Sachse erhalten haben könnte. Ein großer Teil dieser neuen Geldscheine - die Wertstufen von 50 Pfennig bis 50 DM – war in der Sowjetunion gedruckt worden, die 100-und 1000-DM-Scheine dagegen kamen aus Leipzig. Die in der Sowjetunion gedruckten Scheine sind erkennbar an der 6-stelligen Kontrollnummer (50 Pfennig bis 20 DM) bzw. an dem einen Serienbuchstaben (50 DM). Abb. 2.8 zeigt also in der Sowjetunion gedruckte Scheine, so wie sie im Sommer 1948 ausgegeben wurden.Im Jahr 1951 wurde eine Nachauflage der gesamten Serie in der Wertpapierdruckerei der DDR in Leipzig5 hergestellt. Abb. 2.9 zeigt die sechs Wertstufen, die in Abb. 2.8 fehlen. Es sind alles Scheine der zweiten Auflage, also in Leipzig gedruckte Scheine. Bei den ausschließlich in Leipzig gedruckten Scheinen zu 100 M und 1000 M gibt es keinen Unterschied von Erst- und Nachdruck.
Die ausgebende Bank war laut Aufdruck auf den Scheinen die „Deutsche Notenbank“. Mit Befehl Nr. 122 der SMAD6 vom 20. Juli 1948 war die Deutsche Notenbank aus der Deutschen Emissionsund Girobank hervorgegangen. In der Anordnung vom gleichen Tag war das erste Mal die neue Währungsbezeichnung „Deutsche Mark“ genannt worden. Das war eine knappe Woche vor der Ausgabe der neuen Scheine!
Auch die Vorgängerinstitution, die Deutsche Emissions- und Girobank, war erst am 1. Juni 1948 gegründet worden, mit dem Befehl Nr. 94 der SMAD vom 21.5.1948.
Münzgeld? Die bis Anfang 1939 ausgegebenen Münzen zu 50 Reichspfennig und 1 Reichsmark waren bereits mit dem Kriegsbeginn 1939 eingezogen worden, sie bestanden aus kriegswichtigem Nickel. Die seit Kriegsbeginn von ihren Besitzern zurückgehaltenen Silbermünzen zu 2 und 5 Reichsmark wurden praktisch mit Befehl vom 9. August 1945 ungültig, der Befehl verfügte die Ablieferung dieser Münzen.7
Die alten Kleingeldmünzen zu 1, 5 und 10 Pfennig blieben bis zur Währungsreform und noch für einige Zeit darauf im Umlauf. Wobei ein Teil aus Neuprägungen der Jahre 1945 bis 1948 bestand, mit einem an die Vorgängerausgaben angelehnten Münzbild, aber mit einem Adler ohne Hakenkreuz. Die ersten neu gestalteten Münzen gab es erst mehr als 10 Monate nach der Währungsreform. Die neuen Münzen zu 5 und 10 Pfennig gab es in der SBZ ab 1. April 1949, zwei Tage später am 3. April wurden die alten Stücke ungültig. Die neuen 1-Pfennig-Münzen folgten ab 2. März 1950, einen Monat später, am 1.4.1950, wurden die alten Pfennige und damit die letzten aus Kriegs- und Vorkriegszeiten stammenden Münzen ungültig. Neue 50-Pfennig-Münzen gab es noch ein halbes Jahr später ab 1. September 1950. Die alten 50-Pfennig-Münzen waren dagegen nur bis zum 13. Oktober 1948 gültig - 50-Pfennig-Münzen hatte es also fast 2 Jahre lang nicht gegeben.8
Abb. 2.8: 65 DM in neuen Scheinen, Erstausgabe (Quelle: Matthias Tronjeck)
Die ersten neuen 1-, 5- und 10-Pfennig-Münzen waren auf 1948 datiert, weitere Ausgaben tragen die Jahreszahlen 1949 bzw. 1950. Abb. 2.10 zeigt die drei neuen Münzen. Auf der Vorderseite tragen sie die Wertangabe und die Aufschrift DEUTSCHLAND. Als die Entwürfe angefertigt wurden, schienen eine gesamtdeutsche Währungsreform und gesamtdeutsches Geld noch möglich zu sein. Aber auch nach der Spaltung des Landes gab es für eine gewisse Zeit noch Hoffnungen, wie berechtigt auch immer, auf eine gemeinsame Zukunft mit gemeinsamem Geld. Auf der Rückseite trugen die Münzen ein Symbol, bestehend aus einer Getreideähre vor einem Zahnrad. Wie sich später herausstellte, ging diese Gestaltung auf einen Entwurf von Franz Paul Krischker aus dem Jahr 1943 zurück. Er sollte Verwendung finden für in der besetzten Ukraine auszugebendes Geld, außerdem soll es als Entwurf für eine Medaille der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront gedient haben. Letztendlich war es aber zu keiner Umsetzung des Entwurfs gekommen, also nutzte Krischker seine Vorarbeiten für die Gestaltung der neuen Münzen für die SBZ.9 Schon wenige Wochen nach Beginn der Münzausgabe forderte jemand den Stopp der Ausgabe, vermutlich weil das Symbol nationalsozialistischen Symbolen ähnlich sah.10 Wann auch immer die Vorgeschichte des Entwurfs bemerkt wurde, das Problem konnte offensichtlich „unter der Decke“ gehalten werden, vor der Öffentlichkeit und vermutlich auch vor der Partei- und Staatsführung der DDR.11
Abb. 2.9: Die „übrigen“ Wertstufen, hier aus der in Leipzig gedruckten Auflage
In der Literatur, z.B. im Buch „Die Geldzeichen der DDR“ von Günter Graichen12 von 1977 heißt es, Zahnrad und Ähre wären das Symbol des auf der 11. Tagung des Parteivorstandes der SED im Juni 1948 beschlossenen Zweijahrplanes. War das seit langem existierende Symbol für die neuen Münzen ausgewählt worden und dann nachträglich zum Symbol des 2-Jahr-Planes erkoren worden? In den Zeitungsmeldungen anlässlich der Ausgabe der neuen Münzen (z. B. Berliner Zeitung vom 31.3.1949) gab es lediglich Informationen zu den Umtauschmodalitäten, aber weder eine Beschreibung noch eine Erklärung des Münzbildes.
Eine Neugestaltung der Münzrückseiten erfolgte für die 1-, 5- und 10-Pfennig-Münzen ab 1952, es gibt sie mit den Jahreszahlen 1952 und 1953. Größe, Material und Gestaltung der Vorderseite blieben unverändert. Das neue Symbol auf der Rückseite bestand aus einem Hammer, einem darauf gelegten Zirkel und zwei Getreideähren (Abb. 2.10). Es sollte die Zusammenarbeit von Arbeitern, Bauern und (werktätiger) Intelligenz symbolisieren.
Nach Graichen13 sollten die Münzen ab 24. März 1952 Zahlungsmittel sein. Der 24. März war aber offensichtlich nur das Datum der Anordnung zur Ausgabe der Münzen. In den Tageszeitungen wurden die neuen Münzen erst am 1. April vorgestellt, das dürfte dann also der Starttag für den Umlauf gewesen sein. Allerdings waren die neuen Münzen keiner der Tageszeitungen ein Foto wert.
Nach Graichen sollte die Darstellung auf der Rückseite das Symbol des auf dem III. Parteitag der SED beschlossenen Fünfjahrplanes 1951-55 sein. Ganz so ist es nicht, in den Zeitungsbeiträgen heißt es stattdessen auch „Dieses Bild trägt die Insignien aus dem Emblem des Fünfjahrplanes ... Hammer, zwei Ähren, Zirkel“14. Im Symbol des 5-Jahr-Planes sind es auf jeder Seite des Hammers zwei schmale Ähren statt einer breiten Ähre und außerdem liegt über allem eine große „5“ (vergl. die Abbildung in Abschnitt 12.4). Andererseits sind es die gleichen Elemente, aus denen dann das 1955 gesetzlich festgelegte Staatswappen der DDR entstand.
Abb. 2.10: Münzen der ersten und zweiten Kleingeldserie (Durchmesser 17, 19 bzw. 21 mm)
Abb. 2.11 zeigt die ab 1. September 1950 in den Umlauf gegebenen 50-Pfennig-Münzen, sie bestanden aus einer Kupfer-Aluminium-Legierung. Gültig waren sie bis zum 30. November 1958.
Abb. 2.11: 50-Pfennig-Münze (Durchmesser 20 mm)
Einige wenige der 50-Pfennig-Münzen gibt es auch mit der Jahreszahl 1949, für sie werden heute mehr als 10.000 Euro bezahlt.
2.2 Oktober 1957
Der 13. Oktober - ein Sonntag, war ein aufregender Tag, wenn auch für die übergroße Mehrzahl der DDR-Bürger ohne schwerwiegende Auswirkungen.
Abb. 2.12: Berliner Zeitung vom 14. Oktober, dem Tag danach
Früh am Morgen war über alle Radiosender eine Rede des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl ausgestrahlt worden, in der er bekannt gab, dass an diesem Tag die bisher gültigen Geldscheine der Ausgabe 1948 umgetauscht werden (vergl. Abb. 2.12 und 2.13).





























