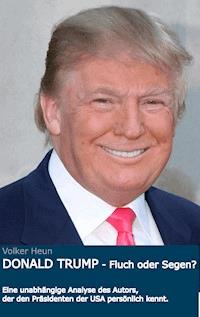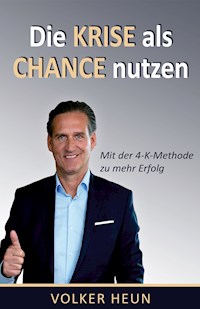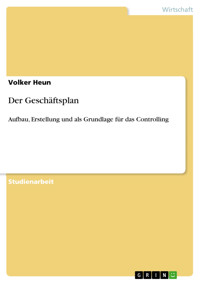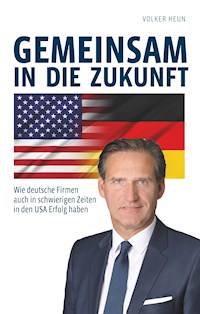
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für viele Menschen in unserem Land stehen die Beziehungen zu den USA aktuell auf dem Prüfstand. Wie kann sich das Verhältnis beider Staaten zukünftig gestalten. Welche Chancen und Risiken gibt es und welche Rolle spielt US-Präsident Trump dabei? Durch eine objektive Betrachtung aller relevanten Aspekte werden dem Leser Antworten auf diese Fragen gegeben und eine Perspektive vermittelt, die es ihm ermöglicht, sich seine eigene Meinung zu bilden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Die aktuelle Situation zwischen Washington und Berlin
Die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die deutsch-amerikanische Wirtschaftslage unter Donald Trump
Folgen der Strafzölle
US-Steuerreform: Vorteil für deutsche Unternehmen in USA
Donald Trump verstehen
Zusammenarbeit von US-Präsidenten mit deutschen Kanzlern und Kanzlerin
Brücken statt Mauern – Die Atlantik-Brücke
Wahlspenden USA – Deutschland
Welche Chancen die USA für deutsche Firmen bieten
Firmengründung in USA
Delaware – der Liebling vieler Firmen
Business-Knigge USA
Fazit
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen in diesem Buch ersetzen keine Rechtsberatung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können sie aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung nicht mehr so aktuell sein, wie zum Zeitpunkt, zu dem dieses Buch geschrieben wurde.
VORWORT
Für viele Menschen in unserem Land stehen die Beziehungen zu den USA aktuell auf dem Prüfstand. Laut einer Untersuchung sehen Deutsche und Amerikaner gemeinsame Werte schwinden. In einer Erhebung für die Organisationen Atlantik-Brücke und American Council on Germany sah jeder Zweite diese Basis erodieren. Gleichzeitig wünschen sich der Umfrage des Instituts YouGov zufolge 67 Prozent der Deutschen und 69 Prozent der Amerikaner, dass die gegenseitigen Beziehungen bleiben, wie sie sind, oder sogar noch enger werden.1
Eine andere Studie, die von der Körber-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, zeigt dass die Amerikaner mehrheitlich enger mit Deutschland zusammenarbeiten wollen, jedoch wünschen dies nur noch 47 Prozent der Deutschen. Für die klare Mehrheit der befragten Bundesbürger sind die Beziehungen zu Frankreich am wichtigsten, danach kommen die Vereinigten Staaten an zweiter Stelle, allerdings mit einem Rückgang von 43 auf 35 Prozent gegenüber 2017.2
Wie kommt es zu diesen widersprüchlichen Wahrnehmungen und Wünschen?
Viele machen die atmosphärischen Störungen am Wirken des amerikanischen Präsidenten Donald Trump fest. Doch ist es wirklich so einfach? Ist wirklich alles schlecht, was aktuell im Weißen Haus beschlossen wird? Gab es nicht auch schon früher unterschiedliche Auffassungen bei den großen Fragen an die Weltpolitik, wie beim Irak-Krieg? Und gab es nicht auch positive Zeiten, in denen beide Nationen Seite an Seite standen, um durch ein stabiles und zuverlässiges Miteinander westliche Werte wie Freiheit und Demokratie zu stärken? Vor allem hat Deutschland den USA auch zu verdanken, dass es sich nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt in Sicherheit eigenständig entwickeln konnte, zum Beispiel durch die Rosinen-Bomber während der Berlin-Blockade. Dinge, die jüngere Generationen kaum noch wissen oder interessieren, dennoch sind sie, was sie sind: Fakten, ohne die es unser Deutschland nicht geben würde.
Woher rühren die belasteten Beziehungen der Gegenwart, und wie lassen Sie sich beseitigen? Wie kann sich das Verhältnis beider Staaten zukünftig gestalten – welche Chancen und Risiken gibt es dabei? Welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation auf die Wirtschaft beider Staaten bzw. welche Möglichkeiten gibt es, diese dennoch konstruktiv zum Nutzen beider Länder voranzubringen?
Diese Fragen und Gedanken bewegen mich seit einiger Zeit – gerade deshalb, weil ich einige Jahre in den USA gelebt und gearbeitet habe, und auch heute noch regelmäßig in dieses interessante und spannende Land fliege. Als ein Befürworter der US-amerikanischen Werte, die vor über 200 Jahren in der Verfassung festgeschrieben wurden, und als Anhänger des American Way of Life, aber auch unserer deutschen Demokratie und ihrem Grundgesetz,liegt mir dieses Buch besonders am Herzen.
Dass die USA auch in politisch nicht ganz einfachen Zeiten immer noch ein Land sind, dass für deutsche Investoren und Firmengründer wirtschaftlich interessant und spannend ist, und dass es sich immer noch lohnen kann, in dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein Unternehmen zu gründen, wird in diesem Buch ausführlich – auch an Beispielen – beschrieben. Yes you can, lautet dabei das Motto.
Dabei ist es wichtig, nicht nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen – egal von welcher Seite des Atlantiks man das Geschehen betrachtet. Vielmehr geht es in dem
Buch hierum eine klare Analyse von Vergangenheit und Gegenwart, um Lösungen für die Zukunft anzubieten. In der Tat sind es schwierige Zeiten, in denen wir uns befinden, in denen die Bereitschaft zu einem Dialog aber trotz aller Meinungsunterschiede von besonderer Bedeutung ist. Gerade heutzutage müssen die USA und Deutschland als größtes und mächtigstes Land Europas im Gespräch bleiben, um Brücken anstatt Mauern zu bauen. Das Motto kann nur lauten „Gemeinsam in die Zukunft“ – eine andere Alternative gibt es nicht.
Volker Heun, Düsseldorf im Februar 2019
1. DIE AKTUELLE SITUATION ZWISCHEN WASHINGTON UND BERLIN
Wer dieser Tage nur auf die Schlagzeilen schaut, der könnte meinen: Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist beendet, dafür entsteht gerade eine neue Freundschaft im Fernen Osten. Gemeinsam sprechen sich Kanzlerin Merkel und der chinesische Regierungschef Li Keqiang gegen Abschottung und für Freihandel aus. Gemeinsam bekennen sich Merkel und Li zum Iran-Abkommen. Gemeinsam appellieren sie an die USA und Nordkorea, ihre Verhandlungen fortzusetzen.
Mit den USA unter Präsident Trump, so scheint es manchmal, gibt es hingegen gar keine Gemeinsamkeiten mehr. Und diesem Eindruck gibt der Mann im Weißen Haus reichlich Nahrung. Sicher ist es klug, mit den Machthabern in Russland und China eine vernünftige Arbeitsebene zu entwickeln, das Verhältnis ständig zu verbessern, soweit dies möglich ist. Aber eine Wertegemeinschaft, wie sie den Westen begründet, werden wir im Osten auf lange Sicht nicht finden. Zugegeben: Trumps Habitus und seine Rhetorik sind aggressiv und erratisch. Doch Amerika ist und bleibt das Land der Freiheit. In Washington liegen keine Journalisten tot in den Straßen, weil sie es gewagt haben die Politik eines eitlen Präsidenten zu kritisieren.
In den Gefängnissen der Vereinigten Staaten sitzen nicht Hunderte von Dissidenten, die einer Parteilinie widersprochen haben, in Los Angeles werden keine schwulen Männer öffentlich ausgepeitscht oder aufgehängt. Der föderale, demokratische Rechtsstaat USA mit seinem weltweit einzigartigen Verständnis für Meinungsfreiheit – der in der Verfassung verankerten „Freedom of Speech“ – ist und bleibt trotz all seiner Schwächen, trotz all seiner sozialen Verwerfungen und Ungerechtigkeiten ein Orientierungspunkt. Oder, um es mit Winston Churchill zu sagen: „Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.“
Mehr noch: Amerika bleibt Freundesland, auch unter Trump, der in spätestens sechs Jahren aus der 1600 Pennsylvania Avenue wieder ausziehen wird. Die in Jahrzehnten gewachsenen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschen und Amerikanern haben so viele Ebenen, so viele persönliche Berührungspunkte, sie werden diesen Präsidenten überstehen. Soll Trump ruhig weiter von „America first“ reden, Deutschland tut gut daran, weiter nach der Devise „Friendship first“ zu verfahren.
So betonte Bundesaußenminister Heiko Maas, der nicht unbedingt im Verdacht steht, ein Trump-Fan zu sein, vor einer Reise nach Washington die Bedeutung enger Beziehungen Deutschlands zu den USA auch in Zeiten von US-Präsident Donald Trump.
„Auch wenn wir momentan politisch nicht bei allen Themen einer Meinung sind, ist für mich klar: Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist nicht verhandelbar“, sagte er. „Für uns Europäer bleiben die USA der wichtigste Verbündete.“
Auch umgekehrt scheint nicht alles so schlimm zu sein, wie so mancher befürchten mag: das Deutschlandbild in den USA ist laut jüngster Umfragen sehr gut. Jeder sechste Amerikaner gibt an, deutsche Vorfahren zu haben. In Schulen und Hochschulen liegt Deutsch als Fremdsprache auf dem dritten Platz. Mit 4.800 Unternehmen ist die deutsche Wirtschaft der viertgrößte Arbeitsgeber in den USA. Zahlreiche Austauschprogramme, Initiativen, Patenschaften und Netzwerke ermöglichen es jungen Menschen und Experten, die jeweils andere Kultur kennenzulernen. Damit dieses wertvolle Fundament nicht gefährdet wird, kommt es darauf an, in Zukunft noch stärker in Austausch und Dialog zu investieren.
Quellen: US Census Bureau, US Department of Commerce
2. DEUTSCHLAND HAT DEN USA VIEL ZU VERDANKEN
Dass Deutschland den USA viel zu verdanken hat, sehen viele Menschen bei uns anders. Zu lange ist die Nachkriegszeit her, viele waren noch nicht geboren. Zudem haben die USA in den Augen vieler Deutscher nicht gerade dazu beigetragen, ein positives Image zu verdienen: Vietnam-Krieg, Rassenunruhen, Irak-Krieg, Turbo-Kapitalismus und „Heuschrecken“ sowie ein lasches Waffengesetz, das jährlich 40.000 Tote in den USA fordert.
Dennoch hat jede Medaille zwei Seiten. Und so sorgten die „typischen“ amerikanischen Eigenschaften, wie z. B. Furchtlosigkeit und Entschlusskraft in der Nachkriegszeit für die Umsetzung des Marshall-Plans, der für Deutschland existenziell wichtig war. Zudem war es nicht selbstverständlich, dass dieser überhaupt durchgeführt werden konnte, denn die Sowjetunion war dabei, dem ganzen Unterfangen mit der Berlin-Blockade einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Nach gescheiterten Verhandlungen auf der Potsdamer Konferenz kam die Kooperation zwischen den Siegermächten zum Erliegen. Weil Berlin als zentrale Stadt in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden war, wurde die einstige Hauptstadt nun zum Brennpunkt des Ost-West-Konflikts. Da Berlin geographisch mitten in der sowjetischen Besatzungszone lag, wollte die Sowjetunion nun den Anspruch über ganz Berlin erheben. Doch die Geschichte ist nicht in zwei Sätzen erzählt, umso mehr lohnt sich ein genauer Blick, um die Wichtigkeit der USA für Deutschland – und umgekehrt – zu erkennen.
2. DIE VERGANGENHEIT KENNEN, UM DIE GEGENWART ZU VERSTEHEN
Wie heißt es so schön? Um die Gegenwart zu verstehen, muss man die Vergangenheit kennen. Dabei beginnt für viele Deutsche die Partnerschaft mit den USA erst mit Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Doch gab es auch schon vorher eine enge Verbindung zwischen beiden Nationen.
Im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Vereinigten Staaten, das „Land der Freiheit“, zum weitaus beliebtesten Ziel deutscher Einwanderer. Im Gegensatz zu Deutschland, das bei eher geringen Ressourcen einen Überschuss an Arbeitskräften hatte, mangelte es in den rasch emporstrebenden USA an arbeitsfähigen Menschen. Darüber hinaus übte die Neue Welt eine starke Anziehungskraft vor allem auf junge Menschen aus. Ihr Wissensstand war oft spärlich, umso phantasievoller stellten sich viele eine „goldene Zukunft“ in den Vereinigten Staaten vor. Zwischen 1820 und 1930 ließen sich dort rund 90 Prozent der rund sechs Millionen deutschen Immigranten nieder. Sie gehörten dort zu den größten Einwanderergruppen.
Vor allem aber in Zeiten Nazi-Deutschlands wurden die USA eine neue Heimat für Deutsche, unter ihnen auch bekannte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur.
Während des NS-Regimes verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Deutschen Reich zusehends. Im Oktober 1934 kündigte Deutschland den deutsch-amerikanischen Handelsvertrag. Viele Menschen aus Deutschland, unter ihnen zahlreiche Künstler, Wissenschaftler und Juden, wie beispielsweise Albert Einstein, Thomas Mann, Kurt Weill oder Marlene Dietrich, flohen oder emigrierten vor dem Hitler-Regime in die USA. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren es 130.000 deutsche und österreichische Flüchtlinge. Sie trugen dazu bei, die Zustände im Deutschen Reich publik zu machen.
Ein wichtiger Schritt, die Schreckensherrschaft der Nazis zu beenden, war der sogenannte D-Day, der Tag, an dem 1944 amerikanische, britische und kanadische Truppen in der Normandie landeten. Die Invasion verkürzte nicht nur den Zweiten Weltkrieg. Sie verhinderte auch, dass die Rote Armee Westeuropa eroberte. Auch hierbei waren die Amerikaner federführend – von über 150.000 beteiligten Soldaten kamen ca. 70.000 aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Doch nach der Beendigung des Nazi-Terrors gab es auch in den USA unterschiedliche Ausrichtungen, wie man mit dem Nachkriegs-Deutschland umgehen sollte. Besonders die Herren Marshall und Morgenthau hatten andere Intentionen.
MARSHALL VS. MORGENTHAU
Erst eineinhalb Jahre nach Kriegsende zeigte sich das Ausmaß der wirtschaftlichen Not in Deutschland im vollen Umfang. Der strenge Winter wurde zur Katastrophe. Ernährung, Energieversorgung und Verkehr brachen zusammen, nur das Eingreifen der USA und Großbritanniens verhinderte Schlimmeres.
Wie sollte es weitergehen in Deutschland und Europa? Am 5. Juni 1947 präsentierte der damalige US-Außenminister, George C. Marshall, in einer Rede vor Studenten seine Vorstellungen vom Wiederaufbau. Als Vorbedingung für amerikanische Hilfsmittel verlangte er eine gemeinsame Initiative der europäischen Staaten. Im Herbst 1948 kamen dann die ersten Waren des „European Recovery Programs“ in Europa an. Insgesamt lieferten die USA bis 1952 Waren im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar nach Europa.
Wie profitierten Deutschland und Europa wirtschaftlich vom Marshallplan? Welche politischen und psychologischen Folgen hatte das Programm, wie wurde es von Politik und Medien vermittelt? Das Dossier informiert in vier Kapiteln über Entstehung, Entwicklung und Wirkungsgeschichte des Marshallplans.
Nur ein vereinigtes, ökonomisch gesundes Europa sei immun gegen jede Art von Totalitarismus – so die Überlegung der Amerikaner. Aber auch wirtschaftspolitische Absichten spielten eine Rolle bei der Entwicklung des Marshallplans. Der deutsche Wiederaufbau lag zunehmend auch im Interesse der USA und der Staaten Nachkriegseuropas.
Sowohl für den (west-)europäischen als auch für den amerikanischen Markt war Deutschland als zentrale Wirtschaftsmacht unverzichtbarer Abnehmer von Rohstoffen und Lieferant von Fertigprodukten. Hinzu kam für die USA die Schlüsselrolle Deutschlands im beginnenden „Kalten Krieg“. An den Grenzen zwischen den 1947 zur „Bizone“ vereinigten amerikanischen und britischen Besatzungszonen zur sowjetischen Besatzungszone stießen die beiden Machtblöcke und ihre unterschiedlichen Interessen aufeinander. Ein wirtschaftlich und politisch instabiles (West-)Deutschland konnte unabsehbare Folgen haben – nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Westeuropa.
US-Präsident Truman hatte am 12. März 1947 seine Unterstützung für alle „freien Völker“ gegen totalitäre Regierungsformen erklärt. Anlass war die geplante Unterstützung der konservativen griechischen Regierung im Bürgerkrieg, zu der sich Großbritannien nicht mehr in der Lage sah. Die amerikanische Erklärung wurde allgemein als Eintreten gegen eine weitere Ausbreitung des Kommunismus und der „Volksdemokratien“ verstanden. Der Marshallplan wurde so zu einem Schlüsselelement der amerikanischen Politik zur Eindämmung („Containment“) des Kommunismus in (West-)Europa. Ein vereinigtes, ökonomisch gesundes Europa, das ähnliche Werte wie die USA vertrete, sei gegen linke wie rechte Populisten gleichermaßen immun. In dem Maße, wie der Kommunismus den USA als Hauptgegner erschien, wurde dieses Argument zur Durchsetzung des Marshallplans in den USA immer gewichtiger. Daneben blieben auch seine wirtschaftspolitischen Überlegungen wirksam.
Ganz anderes dagegen hatte der Morgenthau-Plan mit Nachkriegs- Deutschland vor. Bereits im August 1944 veranlasste der amerikanische Finanzminister Henry Morgenthau jr. (1891–1967) die Ausarbeitung eines Memorandums zur Behandlung Deutschlands nach dessen Niederlage. Morgenthau stand unter dem Eindruck, sowohl die in den USA für die Deutschlandpolitik zuständigen Stellen als auch die maßgeblichen britischen Politiker verfolgten eine zu wenig eindeutige Linie bei der geplanten Behandlung Deutschlands in wirtschaftlicher Hinsicht nach dem Kriege. In der Denkschrift, die Morgenthau Anfang September 1944 vorlegte, wurde die Zerstückelung Deutschlands propagiert. Nach umfangreichen Gebietsabtretungen sollten zwei deutsche Staaten übrigbleiben, die Wirtschaftsregionen an Rhein und Ruhr sowie die Nordseeküste internationalisiert werden.
Im Zuge der völligen Entwaffnung und Abrüstung Deutschlands und großer Reparationsleistungen (auch durch Zwangsarbeit) sollten nach dem Morgenthau-Plan Industriebetriebe demontiert, die Bergwerke stillgelegt und zerstört werden. Bei Kontrolle der ganzen Wirtschaft auf 20 Jahre würde Deutschland ein Agrarstaat sein, der keine Möglichkeit zu aggressiver Politik mehr haben würde.
Der Plan enthielt, in der jeweils radikalsten Form, alle Vorschläge und Maßnahmen, die in der Kriegszieldebatte der Alliierten bis dahin schon einmal aufgetaucht waren. Morgenthaus Vorschläge sollten eine Diskussionsgrundlage bilden und die gemäßigten Deutschlandpläne des alliierten Oberkommandos unter Dwight David Eisenhower, der interalliierten European Advisory Commission und der jeweiligen Fachressorts in Washington und London korrigieren.
Morgenthau, mit dem US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt befreundet und seit 1934 Finanzminister, schien Erfolg zu haben, als bei der britisch-amerikanischen Konferenz in Quebec am 15. September 1944 der britische Premierminister Winston Churchill und Präsident Roosevelt eine (schon abgemilderte) Version des Morgenthau-Plans billigend zur Kenntnis nahmen. Cordell Hull, der amerikanische Außenminister, protestierte ebenso wie sein britischer Kollege Anthony Eden aber bereits am folgenden Tag gegen den Plan, und der amerikanische Kriegsminister Henry Lewis Stimson nannte das Programm „ein Verbrechen gegen die Zivilisation“. Als der „Morgenthau-Plan“ durch eine gezielte Indiskretion am 21. September 1944 in die Öffentlichkeit kam, war die Reaktion so negativ, dass auch Präsident Roosevelt sich distanzierte. Der Morgenthau-Plan verschwand bereits Ende September 1944 in der Versenkung, ohne von den zuständigen Gremien jemals formell diskutiert worden zu sein. Für die spätere Besatzungs- und Deutschlandpolitik blieb der Morgenthau-Plan ohne jede Bedeutung. Soweit die Pläne, aber wie sah es konkret aus im Nachkriegsdeutschland?
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Reichsmark ihre Bedeutung als offizielles Tauschmittel so gut wie verloren. Die hohen Kriegskosten und die inflationäre Geldpolitik durch die Notenpresse waren es demnach, die die deutsche Währung in den Ruin getrieben haben. Daher beschlossen viele Menschen, eher auf dem Schwarzmarkt zu handeln, anstatt mit Geld. Die USA verfolgten diesen Prozess mit großer Aufmerksamkeit und erkannten zurecht, dass der Geldwertverfall den Aufbau der deutschen Wirtschaft in erheblicher Weise lähmen würde. Die Besatzungsmächte führten schließlich am 20. Juni 1948 in der Trizone die Deutsche Mark als neue Währung ein. Mit dem Marshallplan banden die USA Westdeutschland zudem enger an sich. Die Sowjetunion reagierte auf dieses Vorgehen, indem sie in ihrem Besatzungssektor die Ostmark einführte und die deutsche Spaltung somit nochmals verschärfte. Zudem isolierte sie West-Berlin und unterbrach die Transitwege nach West-Deutschland. Die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich waren gefordert, und einigten sich darauf, die Menschen in West-Berlin über eine „Luftbrücke“ mit Gütern und Lebensmitteln zu versorgen. Dies bedeutete, dass die Westmächte mit eigenen Flugzeugen, den Rosinenbombern, nach Berlin flog, um die Blockade der Sowjetunion zu überwinden. Vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 wurden die Westberliner also ausschließlich von der Luft aus mit Nahrung beliefert. Am Ende gaben die Sowjets schließlich nach, da die westlichen Besatzungsmächte und die Westberliner eifrig durchhielten. Somit war der Versuch gescheitert, die ganze Stadt unter alleinige Herrschaft zu stellen. Folglich wuchsen die Spannungen zwischen Ost und West und machten eine Einigung unmöglich. 1949 kam es neben der deutschen Teilung auch zur Teilung Berlins in eine Ost- und eine West-Hälfte. Die folgenden Jahre waren geprägt von andauernden Verletzungen der Transitwege zwischen BRD und West-Berlin. Die sowjetische Regierung forderte mehrmals den Abzug westlicher Truppen aus ganz Berlin.
Im Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Bonn wurde zur provisorischen Hauptstadt erklärt, und aus den alliierten Militärgouverneuren wurden Hochkommissare. Die neue deutsche Regierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer erklärte sich bereit, einen militärischen Beitrag zur westlichen Verteidigung zu leisten. Aber auch nach der Aufnahme in das nordatlantische Bündnis (NATO) im Jahr 1955 blieb die Souveränität der Bundesrepublik durch alliierte Vorbehaltsrechte eingeschränkt. Aus den Hochkommissaren wurden jetzt Botschafter. Die Westalliierten behielten sich jedoch die Zuständigkeit für Deutschland als Ganzes und für Berlin vor.
Die Politik der USA im Nachkriegsdeutschland konzentrierte sich auf zwei getrennte Themenblöcke – erstens die Sicherstellung persönlicher Freiheiten und verfassungsmäßiger Vorgaben als Basis einer demokratischen Grundordnung. Zweitens auf die Eindämmung einer unabhängigen westdeutschen Außenpolitik durch internationale Organisationen und Bündnisse. Der Aufbau, die Wiederaufrüstung und die wirtschaftliche Stabilisierung der Bundesrepublik erfolgten über internationale Organisationen wie die NATO, die Westeuropäische Union, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. In den fünfziger Jahren wurden große Kontingente amerikanischer Truppen in Europa stationiert. Transatlantische Institutionen – sowohl militärischer wie auch politischer und wirtschaftlicher Art – bezogen die Bundesrepublik in die westliche Staatengemeinschaft mit ein und legten den Grundstein für eine konzertierte Eindämmungspolitik gegenüber dem Osten.
Die Politik der Eindämmung und der militärischen Abschreckung in der Nachkriegszeit wurde in den folgenden Jahrzehnten mehrfach in Frage gestellt. Es gab grundlegende Unterschiede zwischen den deutschen und den amerikanischen Vorstellungen in militärisch-strategischen, politischen, wirtschaftlichen und finanzpolitischen Bereichen, die manchmal zu Meinungsverschiedenheiten und Befürchtungen führten. Zu ernsthaften Konflikten kam es jedoch nie.