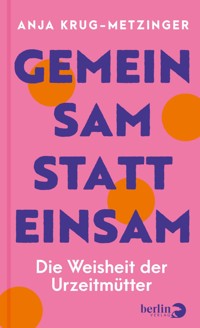
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist das Geheimnis gelungener Erziehung? Es ist ein kräftezehrender Balanceakt, den moderne Mütter täglich vollbringen müssen. Dieses Buch fragt deshalb nach der Urgeschichte der Mutterschaft. Anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gesprächen mit Primatologinnen, Anthropologen und Bindungsforscherinnen beleuchtet es die Evolutionsgeschichte des Mutterseins. Wie sich zeigt, haben Menschen ihre Kinder von jeher kooperativ aufgezogen, und das wohl schon seit zwei Millionen Jahren. Ein engagiertes Plädoyer, das Wissen der Vergangenheit zu nutzen und Kindererziehung wieder auf gemeinschaftliche Weise zu gestalten. Ermutigung für Erziehende, aus den Lehren der Vergangenheit zu profitieren Eine erkenntnisreiche Reise durch die Geschichte der Mutterschaft – von prähistorischer Zeit bis heute. Das Buch zeigt anschaulich, wie tief kooperative Kindererziehung in uns verankert ist und warum Alleinerziehung nicht zum Erfolgsgeheimnis der Menschheit gehört. Konkrete Anregungen inspirieren dazu, die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen, um die Herausforderungen der Mutterschaft gemeinsam auf soziale Weise zu meistern. Ein Muss für alle, die Elternschaft besser verstehen und neu denken wollen. Enthält Gespräche mit führenden Forschenden unterschiedlicher Disziplinen »Mütter sind besonders gut, wenn sie auf ein funktionierendes Unterstützungsnetz zurückgreifen können.« Lieselotte Ahnert, Bindungsforscherin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort
1. Die einsame Mutter – ein modernes Dilemma
Die Stadt schläft nie
Die digitale Dämmerung
Das kollektive Schweigen
Die neue Armutsfalle
Unsere evolutionären Wurzeln
Wege aus der Isolation
Architektur der Einsamkeit
Zeitarchitektur
Das väterliche Paradox
Die Silver Revolution
Verlorene Netzwerke
2. Am Morgen der Erkenntnis
Die Akrobaten der Nächstenliebe
Der Temperatur-Code der Gefühle
Menschenaffe im Kopf, Krallenäffchen im Herzen
Auf den Spuren kollektiver Kindererziehung
Das Experiment der zwei Dörfer
Die Knochenleserinnen von Wien
Die Wiege der Fürsorge
Die Mägde der Macht
Die Evolution der Fürsorge
Die Spiegel der Natur
Die Macht der Großmütter
Das Vermächtnis der Ammen
Babyfläschchen der Urgeschichte
Die Vermessung der Mutterliebe
Die Schatten der Vorzeit
Die Last der Entscheidung
Die dunkle Seite der Fürsorge
Die Zukunft der Kindheit
Die Weisheit der Urzeitmütter
3. Neue Wege der Familienunterstützung
Von Hilfeempfängern zu Gestaltern: Die neue Kraft der Selbstorganisation
Von der Initiative zur Struktur
Ausblick: Die Evolution der Fürsorge
Literatur und Medien
Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung
Evolutionsbiologie und Kooperative Aufzucht
Bioarchäologie und Anthropologie
Materielle Kultur und Archäologie
Audiovisuelle Medien
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Thomas
Vorwort
Die Einsamkeit moderner Mütter erscheint wie ein Widerspruch in sich: In einer Zeit, in der wir ständig vernetzt sind, leben viele Mütter isolierter denn je. Fast jeder Moment wird geteilt, gelikt und kommentiert, und doch begegnete ich bei meinen Recherchen immer wieder der tiefen Einsamkeit. Eine Frau vertraute mir an: »400 Instagram-Follower, 200 Facebook-Freunde, drei WhatsApp-Gruppen nur für Mütter – und trotzdem hatte ich letzte Woche hohes Fieber und niemanden, den ich um eine Packung Paracetamol bitten konnte.«
Diese Worte ließen mich nicht mehr los. Als Journalistin erlebte ich mit, wie Freundinnen mit den Herausforderungen der modernen Mutterschaft kämpften. Warum entschieden sich immer mehr Frauen bewusst gegen Kinder? Warum kämpften so viele Mütter täglich mit der Einsamkeit? Die niedrigen Geburtenraten sprechen eine deutliche Sprache: Etwas stimmt nicht mit der Art, wie unsere Gesellschaft Mutterschaft organisiert.
Je mehr ich recherchierte, desto deutlicher wurde: Was wir heute als »normal« empfinden – die isolierte Kleinfamilie, die überlastete Mutter, der zeitlich begrenzt verfügbare Vater –, ist ein historischer Sonderfall. Unsere Vorfahren lebten anders. Sie praktizierten, was die moderne Wissenschaft nun bestätigt: Menschen sind von Natur aus cooperative breeders – eine Spezies, die ihre Kinder gemeinsam großzieht.
Diese Erkenntnis führte mich zu faszinierenden Forscherinnen und Forschern. In Zürich beobachtete ich mit der Anthropologin Judith Burkart eine besondere Affenspezies – eine der ganz wenigen Primatenarten neben dem Menschen, die ihre Jungen gemeinsam aufzieht. Im Naturhistorischen Museum Wien zeigte mir die Archäologin Katharina Rebay-Salisbury rätselhafte Gräber aus der Bronzezeit. Wer wurde hier mit wem bestattet? Was verraten uns diese Grabbeigaben über die Beziehungen zwischen Müttern und Kindern vor Tausenden Jahren?
In der abgeschiedenen ostfriesischen Krummhörn entschlüsselte der Biophilosoph und Soziologe Eckart Voland ein uraltes Geheimnis: Warum brachte die Anwesenheit mancher Großmütter Segen, die anderer aber Unheil und Tod? Die Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert öffnete mir ihre Archive. Auf ihrem Bildschirm flimmerten alte Krippenaufnahmen aus der DDR – ein unerwartetes Fenster in unsere evolutionäre Vergangenheit.
Mit jeder neuen Erkenntnis wurde klarer: Die Überforderung moderner Mütter ist kein individuelles Versagen. Sie ist Symptom einer Gesellschaft, die sich von ihren evolutionären Wurzeln entfernt hat. Doch es gibt Hoffnung. Überall entstehen neue Formen der Gemeinschaft – von Mehrgenerationenhäusern bis zu digitalen Nachbarschaftsnetzwerken. Sie sind Vorboten einer kulturellen Evolution, die das Bewährte aus unserer Vergangenheit in die Zukunft trägt.
Dieses Buch führt von den Ursprüngen menschlicher Fürsorge zu den Herausforderungen der Gegenwart. Es zeigt die Möglichkeit einer Zukunft auf, in der keine Mutter mehr allein sein muss, einer Zukunft, die der menschlichen Natur entspricht: gemeinsam statt einsam.
1. Die einsame Mutter – ein modernes Dilemma
Es begann mit einem spätabendlichen Gespräch unter Freundinnen. Draußen peitschte der Oktoberregen gegen die Fenster, während drinnen der Rotwein in unseren Gläsern schimmerte. Meine Freundin Ruth drehte ihr Glas langsam zwischen den Fingern, beobachtete, wie sich das Licht in der dunkelroten Flüssigkeit brach. »Ich wollte keine Kinder«, sagte sie schließlich in die gedankenvolle Stille hinein. »Nicht, weil ich Kinder nicht mag, sondern weil ich gesehen habe, wie es läuft. Meine Mutter, meine Tanten, alle Frauen in meiner Familie – am Ende standen sie immer allein da. Die Männer kamen und gingen, aber die Verantwortung blieb am Ende immer bei den Müttern.«
Ruths Worte trafen einen Nerv bei mir. Auch ich hatte mich gegen Kinder entschieden – aus Gründen, die ich selbst noch nicht vollständig verstanden hatte. War es wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder hatte ich nur zu lange gezögert, während das Leben seine eigenen Weichen stellte? Als Journalistin interessierte mich besonders die Frage, ob sich in Ruths und meinen so unterschiedlichen Wegen dieselben gesellschaftlichen Muster spiegelten.
Die folgenden Beobachtungen und Erkenntnisse basieren auf einer mehrmonatigen Recherche. Für diese Untersuchung führte ich Gespräche mit Müttern aus verschiedenen sozialen Schichten, Altersgruppen und Familienkonstellationen – sowohl in Großstädten als auch ländlichen Regionen. Ergänzend wertete ich Einträge in Mütter-Foren und sozialen Medien aus und führte Gespräche mit medizinischen und psychologischen Fachkräften. Die Namen wurden auf Wunsch der Befragten geändert. Die hier präsentierten Erkenntnisse erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern spiegeln die subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen der beteiligten Personen sowie meine eigenen wider.
Der eigentliche Anstoß zu dieser Recherche kam aus einer unerwarteten, ganz anderen Richtung. Ein Instagram-Post erregte meine Aufmerksamkeit: Eine makellos gestylte Mutter präsentierte ihr durchorganisiertes Leben – Designer-Babyzimmer in sanften Pastelltönen, selbst gebackene Biomuffins, kunstvoll auf Vintage-Porzellan drapiert, eine scheinbar fehlerfreie Work-Life-Balance, dokumentiert in perfekt kadrierten Bildern. Das Licht immer golden, die Stimmung stets harmonisch, jedes Detail sorgfältig kuratiert.
Was mich stutzig machte, war nicht die offensichtliche Inszenierung. Als Frau, die ihre Entscheidung gegen Kinder in den vordigitalen 1990er-Jahren getroffen hatte, beobachtete ich diese neue Realität mit einer Mischung aus journalistischer Neugier und nachdenklicher Distanz. Der Kontrast zwischen der damaligen und der heutigen Zeit könnte kaum größer sein – und doch scheinen die grundlegenden Fragen dieselben geblieben zu sein. Es war besonders die Kommentarspalte darunter, die meine Aufmerksamkeit fesselte. Zwischen den begeisterten Emojis und bewundernden Ausrufen fand ich immer wieder die gleiche Frage – in verschiedenen Variationen, aber mit derselben unterschwelligen Verzweiflung: »Wie machst du das nur allein?«
Während ich durch weitere Profile scrollte, ließ mich die Frage nicht mehr los. Natürlich gab es auch andere Bilder – Schnappschüsse von Müttern, die inmitten des Chaos strahlten, Posts über die kleinen Wunder des Alltags mit Kindern. Sie zeigten, dass Mutterschaft neben allen Herausforderungen auch eine Quelle tiefer Freude und Erfüllung sein kann. Doch selbst hinter diesen positiven Momentaufnahmen schien die Frage zu lauern, wie viel leichter alles wäre, wenn Mütter die Last nicht überwiegend allein tragen müssten.
Natürlich gibt es viele Männer, die sich sehr in der Kindererziehung engagieren und aktiv Verantwortung übernehmen. Ebenso gibt es Unternehmen, die Eltern durch großzügige Elternzeitregelungen und flexible Arbeitszeiten unterstützen und so dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Auch regionale Unterschiede spielen eine Rolle – in ländlichen Gegenden mögen die Strukturen oft anders sein als in der anonymen Großstadt. Meine Beobachtungen sind Ausschnitte einer vielschichtigen Realität, die von vielen Faktoren beeinflusst wird.
Die Stadt schläft nie
Was zunächst als routinemäßige Recherche begann, führte mich bald auch in die Nächte der Großstadt. Die wahren Geschichten der heutigen Mutterschaft, so lernte ich schnell, spielen sich nach Einbruch der Dunkelheit ab. Wenn die perfekten Instagram-Filter verblassen und die Fassaden bröckeln, wenn die sorgsam konstruierten Bilder des Tages wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen.
In den erleuchteten Fenstern der Hochhäuser entstehen in meiner Vorstellung Bilder moderner Mutterschaft: Ich stelle mir vor, wie eine Frau zwischen Laptop und Babybett pendelt, wie eine andere rastlos durch ihr Smartphone scrollt. Diese nächtlichen Eindrücke, die sich aus den Lichtpunkten in der Dunkelheit und den Erzählungen meiner Interviewpartnerinnen zusammensetzen, sind mehr als reine Imagination – sie werden zu Symbolen für die systematische Überforderung einer ganzen Generation von Müttern.
Ein besonders aktives Fenster im zweiten Stock zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Im bläulichen Licht eines Bildschirms erkenne ich eine sich bewegende Silhouette – vermutlich eine Person, die im Raum umhergeht. Von meiner Position auf der Straße kann ich nur Umrisse wahrnehmen, doch die nächtliche Szene erinnert mich an die Schilderungen vieler Mütter in meinen Interviews: der Versuch, die Stille der Nacht produktiv zu nutzen, das ständige Hin und Her zwischen Arbeit und Fürsorge.
Meine eigene Entscheidung gegen Kinder in den 1990er-Jahren folgte zunächst dem Ruf nach Unabhängigkeit und beruflicher Entwicklung. Doch heute, im Rückblick, erkenne ich darin auch eine frühe Reaktion auf ein System, das ich damals nur unterschwellig als problematisch empfand. Obwohl ich, anders als Ruth, gute äußere Voraussetzungen hatte – eine stabile Partnerschaft, ein stabiles Umfeld, finanzielle Sicherheit –, spürte ich schon damals eine diffuse Skepsis. Es war, als hätte ein Teil von mir bereits geahnt, dass das Versprechen der Vereinbarkeit auf einem gesellschaftlichen Modell basiert, das im Widerspruch zu unserem tief verwurzelten Bedürfnis nach gemeinschaftlicher Fürsorge steht.
Die digitale Dämmerung
Wenn die Stadt zur Ruhe kommt, erwacht in den sozialen Medien ein verborgenes Netzwerk schlafloser Mütter. Marina, die ich am Nachmittag in ihrer sorgfältig eingerichteten Wohnung im achten Stock getroffen habe, zeigte mir ihre verschiedenen Social-Media-Profile. »Hier, mein öffentlicher Account«, sagte sie und scrollte durch eine endlose Reihe makelloser Momente. Designer-Babykleidung, selbst gebackene Vollkornmuffins, lächelnde Mutter-Kind-Selfies.
Dann öffnete sie eine andere App, eine geschlossene Gruppe. Hier fallen die Masken: Frauen teilen ihre Erschöpfung, ihre Ängste, ihre Einsamkeit. Sie halten zusammen, stützen sich gegenseitig, teilen Tipps und Trost in den dunklen Stunden. Innerhalb von Minuten entwickelt sich ein digitaler Unterschlupf für Schlaflose.
Bei meinen Recherchen fand ich typische Aussagen wie diese: »Manchmal frage ich mich, ob das normal ist, wie wir heute leben«, schreibt eine Mutter um 2.15 Uhr. »Jede allein in ihrer Wohnung, nur das Smartphone als Verbindung zur Außenwelt, während die Babys schlafen. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an.«
»Wenn ich meine Oma besuche, erzählt sie oft von früher«, antwortet eine andere. »Da war das Leben zwar sehr einfach, aber niemand war allein. Die Nachbarinnen schauten einfach vorbei, die Schwestern wohnten nebenan, die eigene Mutter war immer in der Nähe.«
Die anonymen Geständnisse haben ihre eigene Geografie: Mütter-Gruppen für jede Zeitzone, sodass immer jemand wach ist. WhatsApp-Gruppen und andere digitale Treffpunkte, die sich nach den Schlafphasen der Kinder organisieren – für jede noch so einsame Nachtstunde findet sich irgendwo eine andere wache Mutter.
»Nachts scrolle ich manchmal durch meine Instagram-Fotos vom Tag«, erzählt eine Mutter. »Die glückliche Mama beim Breifüttern, beim Spaziergang, beim Vorlesen. Alles so schön. Dabei war ich den ganzen Tag kurz vorm Heulen. Aber so was zeigt man ja nicht.«
In dieser digitalen Dämmerungszone entsteht eine parallele Realität, die sich fundamental von der Tageswelt unterscheidet. Dieselben Frauen, die tagsüber makellose Instagram-Storys von selbst gebackenen Vollkornmuffins und perfekt organisierten Kinderzimmern posten, enthüllen nachts ihre ungefilterte Wahrheit. Es ist, als schaffte die Dunkelheit einen geschützten Raum, in dem die mühsam aufrechterhaltenen Fassaden bröckeln dürfen. Eine Mutter beschreibt es in einem 3-Uhr-Post so: »Manchmal scrolle ich nachts durch meine eigenen Social-Media-Profile und frage mich, wer diese perfekte Frau ist, die ich da tagsüber spiele. Dabei sitze ich hier im zerknitterten Pyjama, habe seit drei Tagen nicht geduscht und weine heimlich über Fotos von Müttern, bei denen wohl alles besser klappt als bei mir.«
Es ist, als ob die Dunkelheit einen Raum eröffnete, in dem die ungeschriebenen Gesetze der digitalen Selbstdarstellung für einen Moment außer Kraft gesetzt sind. Die digitale Vernetzung in den nächtlichen Stunden mag ein moderner Ersatz für etwas sein, das Menschen früher ganz selbstverständlich hatten: direkte, persönliche Unterstützung in Zeiten der Not. Während heute Mütter einzeln vor ihren Bildschirmen sitzen, gab es in traditionellen Gemeinschaften zumindest die Möglichkeit, sich auch nachts real zu begegnen.
Es ist eine bittere Ironie, dass ausgerechnet in einer Zeit, in der Mütter dank digitaler Technologien scheinbar ständig vernetzt sind, viele von ihnen sich einsamer fühlen denn je. Die nächtliche Selbstreflexion vor dem Bildschirm mag oberflächlich an die traditionellen Praktiken der Kommunikation erinnern – doch ohne die tröstende Gegenwart realer Vertrauter droht sie zu einem einsamen Echo in der digitalen Leere zu werden.
Das kollektive Schweigen
Um zwei Uhr morgens erreicht die psychische Belastung scheinbar einen Höhepunkt. Die nächtlichen Online-Foren füllen sich mit Geständnissen, die im Tageslicht undenkbar wären. »Ich fühle mich manchmal so verloren«, schreibt eine Nutzerin. »Als ob alle anderen wüssten, wie man Mutter ist, nur ich nicht!«
Die nächtlichen Foren sind voll von To-do-Listen, die die versteckte Last des Alltags enthüllen. Eine Mutter listet auf, was sie alles »nebenbei« im Kopf behalten muss: die Entwicklungsphasen aller Kinder, medizinische Historien, Kleidergrößen, Essensvorlieben, Allergien, soziale Dynamiken in Kita und Schule, Termine, Hausaufgaben, emotionale Befindlichkeiten – und natürlich ihren eigenen Job.
Der sogenannte Gender Care Gap zeigt das Ausmaß dieser ungleichen Verteilung: Erwerbstätige Frauen stemmen nach wie vor den Löwinnenanteil an Kinderbetreuung, Pflege und Hausarbeit: »Das heißt, dass Frauen mit 4,13 Stunden 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen als Männer mit 2,46 Stunden. Dies sind 87 Minuten täglich, die Frauen mehr für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. (…) Mütter verrichten in dieser Konstellation täglich zweieinhalb Stunden mehr Sorgearbeit als Väter, sodass der Gender Care Gap 83,3 Prozent beträgt.«[1]
»Das Schlimmste ist, dass du nie wirklich abschalten kannst«, kommentiert eine andere. »Selbst wenn dir jemand hilft – du musst trotzdem alles im Kopf behalten, planen und koordinieren. Die Verantwortung wirst du nie los.«
Die psychologische Dimension der modernen Mutterschaftskrise zeigt sich besonders in den Übergangsmomenten zwischen Tag und Nacht. Wenn die perfekten Fassaden bröckeln, wenn die mühsam aufrechterhaltene Kontrolle zusammenbricht. Es sind Momente einer verstörenden Ehrlichkeit, die Fragen aufwerfen über die psychischen Kosten unserer Art, Mutterschaft zu organisieren.
In traditionellen Gesellschaften war das Wissen um Kinderbetreuung auf viele Schultern verteilt. Es gab ein Netzwerk von Erfahrungen und Kompetenzen – Großmütter, Tanten, ältere Geschwister, die gesamte Gemeinschaft trug zum Aufwachsen der Kinder bei. Keine einzelne Person musste den Überblick über alles behalten.
Diese Geständnisse enthüllen auch eine erschreckende Paradoxie: Je mehr wir über Mutterschaft zu wissen glauben, desto unsicherer scheinen sich Mütter in ihrer Rolle zu fühlen. Die Flut an Expertenwissen, Apps und Optimierungsstrategien hat die intuitive Sicherheit nicht gestärkt, sondern untergraben.
Die neue Armutsfalle
Die finanziellen Sorgen zeigen sich besonders in den nächtlichen Online-Foren. Doch während diese digitalen Räume zumindest eine Form des Austauschs und der gegenseitigen Unterstützung ermöglichen, bleiben sie vielen Familien verwehrt. Die beschriebenen Erfahrungen spiegeln also nur einen privilegierteren Ausschnitt der gesellschaftlichen Realität wider. Viele Familien haben aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation nicht einmal Zugang zu den diskutierten digitalen Vernetzungsmöglichkeiten – kein Smartphone, keinen Internetanschluss, keine Möglichkeit zur virtuellen Vernetzung. Ihre Situation stellt sich oft noch drastischer dar, da ihnen selbst diese letzte Form des sozialen Austauschs verwehrt bleibt.
Diejenigen, die Zugang zu digitalen Räumen haben, nutzen sie vor allem in den dunklen Stunden, wenn die Sorgen übermächtig werden. In der Anonymität der Nacht wird die wahre Dimension der finanziellen Belastungen sichtbar. Um drei Uhr morgens häufen sich die Posts über Existenzängste: Berechnungen der Kitakosten, Klagen über schlecht entlohnte Teilzeitarbeit, verzweifelte Fragen nach günstigeren Wohnungen. Was tagsüber hinter tapferem Lächeln versteckt wird, kommt nachts zum Vorschein.
»Teilzeit ist eine Falle«, schreibt eine Controllerin um 3.45 Uhr. »Du arbeitest faktisch Vollzeit, bekommst aber nur 60 Prozent bezahlt. Die restlichen Stunden machst du nachts – unbezahlt, unsichtbar.« Die Resonanz ist überwältigend. Dutzende Frauen teilen ähnliche Erfahrungen, rechnen vor, wie ihre »Teilzeit«-Wirklichkeit aussieht.
In einem Café war ich an einem Nachmittag zufällig Zeugin eines bezeichnenden Gesprächs. Zwei Freundinnen, beide schwanger, kalkulierten ihre finanzielle Zukunft. »Die Kita kostet fast mein halbes Gehalt«, sagte die eine. »Aber ohne Kita kann ich nicht arbeiten. Und ohne Arbeit kann ich mir die Kita nicht leisten.« Die andere nickte: »Ein Teufelskreis. Und an Altersvorsorge ist gar nicht zu denken.«
Auch die nächtlichen Online-Diskussionen enthüllen in manchen Fällen die versteckten Kosten der Mutterschaft. Eine Frau listet auf: Kinderbetreuung, größere Wohnung, gesünderes Essen, Versicherungen. »Niemand spricht darüber, wie schnell du in die roten Zahlen rutschst«, kommentiert sie. »Besonders als Alleinerziehende.«
In der ersten U-Bahn um 4.30 Uhr kann man sie oft sehen, die Gesichter der finanziellen Erschöpfung. Frauen, die zu Billiglohnjobs aufbrechen, während ihre Kinder noch schlafen; die sich keine Tagesmutter leisten können und deshalb von Nachtschichten zurückkehren; die zwischen drei Teilzeitjobs pendeln, um irgendwie über die Runden zu kommen.
Wie eine detaillierte Studie der Bertelsmann Stiftung vom Juni 2024 zeigt, ist die Situation besonders dramatisch für Familien von Alleinerziehenden: Vier von zehn sind armutsgefährdet. Knapp die Hälfte aller Kinder, die in Familien mit Bürgergeldbezug aufwachsen, leben mit nur einem Elternteil zusammen. Besonders bemerkenswert: Diese prekäre Situation besteht, obwohl die meisten Alleinerziehenden erwerbstätig sind. Dabei zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: In Westdeutschland sind Alleinerziehende seit 2020 häufiger von Sozialleistungen abhängig als in den ostdeutschen Ländern – mit Bremen als Spitzenreiter (55 Prozent) und Thüringen am unteren Ende der Skala (27 Prozent). Besonders alleinerziehende Mütter tragen dabei eine doppelte Last: Sie sind nicht nur überdurchschnittlich von Armut bedroht, sondern schultern auch den Großteil der Kinderbetreuung und -erziehung.[2]
Während diese Frauen zur Arbeit fahren, beginnt in anderen Teilen der Stadt eine andere Art von Schichtwechsel. In den Apartments der Banker und Manager arbeiten oft Kindermädchen aus Osteuropa oder Asien. Sie betreuen hier fremde Kinder, während ihre eigenen in der Heimat von Großmüttern versorgt werden – eine Art globale Umverteilung von Mutterschaft, die historisch neue Fragen aufwirft.
Die sozialen Unterschiede zeigen sich besonders in den Bewältigungsstrategien. Während gut verdienende Mütter ihre Erschöpfung mit Yoga-Kursen und Coaching-Sessions bekämpfen, greifen andere zu drastischeren Lösungen. »Manchmal nehme ich eine Nachtschicht extra«, erzählt Sophie, die in einem Krankenhaus putzt. »Nicht wegen des Geldes – nur um ein paar Stunden Ruhe zu haben. Meine Schwester passt dann auf die Kinder auf.«
Die Online-Foren spiegeln diese Spaltung. In manchen Gruppen geht es um die Auswahl der besten Waldorf-Kita, in anderen um Tricks, wie man mit Überstunden die Kinderbetreuung finanziert. Die Einsamkeit der Nacht kennt keine Klassengrenzen, aber die Möglichkeiten, mit dieser nächtlichen Isolation umzugehen, sind höchst ungleich verteilt.
Die finanzielle Unsicherheit in der Gegenwart setzt sich dabei oft bis ins Alter fort: Die Altersrente von Frauen ist im Westen im Durchschnitt knapp 38 Prozent niedriger als bei Männern, im Osten 14 Prozent. Ein wesentlicher Grund dafür sind die geringeren Löhne und kürzeren Beitragszeiten, häufig aufgrund der Erziehung von Kindern. Zwar schafft die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rente einen gewissen sozialen Ausgleich – ohne diesen wäre der Unterschied noch drastischer. Doch das grundlegende Problem der finanziellen Benachteiligung bleibt bestehen, wie aktuelle Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund von 2025 belegen.[3]
Unsere evolutionären Wurzeln
Die evolutionäre Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy liefert in ihrem Buch Mütter und Andere eine überraschende Perspektive auf das Dilemma der einsamen Mütter. Bei den Aka-Jägern und -Sammlern in Zentralafrika bleiben Väter mehr als 50 Prozent eines 24-Stunden-Tages in Reichweite ihrer Säuglinge und verbringen erstaunliche 22 Prozent ihrer Zeit damit, ihre Babys zu halten und zu umarmen.[4] Der Kontrast zu westlichen Gesellschaften ist frappierend: Laut einer aktuellen Veröffentlichung des Momentum-Instituts von 2025 sind es fast ausschließlich die Mütter, die die nächtliche Fürsorge übernehmen. Bei Säuglingen unter einem Jahr kümmern sich in 87 Prozent der Fälle die Mütter vor dem Schlafengehen um die Kinder, und in 71 Prozent der Fälle sind sie es auch, die nachts aufstehen.[5]





























