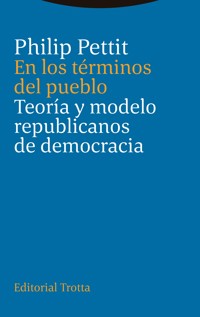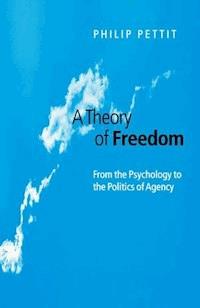17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was heißt Freiheit heute – jenseits einer auf persönliche Interessendurchsetzung zielenden neoliberalen Marktfreiheit? Können wir noch ein Freiheitsverständnis entwickeln, das uns moralische Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt bietet? Philip Pettit, einer der meistdiskutierten Philosophen der Gegenwart, entwickelt in seinem mitreißenden Buch einen Freiheitsbegriff, der die Idee eines nichtbeherrschten Lebens in sein Zentrum stellt. Freiheit heißt ihm zufolge: sein eigener Herr sein, allen auf Augenhöhe begegnen können und den Einfluss anderer Menschen nicht fürchten müssen. Das hat weitreichende soziale, ökonomische und politische Konsequenzen. Ein unverzichtbarer Kompass für die Navigation im 21. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Was heißt Freiheit heute – jenseits einer auf persönliche Interessendurchsetzung zielenden neoliberalen Marktfreiheit? Verfügen wir noch über ein Freiheitsverständnis, das uns moralische Orientierung in einer immer komplexeren Welt bietet? Philip Pettit, einer der meistdiskutierten Philosophen der Gegenwart, entwickelt in seinem mitreißenden Buch einen Freiheitsbegriff, der die Idee eines nichtbeherrschten Lebens in sein Zentrum stellt. Freiheit heißt ihm zufolge sein eigener Herr sein, allen auf Augenhöhe begegnen können und den Einfluss anderer Menschen nicht fürchten müssen. Das hat weitreichende soziale, ökonomische und politische Konsequenzen.
Pettit verfolgt diese republikanische Idee der Freiheit von ihrer Entstehung in der Römischen Republik über den Republikanismus der Florentiner Renaissance bis hin zur englischen Revolution der 1640er Jahre und zur amerikanischen Revolution des 18. Jahrhunderts, um sie dann auf brillante Weise zur Lösung aktueller Probleme fruchtbar zu machen. Im sozialen und ökonomischen Bereich ergibt sich daraus die Notwendigkeit weitreichender sozialstaatlicher Interventionen, robuster Arbeitnehmerrechte. Mit Blick auf die Demokratie stellt Pettit neuartige Überlegungen an, wie man die Bürger nicht nur über Wahlen als Autoren der Gesetze stärken kann, sondern auch über sogenannte »Kontestationen« von Mehrheitsentscheidungen. Und im Hinblick auf die internationale Politik begründet er, warum die Staaten, die ihre Bürger vor Beherrschung schützen, nicht selbst zum Opfer von Beherrschung durch mächtigere Staaten, multinationale Konzerne oder internationale Organisationen werden dürfen. Ein unverzichtbarer Kompass für die Navigation im 21. Jahrhundert.
Philip Pettit, geboren 1945 in Ballygar, Irland, ist Philosoph und Politikwissenschaftler. Nach Stationen am University College in Dublin, an der Cambridge University und der Australian National University ist er heute Laurance S. Rockefeller University Professor of Politics and Human Values an der Princeton University. Zudem war Pettit unter anderem auch als Berater der spanischen Regierung unter José Luis Zapatero tätig. Für sein in viele Sprachen übersetztes Werk hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
Philip Pettit
Gerechte Freiheit
Ein moralischer Kompass für eine komplexe Welt
Aus dem Amerikanischen von Karin Wördemann
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Just Freedom. A Moral Compass for a Complex World, W. W. Norton & Company, New York
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© Philip Pettit 2014
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-518-74098-9
Für meine Familien in Ballygar, Canberra und Vancouver
Inhalt
Prolog
Teil 1 Die Idee der Freiheit
Kapitel 1: Vergangenheit und Gegenwart der Freiheit
Kapitel 2: Freiheit mit Tiefe
Kapitel 3: Freiheit mit Breite
Teil 2 Die Institutionen der Freiheit
Kapitel 4: Freiheit und Gerechtigkeit
Kapitel 5: Freiheit und Demokratie
Kapitel 6: Freiheit und Souveränität
Epilog
Anhang: Ein Überblick über die Argumentation
Danksagung
Anmerkungen
Literatur
Namenregister
Prolog
In den meisten Gesellschaften können wir uns heute bei fast allen Angelegenheiten von öffentlichem Interesse aus einer Vielzahl von Quellen über das Geschehen kundig machen. Wir können uns mehr oder weniger einfach darüber informieren, was man hätte tun können und was nicht getan wird, was getan wird und was man vielleicht nicht hätte tun sollen. In den meisten Gesellschaften haben wir heute auch kaum Schwierigkeiten, uns darüber zu verständigen, was unserer Meinung nach falsch läuft, indem wir die sozialen Medien benutzen, um uns darüber zu beschweren, wie uns unsere staatlichen Institutionen und unsere öffentlichen Repräsentanten behandeln. Diese Fähigkeit, Urteile über öffentliche Angelegenheiten zu bilden und auszutauschen, ist die helle Seite unseres politischen Lebens und unserer politischen Kultur.
Die dunkle Seite besteht darin, dass es in diesem Durcheinander von Daten und Meinungen immer schwieriger geworden ist, festzustellen, welche der Beschwerden über die Regierungen begründet und welche unbegründet sind. Wir können durchaus fähig sein zu sagen, wo uns unsere nationalen und internationalen Regierungschefs hinführen wollen, doch die Komplexität der Fragen und der Wirbel in der Politik erschweren es, die Vorteile konkurrierender Initiativen abzuschätzen. Wie durchschaubar das Aufgebot an Optionen in der Öffentlichkeit auch sein mag, das jeweilige Pro und Contra bleibt dennoch undurchsichtig. Wir sehen zwar die verschiedenen Richtungen, in die sich unsere Gesellschaften bewegen können, aber es fehlt uns ein moralischer Kompass, mit dem sich bestimmen ließe, welche Wege die besten sind.
Sollte unser Staat für die Bedürftigen sorgen oder die Wohltätigkeit privaten Händen überlassen? Sollte er ein System einrichten, das Krankenversicherung zur Pflicht macht, oder sollten Menschen selbst entscheiden können, ob sie sich versichern oder nicht? Sollte die private Finanzierung von Wahlkampagnen Beschränkungen unterliegen oder würde ein solcher Schritt den Geist einer offenen Demokratie verletzen? Sollten unsere Zentralbanken und Gerichte in den Händen nichtgewählter Beamter liegen oder sollten solche maßgeblichen Posten vergleichbar unseren Gesetzgebern im Spießrutenlauf eines Wahlkampfs besetzt werden? Sollte jedes Land die Autorität der Vereinten Nationen und ähnlicher Körperschaften in verschiedenen Bereichen anerkennen oder wäre das Verrat an der Souveränität eines Staates? Sollten reiche Staaten verpflichtet werden, den Armen und Unterdrückten zu helfen, oder würde das die Steuerzahler dieser Staaten zu einer unfreiwilligen Form der Wohltätigkeit zwingen?
Wenn wir nicht den Kopf in den Sand stecken, werden wir in unserem Alltagsleben unweigerlich mit Fragen wie diesen konfrontiert werden. Doch wie sollen wir in irgendeiner dieser Fragen zu einer Entscheidung kommen, sei es als gewöhnliche Bürger, als Inhaber eines öffentlichen Amts oder als angehende Aktivisten? Wie sollen wir bestimmen, was richtig und was falsch ist, sobald wir die Tatsachen des Falls zu unserer Zufriedenheit geklärt haben? Die ideale Lösung würde darin bestehen, einen überzeugenden Bezugspunkt für solche Urteile zu finden, und zwar einen, der außerhalb des antagonistischen Hickhacks der alltäglichen Politik angesiedelt wäre. Ein solcher Bezugspunkt würde einen moralischen Kompass liefern, der uns prinzipiengeleitet durch das Dickicht öffentlicher Angelegenheiten führen würde. Zusammen mit sachlichen Annahmen zum Hintergrund solcher Fragen würde er uns helfen zu erkennen, wofür wir uns einsetzen sollten.
Damit ein solcher Bezugspunkt plausibel wäre, müsste er einen ökumenischen Wert – oder Werte – haben, den Menschen aus allen politischen Lagern als relevant ansehen könnten, einmal angenommen, sie sind bereit, andere als Gleiche zu behandeln. Es müsste kein Wert sein, dem alle in ihrem Denken über Politik die alleinige Autorität einräumen wollten, aber es sollte zumindest ein Wert sein, den alle als einen plausiblen Kandidaten für eine derartig wegweisende Rolle anerkennen können. Es sollte ein Wert sein, bei dem dessen Befürworter berechtigterweise erwarten dürfen, dass ihm in allen Lagern Gehör geschenkt wird, wenn sie seine Ansprüche verteidigen.
Angesichts der Vielfalt, die bei den zeitgenössischen Konzeptionen des guten Lebens herrscht, könnte man einen moralischen Kompass dieser ökumenischen Art für einen Tagtraum halten. Eine solche Resignation wäre jedoch verfrüht. In diesem Buch argumentiere ich dafür, einen moralischen Kompass an der Vorstellung von Freiheit auszurichten, an einem ökumenischen Wert, dessen politische Relevanz wohl kaum jemand bestreiten wird. Wenn er in der Weise interpretiert wird, wie er mit dem jahrhundertealten Ideal der Republik verbunden ist, hat dieser einfache Wert das Potenzial, uns eine vereinheitlichende und aufschlussreiche Perspektive auf viele strittige Fragen zu verschaffen, die unsere heutige komplexe Welt aufwirft. In ihre ursprüngliche republikanische Form gebracht, kann uns Freiheit einen plausiblen Gesichtspunkt liefern, unter dem wir Fragen nach dem politisch Richtigen und Falschen einschätzen können. Er ist an sich ausreichend, um eine nuancierte, einleuchtende Philosophie des öffentlichen Lebens zu begründen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich Sie davon überzeugen kann.
Die Bedeutung von Freiheit
Gegen Ende des Jahres 1879 inszenierte das Königliche Theater in Kopenhagen die Erstaufführung von Henrik Ibsens Stück Nora oder Ein Puppenheim. Das Stück eroberte Dänemark und Europa im Sturm und begründete Ibsens bleibendes Ansehen als Dramatiker von Weltrang. Wie jedes gute Theaterstück wirft es viele wichtige Fragen auf. Mich fasziniert es aber besonders wegen der Frage, die es zur Bedeutung von Freiheit aufwirft.
Die Hauptfiguren in Ibsens Stück sind Torvald, ein noch recht junger und erfolgreicher Bankdirektor, und seine Frau Nora. Im Rahmen des Rechts im 19. Jahrhundert hat Torvald große Verfügungsgewalt darüber, wie seine Ehefrau handeln kann, aber er ist in sie vernarrt und schlägt ihr nichts ab – zumindest nichts, was in den anerkannten Koordinaten eines Lebens als Bankdirektorsfrau liegt. Er verbietet ihr zugegebenermaßen die Makronen, die sie besonders gern mag. Doch selbst dieses Verbot ist keine wirkliche Einschränkung, da sie die Makronen verstecken kann. Nora hat also freie Hand, was die gewöhnlichen Dinge des Alltagslebens angeht. Sie genießt einen Handlungsspielraum, den sich eine Frau im Europa des 19. Jahrhunderts eigentlich nur wünschen konnte.
Nora erfreut sich vieler Dinge, um die man sie beneiden mag. Aber genießt sie wirklich Freiheit? Und hat sie Freiheit in ihrer Beziehung zu Torvald? Seine interventionsfreie Behandlung bedeutet, dass er sich nicht einmischt, wie politische Philosophen sagen. Er legt ihren Entscheidungen keinerlei Verbote oder Strafen in den Weg, noch manipuliert oder täuscht er sie bei der Durchführung dieser Entscheidungen. Aber reicht das aus, damit wir uns Nora als eine frei Handelnde vorstellen können? Wenn Freiheit in Nichteinmischung (non-interference) besteht, wie viele Philosophen glauben, müssen wir sagen, dass es so ist.1 Ich vermute allerdings, dass Sie ebenso wie ich vor einem solchen Urteil zurückscheuen werden. Sie werden meinen, dass Nora unter Torvalds Pantoffel steht. Sie ist eine Puppe in einem Puppenheim und keine freie Frau.
Wenn Sie dem zustimmen, sollten Sie die Konzeption von Freiheit gutheißen können, die dieses Buch motiviert. Jemandes Freiheit als Person verlangt mehr als nur unbehelligt zu bleiben oder lediglich von Nichteinmischung zu profitieren; sie erfordert größere Vorzüge als alle, deren sich Nora erfreut. Um eine freie Person zu sein, muss man über die Fähigkeit verfügen, bestimmte wesentliche Entscheidungen zu treffen, ohne die Erlaubnis eines anderen einholen zu müssen – Entscheidungen darüber, welche Religion man ausüben will, ob man sagen will, was man denkt, oder mit wem man sich verbünden will und so fort. Man muss in der Lage sein, solche fundamentalen Rechte oder Grundrechte, wie sie normalerweise genannt werden, auszuüben, ohne irgendeinem Herrn oder dominus im eigenen Leben Rede und Antwort stehen zu müssen.
Freiheit in diesem Sinne erfordert nicht nur das Fehlen von Einmischung, sondern von Unterordnung unter einen anderen, was zur Zeit der Römischen Republik als dominatio oder Herrschaft bekannt war (Lovett 2010, Anhang I). Wie wir in Kapitel 1 noch ausführlicher sehen werden, wurde das Ideal der Freiheit als Nichtbeherrschung (non-domination) gerade in dieser Republik und den vielen späteren Republiken, die sich nach dem Vorbild Roms gestalteten, am schärfsten artikuliert und überaus enthusiastisch aufgegriffen. Die Freiheit der Person wurde in diesen Regierungssystemen derjenigen Freiheit gleichgesetzt, über die vollständig integrierte und entsprechend rechtsmündige Bürger verfügen.
Die unterlassene Einmischung, derer sich Nora erfreut, reicht für eine Freiheit in diesem Sinne nicht aus, denn sie geht nur auf Torvalds Gnade und Gunst zurück. Um Freiheit zu haben, muss man eine Einmischung verhindern können, selbst wenn andere dies vorhaben, und genau das kann Nora nicht. Wenn sich Torvald gegen sie wenden würde und ihr sein Wohlwollen entzöge, dann würde sie keine Nichteinmischung von seiner Seite mehr erwarten können. So wie die Dinge liegen, verdankt sie ihm den Entscheidungsspielraum, den sie genießt. Aufgrund seiner rechtlichen und kulturellen Machtstellung ist sie seinem Willen unterworfen, und allein ihr glückliches Schicksal und nicht der Status, eine freie Frau zu sein, erklärt, warum sie seiner Einmischung in ihr Leben entgeht.
Wenn Nora wirklich frei sein soll, braucht sie also nicht bloß das Fehlen von Einmischung, sondern das Fehlen von Beherrschung: das heißt die Abwesenheit von Unterwerfung unter den Willen anderer, insbesondere den Willen Torvalds. Dazu werden wir in späteren Kapiteln noch sehr viel mehr zu sagen haben, aber die Idee im Allgemeinen sollte klar sein. Um sich in ihrem Leben einer derartigen Nichtbeherrschung zu erfreuen, müsste Nora Schutz genießen vor jemandes Fähigkeit, in die Ausübung ihrer Grundfreiheiten einzugreifen, wenn ihm der Sinn danach stehen sollte. Nora müssten entsprechende Sicherheiten gegen jedwede willkürliche Einmischung in ihre Entscheidungen gewährt werden – gegen jede Einmischung, die ohne ihre Aufforderung oder Erlaubnis erfolgen könnte.
Noras Zwangslage sollte uns bekannt vorkommen. Man denke nur daran, wie es in einer Situation ist, in der man je nach Lust und Laune eines anderen schlecht behandelt werden kann, sei dieser nun ein Lehrer, ein Chef oder Bankmanager, ein Versicherungsvertreter oder ein Ladenangestellter, ein Polizist, Grenzbeamter oder Gefängniswärter. Man versetze sich in die Lage, keinen physischen oder rechtlichen Beistand zu haben gegen eine solche unkontrollierte oder willkürliche Machtdemonstration im eigenen Leben, man erinnere sich, wie es ist, der Macht dieses anderen ausgeliefert zu sein, auf das Wohlwollen dieser Person angewiesen zu sein, um ohne Verlust oder Schaden davonzukommen. Eine derartige Abhängigkeit läuft auf die gleiche Unfreiheit hinaus, wie Nora sie hinnehmen muss. Wenn man nun mit Nachsicht und Wohlwollen behandelt wird, wie es bei Nora der Fall ist, ist man natürlich erheblich besser dran, als wenn man der Bösartigkeit eines anderen ausgesetzt ist. Doch selbst wenn man der Misshandlung entgeht, kann man sich nur zu einem glücklichen Schicksal gratulieren und nicht zur Freiheit.
Wenn diese Konzeption von Freiheit als Nichtbeherrschung Anklang bei Ihnen findet und wenn Sie glauben, diese Freiheit sei für alle wertvoll, werden Sie zwangsläufig eine kritische Perspektive auf die zeitgenössische Gesellschaft einnehmen. Sie werden den Wert sozialer und politischer Regelungen anerkennen müssen, die in Noras Milieu nicht existierten und häufig auch in unserem eigenen Umfeld fehlen. Wir bilden uns etwas darauf ein, wie viel Freiheit wir in der Moderne – zumindest in vielen unserer Gesellschaften – gewonnen haben, doch gemessen an dem Ideal der Freiheit als Nichtbeherrschung lassen selbst die allerfreundlichsten Gemeinwesen zu wünschen übrig. Eine Gesellschaft, in der die Menschen Freiheit als Nichtbeherrschung genießen, würde eine Republik wechselseitiger Ermächtigung und gegenseitigen Respekts erfordern, der unsere verschiedenen Länder bislang nur fragmentarisch und unvollständig gleichen.
Damit komme ich zum Thema dieses Buchs. Freiheit als Nichtbeherrschung ist ein anspruchsvolles Ideal, das uns einen Fortschritt vor Augen stellt, den wir für die soziale und politische Organisation unserer Welt erhoffen und erstreben sollten. Und wichtiger noch, unter den anspruchsvollen Idealen ist es nahezu einmalig, weil es einen plausiblen, vereinheitlichenden Maßstab liefert, mit dem sich das Niveau des sozialen und politischen Fortschritts in jeder Gesellschaft messen lässt.
Die Beurteilung nationaler und internationaler Regelungen kann keinem von uns gleichgültig sein, da sie Fragen aufwerfen, mit denen wir alle als Beobachter, als Aktivisten oder als Verantwortliche konfrontiert sind. Wir alle benötigen deshalb ein Kriterium, mit dem wir bestimmen können, welche Klagen über bestehende Regelungen fair und welche unfair sind, welche Veränderungsvorschläge aufgegriffen werden sollten und welche als zu wenig kenntnisreich oder allzu idealistisch verworfen werden sollten. Dieses Buch unterbreitet den Vorschlag, dass das Ideal der Freiheit als Nichtbeherrschung auf diese Beschreibung passt. Es ermöglicht uns, genau zu erfassen, wo und inwieweit unsere verschiedenen Gemeinschaften und die Welt als Ganzes dem, was die Gerechtigkeit verlangt, nicht entsprechen. Es kann uns wie eine globale Lokalisierungshilfe, ein GPS, in die Lage versetzen, inmitten der komplexen politischen Fragen, mit denen wir uns in der Welt des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen müssen, unseren Weg zu finden.
Gerechtigkeit ist Freiheit, Freiheit ist Gerechtigkeit
Wenn wir darüber nachdenken, was eine Gesellschaft gerecht machen würde, stoßen wir auf Fragen in drei Kategorien: soziale Gerechtigkeit, politische Gerechtigkeit und internationale Gerechtigkeit. Ich behaupte, dass wir alle diese Themen im Grunde genommen als Fragen danach behandeln können, wie sich die Verfügung über Freiheit als Nichtbeherrschung am besten fördern lässt.
Nehmen wir als Erstes die Problematik der sozialen Gerechtigkeit: das heißt Fragen zu den Beziehungen zwischen den Bürgern einer beliebigen Gesellschaft. Wie sollte eine Regierung das gemeinsame rechtliche und wirtschaftliche Leben ihrer Bürger organisieren? Sollte sie die Menschen in einem festgelegten, unnachgiebigen Rahmen ihres eigenen Schicksals und Lebens Schmied sein lassen? Oder sollte sie die weniger Glücklichen vor Armut und Not, vor mangelnder medizinischer Versorgung und fehlender Rechtsvertretung in einem Gerichtsprozess schützen? Sollte sie bei häuslicher Misshandlung oder allgemeiner betrachtet bei der Art von Abhängigkeit, die Nora veranschaulicht, für rechtlichen und sozialen Beistand sorgen? Und falls es so ist, sollte sie dann für diejenigen, die vom Wohlwollen eines Arbeitgebers oder Gläubigers, von einer Gewerkschaft oder einem Unternehmen in vergleichbarer Weise abhängig sind wie Nora von Torvald, ebenso schützend auftreten?
Der gängige Ansatz bei solchen Fragen beruft sich auf unsere Intuitionen dazu, was Gerechtigkeit bedeutet und was sie in dem Kontext einer besonderen Gesellschaft verlangt. Solche Intuitionen sind allerdings häufig vage und widersprüchlich, wobei die eine Person überzeugt ist, dass Gerechtigkeit einen unbeugsamen Individualismus unterstützt, eine andere hingegen, dass sie einen radikal umverteilenden Staat nötig macht. Das Freiheitsideal legt einen anderen, schärfer fokussierten Ansatz nahe. Dieser besteht darin, dass man die Erfordernisse sozialer Gerechtigkeit durch eine Untersuchung bestimmen lässt, die danach fragt, mit welchen sozialen Regelungen man die Freiheit als Nichtbeherrschung unter den Menschen am besten fördern würde.
Die rechtliche und ökonomische Ordnung einer Gesellschaft bestimmt das Ausmaß, in dem die Beziehungen, welche die Menschen untereinander eingehen, einigen Menschen erlauben oder nicht erlauben, andere Menschen in dem Bereich ihrer mutmaßlich persönlichen, grundlegenden Entscheidungen zu beherrschen. Deshalb impliziert das Freiheitsideal verständlicherweise – um eine spätere Argumentation vorwegzunehmen –, dass verschiedene Formen der Mittellosigkeit und Abhängigkeit anstößig und ungerecht sind. Die Ungerechtigkeit solcher Übel liegt in der Tatsache, dass jedes Elend die Betroffenen ziemlich sicher oder wahrscheinlich der Gnade anderer ausliefert. Solange beispielsweise die Armen und die Kranken nicht hinreichend abgesichert sind, werden sie sich in einer Lage befinden, in der sie auf das Wohlwollen der Mächtigeren angewiesen sind, um ihre Fähigkeit, so zu leben, wie sie es wollen, aufrechtzuerhalten: die Fähigkeit, ihre persönliche Wahl den eigenen Präferenzen entsprechend zu treffen. Wenn man verarmt ist – wenn einem die Mittel fehlen, in der Gesellschaft hinlänglich zu funktionieren (Sen 1985, Pettit 1993; Nussbaum 2006) –, wird man sehr wahrscheinlich in der Angst leben, wie einen die Reichen und Mächtigen behandeln, wenn man seine Gedanken frei äußert oder keine Vorsicht walten lässt, mit wem man sich einlässt. Damit wird die Überlegung plausibel, dass wir bestimmen können, was für soziale Gerechtigkeit erforderlich ist, indem wir die Rechts- und Wirtschaftsordnung einer Gesellschaft ausarbeiten, die es Ihnen und anderen ermöglichen würde, in Freiheit zu leben: das je eigene persönliche Leben führen zu können, ohne dass andere über die Macht verfügen, sich in das einzumischen, was man für sich wählt.
Freiheit als Nichtbeherrschung ist selbstverständlich nicht das einzige Gut im Leben. Aber sie ist ein Schlüsselgut, wie wir es nennen könnten: ein Gut, dessen Realisierung erwarten lässt, die Realisierung weiterer Güter nach sich zu ziehen. Wenn wir uns im Kontext der nationalen Gesetzgebung und Regierung um Freiheit als Nichtbeherrschung kümmern, um die Abhängigkeit der Menschen von anderen in Bereichen einer wirklich persönlichen Wahl zu verhindern, werden wir uns auch um solche Güter wie die soziale, medizinische und justizielle Sicherheit, Respektierung im häuslichen Bereich und am Arbeitsplatz und, allgemeiner betrachtet, um eine funktionierende Rechts- und Wirtschaftsordnung kümmern müssen. Sofern wir den Eintrittspreis für Freiheit zahlen, werden wir genug gezahlt haben, um uns damit den Zugang zu diesen anderen spezielleren Werten ebenfalls zu sichern.
Dies legt nahe, dass Freiheit in den Angelegenheiten sozialer Gerechtigkeit das einzig nötige, leitende Gut ist: Sie kann bei der politischen Entscheidungsfindung die Funktion eines regulativen Ideals erfüllen und als Maßstab für gerechtfertigte Kritik und berechtigten Protest dienen. Aber Freiheit als Nichtbeherrschung dient nicht bloß als Kriterium für soziale Gerechtigkeit. Auch die zwei anderen Hauptbereiche, die für die Politik von Interesse sind – politische Gerechtigkeit und internationale Gerechtigkeit –, werden von der Orientierung, die sie bietet, profitieren können.
Nehmen wir einige Probleme der politischen Gerechtigkeit: das heißt, der Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen den Bürgern und der Regierung, die ihr Leben bestimmt. Sollte die Stimmabgabe bei Wahlen das einzige Mittel sein, mit dem die Bürger auf Auswahl und Amtsausübung gewählter Vertreter Einfluss nehmen können? Sollte Lobbyismus erlaubt sein? Sollte die private Finanzierung zur Wahl stehender Kandidaten zugelassen sein? Sollte die Wahl auf die Mitglieder der Legislative und vielleicht noch den Chef der Exekutive eingegrenzt sein oder sollte sie auch auf Richter und andere Amtsinhaber ausgeweitet werden? Und wenn Richter und andere Autoritäten – Rechnungsprüfer, Statistiker, Ombudsleute, Zentralbanker – ernannt anstatt gewählt werden, was für Instruktionen und Zwänge sollten ihnen dann auferlegt werden?
Wir können sinnvoll darüber nachdenken, wie diese verzwickten Fragen zu lösen sind, indem wir überlegen, was Freiheit als Nichtbeherrschung im Verhältnis der Menschen zur Regierung eigentlich erfordert. Das Regieren beinhaltet zwangsläufig eine Einmischung in das Leben der Bürger, sei es auf dem Wege der Gesetzgebung, der Strafverfolgung oder der Besteuerung. Unser Ideal deutet aber an, dass diese Einmischung nicht beherrschend sein muss – und nicht von Natur aus der Freiheit abträglich sein muss –, solange die Menschen, die von der Einmischung betroffen sind, gleichmäßig daran beteiligt sind, die Form zu kontrollieren, die sie annimmt. Die staatliche Einmischung wird keine fremde Macht oder keinen fremden Willen in ihrem Leben darstellen, sofern sie nur gleichmäßig von der Bürgerschaft gelenkt wird. Das Ideal spricht also für eine Regierungsform, unter der die Einmischung der Regierung nach Bedingungen erfolgt, die vom Volk festgelegt sind, und nicht im unbeschränkten Ermessen derer liegt, die an der Macht sind. Ein solches Regierungssystem würde in einem strengen und anspruchsvollen Sinne als Demokratie gelten. Es würde der griechischen Etymologie des Wortes gerecht werden, indem es das Volk, den demos, im Verhältnis zu seiner Regierung mit Macht, kratos, ausstattet.
Schauen wir uns nun die Fragen politischer Gerechtigkeit an, brauchen wir uns also nicht auf unsere unterschiedlichen, oftmals vagen Intuitionen zu den Gerechtigkeitserfordernissen auf diesem Gebiet stützen. Wir werden lediglich überlegen müssen, was nötig ist, damit Menschen von denen, die an der Macht sind, unbeherrscht bleiben, selbst wenn sich diese in ihr Leben einmischen. Mit diesen und viele weiteren Fragen können wir uns im Laufe unserer Beschäftigung mit wahlbezogenen und nicht wahlbezogenen Institutionen befassen, denn wir werden näher darauf eingehen müssen, welche Institutionen gebraucht werden, wenn die Menschen gleichmäßig daran beteiligt sein sollen zu kontrollieren, wie die Regierung irgendeinen aus ihrer Mitte behandelt.
Dieselbe Vorgehensweise gilt im Großen und Ganzen auch für die internationale Gerechtigkeit, das heißt für die Gerechtigkeit zwischen den verschiedenen Völkern der Erde. Sollten die verschiedenen Völker der Welt bestimmte souveräne Freiheiten unabhängig vom Willen anderer genießen? Sollte sie ihre Souveränität in diesem Zusammenhang nicht nur vor anderen Staaten, sondern auch vor multinationalen Organisationen und internationalen Instanzen schützen? Und sollte eine derartige Souveränität etwas sein, das von den verschiedenen Völkern selbst zu verteidigen wäre, oder wäre sie im internationalen Recht und in internationaler Zusammenarbeit zu schützen? Wenn wir zu spezielleren Angelegenheiten übergehen: Haben die reicheren Völker irgendwelche Pflichten, den Verarmten in anderen, schlecht funktionierenden Gesellschaften zu helfen, und wie würden diese Pflichten aussehen? Haben sie irgendwelche Pflichten, andere Völker vor repressiven Regierungen in deren eigenem Land zu schützen, und welche wären das?
Wie bei Fragen der sozialen und politischen Gerechtigkeit können diese Fragen internationaler Gerechtigkeit sinnvoll als Fragen behandelt werden, die Freiheit als Nichtbeherrschung betreffen. Mit ihnen lassen sich einige Erfordernisse konkretisieren, die eine internationale Ordnung erfüllen muss, wenn sie für die Unabhängigkeit oder Souveränität einer jeden Gesellschaft die richtigen Voraussetzungen schaffen soll: für deren Fähigkeit, selbstbestimmt den eigenen Weg zu gehen. Zu den Gefahren gehören die Probleme, die durch Verarmung und Unterdrückung in einem Land entstehen – folglich die Fragen internationaler Hilfe und internationalen Schutzes –, doch zu den Problemen gehört auch die Gefahr für die Unabhängigkeit eines Volkes, die von der – militärischen, ökonomischen oder diplomatischen – Einmischung eines mächtigeren Staates oder von der Einmischung eines multinationalen Unternehmens ausgeht. Wir müssen untersuchen, welchen Anforderungen eine internationale Ordnung genügen muss, damit die verschiedenen Völker dieses Planeten jeweils Freiheit als Nichtbeherrschung – nicht bloß Freiheit als Nichteinmischung – im Verhältnis zu anderen Staaten und anderen nichtstaatlichen Körperschaften genießen können. Wir müssen wissen, wie die internationale Ordnung beschaffen sein muss, wenn sie die volle Souveränität der Völker sicherstellen soll, die das Freiheitsideal in Aussicht stellt.
Bislang hatte ich argumentiert, dass uns die Konzeption von Freiheit als Nichtbeherrschung erlaubt, alle Fragen der Gerechtigkeit letzten Endes als Fragen danach anzusehen, welche Anforderungen die Freiheit stellt: was sie in unseren sozialen Beziehungen untereinander, in den politischen Beziehungen zu unserer Regierung und in den Beziehungen zwischen den verschiedenen Gesellschaften auf der Erde voraussetzt. Die Zusammenführung dieser unterschiedlichen Fragen unter der Rubrik der Freiheit dient dem Zweck der Vereinfachung, da sie einen Leitfaden zur Verfügung stellt, der uns auch dann Orientierung bieten kann, wenn uns die Probleme wie ein dichter, undurchdringlicher Dschungel erscheinen.
Diese Übung kann aber nicht nur dem Zweck der Vereinfachung dienen, sondern auch einer Vereinheitlichung. Das Ideal der Freiheit ist nach fast allen Schulen politischen Denkens ein Kandidat für das Kriterium politischer Beurteilung. Der Aufbau einer umfassenden politischen Philosophie – einer Philosophie sozialer, demokratischer und internationaler Gerechtigkeit – auf der Grundlage von Freiheit als Nichtbeherrschung hat daher eine natürliche ökumenische Anziehungskraft. Sie würde den Unterschieden Raum geben, die von verschiedenen Lesarten der Hintergrundtatsachen oder von unterschiedlichen Gewichtungen der konkurrierenden Erfordernisse von Freiheit herrühren. Sie würde hingegen vor politischen Meinungsverschiedenheiten bewahren, die sich so unverhandelbar erweisen wie Unterschiede des Geschmacks oder der Intuitionen.
Es gibt natürlich viele Interpretationen der Freiheit, doch wie Noras Beispiel veranschaulicht, ist die Verknüpfung von Freiheit mit Nichtbeherrschung und nicht bloß mit Nichteinmischung intuitiv sehr anziehend. Zudem kann diese Auslegung von Freiheit auf ein altes Erbe verweisen. Wie ich bereits andeutete, geht das Ideal auf die Römische Republik zurück und, wie wir noch sehen werden, blieb es die vorherrschende Vision von Freiheit bis in eine Zeit, als diese in der republikanischen Revolution Amerikas und Frankreichs das mobilisierende Thema wurde. Das Ideal von Freiheit als Nichtbeherrschung bietet einen geprüften und soliden Boden, auf den man bauen kann, auch wenn dieser Boden im heutigen Denken vernachlässigt wird – und einen Boden, den wir als Basis für die Weiterentwicklung unserer heutigen Argumentation festigen müssen.
John Keats schrieb mit einiger künstlerischer Freiheit, die Summe allen erworbenen Wissens – all dessen, was wir wissen und was wir wissen müssen – sei in der Zeile »Schönheit ist Wahrheit, Wahrheit [ist] Schönheit« enthalten. Der Refrain, den ich in diesem Buch anklingen lassen will, um es mit einer etwas peinlichen Entsprechung auszudrücken, lautet »Gerechtigkeit ist Freiheit, Freiheit [ist] Gerechtigkeit«. Dieser Slogan fängt die Idee ein, dass wir angesichts der vielfältigen und komplizierten Herausforderungen der Gerechtigkeit in sozialen, demokratischen und internationalen Zusammenhängen nicht resignieren müssen. Das Ideal der Freiheit als Nichtbeherrschung kann einen klaren und attraktiven Weg abstecken. Es kann einen moralischen Kompass bereithalten, mit dem wir in einer Welt, deren Komplexität uns an den Rand völliger Verwirrung bringt, die Richtung beibehalten können.
Ein moralischer Kompass
Dieser Kompass, das sollte ich betonen, ist ein moralischer Kompass. Er ist nicht dazu gedacht, ganz bestimmte Ratschläge für die Institutionen zu erteilen, die in unseren unterschiedlichen sozialen und demokratischen Gesellschaften und unserer gemeinsamen internationalen Welt eine Rolle spielen. Jede empirische Orientierung, die er hinsichtlich des Charakters solcher Institutionen bietet, ist nur ein nachrangiger, beiläufiger Nutzen. In erster Linie will er ein Mittel zur Verfügung stellen, mit dem man das Nachdenken über das Richtige und das Falsche an diesen Institutionen und über das Richtige und Falsche an den Initiativen, die sie den politischen Autoritäten ermöglichen, steuern kann.
Wenn Sie ähnlich denken wie ich, werden Sie oft davon abgestoßen sein, wie sich die Dinge in der politischen Welt entwickeln, werden aber unsicher sein, wie die Situation am besten zu kritisieren ist, oder falls Sie an der Regierung beteiligt sein sollten, wie die Politik am besten zu ändern ist. Vielleicht schimpfen Sie darüber, wie groß der Einfluss der Interessenvertretung von Vermögenden auf die Regierung ist, oder darüber, wie die Regierungen illegale Einwanderer behandeln, oder über die Einmischung der Regierung auf dem einen oder anderen Wirtschaftsgebiet. Trotzdem fragen Sie sich möglicherweise, mit welchen Gründen das Vorgehen des Staates auf diesen Gebieten am besten zu kritisieren ist, oder sogar, ob es überhaupt kritisiert werden sollte. Wenn dieses Buch seinen Zweck erfüllt, dann sollte es helfen, diese Art von Ungewissheit zu beseitigen. Es vertritt die Ansicht, dass das Ideal der Freiheit in einem jeden derartigen Fall den nötigen Maßstab liefert. Man muss lediglich fragen, ob sich die Dinge günstiger regeln lassen, um Freiheit als Nichtbeherrschung unter den betreffenden Beteiligten besser zu fördern.
Ich erwarte selbstverständlich nicht, dass sofort klar sein wird, was der Maßstab der Freiheit verlangt. Aus diesem Grund habe ich ein Buch geschrieben und keinen Artikel. Das Buch ist zunächst einmal dazu gedacht, die Erfordernisse von Freiheit als Nichtbeherrschung Punkt für Punkt zu erläutern, und zweitens, die sozialen, demokratischen und internationalen Institutionen zu skizzieren, für die sie sprechen würden, und zwar mit Blick darauf, inwieweit diese Institutionen nachvollziehbar als gerecht gelten. Ich beginne in Teil 1 mit der langen Geschichte der Freiheit, die den Zusammenhang mit Nichtbeherrschung betont, und gehe dann dazu über, eine allgemeine Sicht der Erfordernisse von Freiheit auszuarbeiten, die diesen Zusammenhang wahrt. In Teil 2 wende ich mich konkreteren Themen zu und argumentiere, dass die Erfüllung jener Erfordernisse unter plausiblen empirischen Annahmen wahrscheinlich klare und ansprechende Vorstellungen davon stützen wird, was für soziale Gerechtigkeit, politische Gerechtigkeit und internationale Gerechtigkeit nötig ist.
Anstatt in dieser Untersuchung umständlich von sozialer, politischer und internationaler Gerechtigkeit zu sprechen, werde ich als Erstes ganz einfach vom Wert der Gerechtigkeit sprechen, als Zweites von Demokratie und drittens von Souveränität, das heißt von der Souveränität der Völker. Gerechtigkeit im engeren Sinne – das heißt soziale Gerechtigkeit – ist der Vorzug eines nationalen oder innerstaatlichen Rahmens, in welchem die Beziehungen der Menschen untereinander einer gerechten sozialen Ordnung unterworfen sind: einer Ordnung, die den Menschen intuitiv betrachtet die Ressourcen und Sicherheiten von gleichermaßen freien Bürgern gibt. Demokratie ist der Vorzug eines nationalen Rahmens, in dem das Verhältnis der Menschen zum Staat, der diese soziale Ordnung erzwingt, einer gerechten politischen Ordnung unterliegt: einer Ordnung, welche die Menschen intuitiv betrachtet gleichmäßig an der Kontrolle des Staates teilhaben lässt und als die Herren über den Staat gleiche Freiheit genießen lässt. Souveränität schließlich ist der Vorzug eines internationalen Rahmens, in dem die Beziehungen verschiedener Völker untereinander einer gerechten globalen Ordnung unterworfen sind: einer Ordnung, die es intuitiv betrachtet jeder Gesellschaft erlaubt, sich als Souverän und freie Gemeinschaft wirksam selbst zu verwalten.
Eine paar Slogans fassen meine Thesen zu diesen Verbindungen zwischen der Freiheit und den spezielleren Werten der Gerechtigkeit, Demokratie und Souveränität zusammen. Lasst die Menschen Freiheit als Nichtbeherrschung in ihren Beziehungen untereinander genießen, und sie werden eine echte Form von Gerechtigkeit erfahren. Lasst die Menschen Freiheit als Nichtbeherrschung in ihrem Verhältnis zum Staat genießen, und sie werden sich einer anspruchsvollen Vielfalt von Demokratie erfreuen. Lasst die verschiedenen Völker der Welt Freiheit als Nichtbeherrschung in ihren Beziehungen untereinander und in den Beziehungen zu anderen multinationalen und internationalen Körperschaften genießen, und sie werden sich einer wirklichen Form von Souveränität erfreuen.
Einige Leser werden mehr an den Politikempfehlungen auf diesen drei Gebieten interessiert sein als an den geschichtlichen und philosophischen Wurzeln des Ideals der Freiheit, das zur Verteidigung der Vorschläge verwendet wird. Mit Hilfe der in diesem Prolog angeführten Themen und des Überblicks zum Buch, den der Anhang enthält, sollte es für solche Leser möglich sein, unmittelbar zur Strategiediskussion in Teil 2 des Buchs überzugehen. Diese Herangehensweise würde beinhalten, dass man die Implikationen des Ideals von Freiheit als Nichtbeherrschung untersucht, ohne zuerst auf die Argumentation zur Stützung des Ideals einzugehen, die in Teil 1 vorgestellt wird.
Tests für Gerechtigkeit, Demokratie und Souveränität
Freiheit als Nichtbeherrschung muss Schritt für Schritt verwirklicht werden. Sie kann in jedem Kontext mehr oder weniger gut vor den entsprechenden Individuen oder Organisationen geschützt sein. Und sie kann über einen breiteren oder schmaleren Bereich von Wahlmöglichkeiten geschützt sein. Über welches Niveau von Freiheit müssen Menschen also verfügen können, damit man sagen kann, sie haben Zugang zu Gerechtigkeit, Demokratie und Souveränität? Um diese Frage beantworten zu können, berufe ich mich auf drei benutzerfreundliche Tests. Die drei Tests bestehen in dem Blickwechsel-Test, dem Pech-gehabt-Test und dem Offene-Rede-Test.
Der Blickwechsel-Test verlangt, dass Menschen so bemittelt und in den Grundentscheidungen des Lebens – kurz den Grundfreiheiten – so geschützt sein sollten, dass sie anderen ohne Grund zur Angst oder Ergebenheit der Art, wie sie eine zur Einmischung fähige Macht hervorrufen könnte, in die Augen schauen können. Wer soziale, medizinische und Rechtssicherheit genießt und von einer angemessenen Rechts- und Wirtschaftsordnung profitiert, hängt zu seiner Sicherheit nicht von der Nachsicht und Herablassung anderer ab. Ein solcher Mensch kann den aufrechten Gang gehen und im Status mit den Mächtigsten im Land gleichziehen. Zumindest ist diese Haltung möglich, vorausgesetzt man gilt nicht nach lokalen Kriterien als übertrieben ängstlich oder paranoid.
Der Pech-gehabt-Test verlangt, dass die Regierung ihr Volk auf der Grundlage einer gleichmäßig geteilten Kontrolle unterstützen und schützen sollte, so dass Sie dann, wenn eine kollektive Entscheidung zu Ihren Ungunsten ausfällt, Grund haben anzunehmen, dass es sich, selbst nach den anspruchsvollsten lokalen Kriterien, um Pech handelt und nicht um das Zeichen eines übelmeinenden Willens, der sich gegen Sie oder Leute wie Sie richtet. Wenn die Regierung zum Beispiel entscheidet, praktisch vor Ihrer Haustür ein Gefängnis bauen zu lassen, dann tut sie das auf der Grundlage von Verfahren und Entscheidungsgrundsätzen, die Sie gemeinsam mit anderen billigen; der Beschluss ist nicht das Ergebnis eines Bündnisses feindseliger Interessen, das sich gegen Sie oder Ihre Nachbarn richtet. Daher können Sie davon ausgehen, dass die nachteilige Entscheidung über den Gefängnisbau einfach Pech war, wenigstens dann, wenn Sie nach lokalen Kriterien nicht zu den Ängstlichen oder Paranoiden zählen. Sie können die Entscheidung als einen bedauerlichen Rückschlag ansehen, der auf die gleiche Stufe zu stellen ist wie eine neuerliche Erkrankung.
Und letztlich verlangt der Offene-Rede-Test gewisse Ressourcen und Absicherungen für die Völker der Welt, wenn sie mit anderen Staaten und anderen globalen Körperschaften zu tun haben, so dass die Beiträge ihrer Vertreter in der internationalen Debatte und Diplomatie zu Recht für bare Münze genommen werden können. Es sind Beiträge in einem öffentlichen Meinungsaustausch, in dem jeder der beteiligten Seiten mit Respekt begegnet wird. Keine Seite hat Anlass, im anmaßenden Ton eines Herrn oder im unaufrichtigen Ton eines Dieners zu sprechen. Wenn also die Vertreter eines Volks dennoch eine andere Haltung einnehmen, indem sie sich beispielsweise dem Sprecher eines anderen Staates, einer internationalen Instanz, eines multinationalen Unternehmens fügen, können sie nach zeitgenössischen Kriterien der Ängstlichkeit oder der Paranoia bezichtigt werden.
Warum lege ich bei der Formulierung dieser drei Tests so viel Wert auf lokale und zeitgenössische Kriterien? Weil es keine einleuchtenden, gattungsgültigen Kriterien dafür gibt festzustellen, wann es wirklich genug ist mit der Herstellung von Gerechtigkeit, Demokratie oder Souveränität. Ein Spaziergänger, der heute flott und sicher eine unserer Straßen entlangmarschiert, mag bei der Aussicht darauf, eine mittelalterliche Stadt durchqueren zu müssen, starr vor Schreck dastehen, was bei einem Einheimischen der Zeit jedoch keinerlei Beklemmung hervorgerufen hätte. Auch ein Arbeitsuchender, der wegen der Beschäftigungsperspektiven in einem unserer entwickelten Länder beunruhigt ist, würde angesichts der ungesicherten Beschäftigung, die selbst in den freiesten Städten im Europa oder Amerika des 18. Jahrhunderts üblich war, völlig schockiert sein. Es wäre albern, Tests auf Gerechtigkeit, Demokratie oder Souveränität zu entwerfen, die für solche ausgeprägten kulturellen Unterschiede unempfänglich wären.
Die Argumentation, die zur Stützung der Ideale vorgebracht wird, die mit meinen drei Tests verbunden sind, bleibt unweigerlich skizzenhaft und dieses Buch sollte weder als eine theoretische Abhandlung noch als ein praktisches Manifest aufgefasst werden. Meine Hoffnung ist, andere auf eine Denkweise über Politik aufmerksam machen zu können, die mit einem bescheidenen Ausgangspunkt beginnt, indem sie allein bei den Erfordernissen der Freiheit ansetzt, und die hinsichtlich der Grundsätze und Strategien, die sie zur Organisation unseres Zusammenlebens befürwortet, gleichwohl substanziell ist. Die Kapitel zu Gerechtigkeit, Demokratie und Souveränität enden alle mit einem Fazit, in dem ich versucht habe, den substanziellen Charakter der Empfehlungen deutlich zu machen, die sich durch die Diskussion stützen lassen. Es ist jedes Mal ein Versuch, den Ansatz mit Alternativen zu vergleichen und die Sorte von Verpflichtungen zu veranschaulichen, die er fordern würde.
Viele der Leser, die vom ersten Teil des Buchs weitgehend überzeugt sind und die Forderungen von Freiheit als Nichtbeherrschung anerkennen, werden mit einigen Empfehlungen zu Gerechtigkeit, Demokratie und Souveränität nicht einverstanden sein. Das ist zu erwarten. Denn diese Empfehlungen hängen nicht bloß von philosophischen Überlegungen zur Geschichte, Bedeutung und Relevanz von Freiheit ab, sondern auch von der Natur empirischer Annahmen, die zur institutionellen Realisierbarkeit gemacht werden, und selbstverständlich von der Qualität der Vorstellungskraft, die beim Bedenken institutioneller Entwürfe zum Tragen kommt. Dieser Ansatz ist keine Blaupause dafür, die Welt ins Lot zu bringen, sondern ein Forschungsprogramm, um die normative Theorie der Gerechtigkeit zu entwickeln und die Erfordernisse der Gerechtigkeit in unseren sozialen, demokratischen und internationalen Institutionen auszuarbeiten. Das vorliegende Buch ist eine Einladung, sich diesem Programm anzuschließen, keine Darstellung einer bereits gefestigten Lehre oder Ideologie.
Teil 1Die Idee der Freiheit
Kapitel 1Vergangenheit und Gegenwart der Freiheit
Wann ist man frei?
Eine gängige Metapher suggeriert, dass man dann frei ist, wenn man bei seinen Entscheidungen freie Hand hat. Wenn man all die Spielräume oder Bewegungsfreiheit besitzt, die man sich nur wünschen kann, wenn man einen Freibrief hat, selbst zu bestimmen, wie man handeln will, dann genießt man nach dieser Vorstellung Freiheit im höchsten Maße. »Freie Hand lassen« oder im Englischen die Wendung »giving free rein« stammt vom Reiten her. Wenn ein Reiter die Zügel schießen lässt, kann das Pferd frei laufen: es kann in eine beliebige Richtung gehen. Wenn einem freier Lauf gegeben wird, so suggeriert die Metapher, kann man jeden Weg einschlagen, den man sich aussucht: Man untersteht niemandes wirksamer Kontrolle.
Ein wenig Überlegung legt allerdings nahe, dass »die Zügel schießen lassen« vielleicht das Beste verkennt, was wir von der Freiheit erwarten können, und zwar sowohl für das Pferd als auch für den Menschen. Wenn ich einem Pferd die Zügel freigebe, benutze ich sie nicht dazu, es zu lenken, und ich lasse die Zügel auch nicht deshalb locker, weil das Pferd zufällig in eine Richtung geht, die mir gefällt. Ich lasse das Pferd gehen, wie es will, weil ich keine Präferenz habe, was die Richtung angeht.2 Während ich dem Pferd seinen Willen lasse, indem ich die Zügel schießen lasse, bleibe ich weiter im Sattel, bin bereit, jederzeit die Zügel anzuziehen, sollten sich meine Wünsche ändern. Ich übe zwar keine wirksame Kontrolle über das Pferd aus, aber ich habe die Möglichkeit dazu oder einen Kontrollvorbehalt. Und was für den buchstäblichen Fall gilt, gilt auch für den metaphorischen Fall. Wenn ich jemandem freie Hand lasse, sehe ich wohl davon ab, wirksame Kontrolle auszuüben, aber das Äquivalent zur Kontrolle ist mir weiter vorbehalten. Ich nehme das Pferd nicht an den Zügel, nichtsdestoweniger bleibe ich im Sattel.
Denken wir an den Fall, den wir im Prolog erörtert haben. In Ein Puppenheim wird Nora genau so viel freie Hand gegeben, wie nötig ist, damit sie keiner wirksamen Kontrolle von Seiten Torvalds unterliegt. Nora ist aber nicht in dem Sinne einer Nichtbeherrschung frei, da sie weiter dem Kontrollvorbehalt ihres Ehemanns unterliegt. Sollte es bei Torvald zu einem Sinneswandel kommen oder sollte Nora plötzlich auf eine Weise handeln, die ihm missfällt, dann wird er die Zügel anziehen und ihr seinen Willen aufzwingen.
Wir müssen aber nicht erst ins Theater gehen, um Beispiele für einen solchen Kontrollvorbehalt oder Machtvorbehalt zu finden. Die Obdachlosen, die von der Wohlfahrt abhängen, um ein Bett für die Nacht zu finden, die schwer Erkrankten, die auf die medizinische Behandlung durch die unentgeltlichen Hilfsdienste von Ärzten oder Krankenhäusern angewiesen sind, die Angestellten, deren Weiterbeschäftigung von den Launen ihres Arbeitgebers abhängig ist: all diese Menschen sind in einer Lage, die der von Nora gleicht. Weil sie Glück haben, genießen sie ein Obdach, Arbeit und Auskommen – und sind sogar noch in der Lage, die Grundfreiheiten zu nutzen, die solche Güter voraussetzen –, aber dies verschafft ihnen keine Freiheit als Nichtbeherrschung. Ihnen ist lediglich freie Hand gegeben.
Es ist bezeichnend, dass »free rein«, die Gewährung freier Hand, als Metapher für Freiheit erst im 19. Jahrhundert aufkam und nicht früher. Bis dahin betonte das herrschende Denken über Freiheit, dass man nicht nur der wirksamen Kontrolle anderer entzogen sein müsse, um in jedem Bereich der Wahl frei zu sein, sondern dass auch deren Kontrollvorbehalt nicht bestehen dürfe. In dieser früheren Denkweise war das freie Pferd ein nicht aufgezäumtes Pferd, und nicht etwa eines, dem gerade die Zügel freigegeben waren. Der republikanische Gegner der Monarchie Richard Rumbold muss das im Sinn gehabt haben, als er 1685 in Edinburgh auf dem Schafott stand und auf seine Hinrichtung durch Erhängen wegen Verrats an der Krone wartete. Er erneuerte sein treues Festhalten an der Republik und erklärte: »Ich habe niemals daran geglaubt, dass uns die Vorsehung ein paar Männer in die Welt geschickt hat, die fertig gestiefelt und gespornt zum Reiten antreten, und Millionen fertig gesattelt und gezäumt sind, um geritten zu werden.«
In der älteren Denkweise, auf die sich Rumbold beruft, muss für Freiheit in einer Reihe von Wahlentscheidungen jedwede Form von Kontrolle durch andere ausgeschaltet werden. Die auszuschaltende Kontrolle kann die wirksame Form von Kontrolle sein, in der uns andere gern Beschränkungen auferlegen, sobald dies zur Befriedigung ihrer Wünsche notwendig werden sollte. Es kann sich bei der auszuschaltenden Kontrolle aber auch um die Form des Kontrollvorbehalts handeln, die in der Macht besteht, eine solche wirksame Rolle einnehmen zu können. Wenn ich jemandes Ermessen bei der Wahl einer Option begrenzen kann oder ihm meine Bedingungen vorschreiben kann, wie die Wahl zu treffen ist, habe ich ein gewisses Maß an Kontrollvorbehalt über das, was er tut. Seine Fähigkeit, diese oder jene Option zu wählen, wird vom Stand meines Willens abhängen, ob er so wählen sollte, wie er es wünscht. Wenn ich möchte, dass jemandem sein Ermessen erhalten bleibt, wird er wählen, wie er selbst es will; möchte ich dies nicht mehr, wird er es nicht. In beiden Fällen bleibt er jedoch meinem Willen unterworfen und in diesem Sinne unfrei. Ich bleibe die ganze Zeit im Sattel.
Nach dieser Denkweise kann man nur in dem Grade als freie Person oder freier Bürger gelten, in dem man bei einer Reihe von Wahlentscheidungen, die schon zu Rumbolds Zeit als die fundamentalen oder Grundfreiheiten bekannt waren, sein eigener Herr ist – sui juris, wie es im römischen Recht heißt (Lilburne 1646). Diese Wahlentscheidungen, die im Prinzip jedem Bürger zustanden, schlossen im allgemeinen Verständnis die Entscheidung darüber ein, welche Religion man praktiziert, für was man sich einsetzen will, welchen Vereinigungen man angehören will, wo man wohnen will, wie man seinen Lebensunterhalt bestreiten will und so fort. Dazu werden wir im dritten Kapitel noch einiges zu sagen haben.
Wenn man sich wie Rumbold Freiheit im traditionellen Sinne zu eigen macht und jede Kontrolle von Seiten anderer ablehnt, strebt man die Stellung einer unabhängigen Person an, die keinen Herrn oder dominus in ihrem Leben kennt. Freiheit besteht aus dieser Sicht darin, Wahlentscheidungen treffen zu können, ohne die Erlaubnis eines anderen einholen zu müssen. Diese Art, Freiheit zu artikulieren, lässt sich mindestens bis zu den Römern zurückverfolgen, die mit der Institution vertraut waren, durch die ein Herr oder dominus Macht über seine Sklaven hatte. Sie argumentierten, in potestate domini zu leben, unter der Macht eines Herrn zu leben, reiche an sich schon aus, um eine Person unfrei zu machen. Einen freundlichen Herrn zu haben mochte in anderen Hinsichten ein Segen sein, gab einem aber nicht die Freiheit.
Im Unterschied zum Sklaven ein liber zu sein – ein freier Mann oder »a freeman«, wie die maßgebliche englische Übersetzung lautete – hieß, im Bereich der Grundfreiheiten sicher zu sein vor der Macht irgendeines Herrn. Man war in dieser Sphäre beim Handeln nach eigenem Ermessen vor der dominatio oder Beherrschung durch andere geschützt. Die Sache, die einem solche Sicherheit verlieh – die Sache, die einem Freiheit als Nichtbeherrschung verschaffte –, war der Status eines civis oder Bürgers, der hinreichend und gleichmäßig durch das Recht geschützt war. Und insbesondere das Innehaben des Status eines Bürgers, der von einem Recht geschützt wird, dessen Kontrolle der Bürgerschaft selbst obliegt und kein Recht ist, das von einem übermächtigen Herrn wie einem König oder einer Aristokratie angeordnet wird. Nach dieser römischen Denkweise ist »vollständige libertas deckungsgleich mit civitas«, wie sich ein Autor ausdrückt (Wirszubski 1968, S. 3); frei sein und ein Bürger sein, sind im Wesentlichen gleichbedeutend.
Wie sollten wir eine politische Philosophie nennen, die sich auf dieses Ideal von Freiheit als Nichtbeherrschung gründet? Weil sie ihre Ursprünge im republikanischen Rom hat und weil sie stets mit der Ablehnung der Monarchie – oder zumindest einer nicht konstitutionell verfassten Monarchie – verbunden blieb, ist der passendste Ausdruck wahrscheinlich »Republikanismus« oder vielleicht »bürgerlicher Republikanismus« (Honohan 2002). Ein Republikanismus in diesem Sinne läuft allerdings auf weit mehr hinaus als bloß auf eine Ablehnung der Monarchie. Und trotz seines Einflusses bei der Gründung der Vereinigten Staaten unterscheidet er sich deutlich von der politischen Partei, die in den USA den Namen »republikanisch« für sich beansprucht.3
Der hier umrissene Republikanismus ist zwangsläufig eine Philosophie, die heutigen Anliegen anspricht, und er gibt die Beiträge einer ganzen Reihe zeitgenössischer Autoren wieder.4 Doch da er versucht, auf einer Idee aufzubauen, die eine lange Geschichte hat, hat er unweigerlich Verbindungen zum republikanischen Denken der Vergangenheit. An verschiedenen Stellen des Buchs werde ich auf die früheren republikanischen Autoren verweisen, und in diesem Kapitel liefere ich zunächst eine kurze Skizze der Entwicklung und des schließlichen Verschwindens dieser Tradition.5 In den nächsten zwei Kapiteln werde ich die Geschichte in den Hintergrund rücken und näher betrachten, wie sich die reiche republikanische Konzeption von Freiheit zu einem Ideal für die Gegenwart verarbeiten lässt.
Wer seine Philosophie lieber prägnant vor sich hat, losgelöst von historischen Vorläufern, möchte vielleicht direkt zu diesen Kapiteln springen und kann sich dabei auf den Überblick zur Argumentation im Anhang stützen, der einen Eindruck davon vermittelt, was man verpasst hat. Meiner Ansicht nach bietet die Geschichte einen lebendigen Zusammenhang für das Verständnis philosophischer Argumentation und hilft zu zeigen, dass der in diesem Buch entwickelte Gesichtspunkt nicht irgendeine neumodische Denkweise ist, sondern voll und ganz in einer wohlbekannten, gut geprüften Tradition steht.
Die Römische Republik
Es war ein Grieche, der viele Jahre in Rom verbrachte, zunächst als Geisel, dann als Besucher aus freien Stücken, der eine erste skizzenhafte Beschreibung dessen lieferte, was die Römer dereinst für ihre unverwechselbare Staatsphilosophie halten sollten. In der Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. schrieb Polybius eine ausführliche Geschichte Roms, die besonders hervorhob, was er als die Herrlichkeit der Römischen Republik ansah und die Vorteile, die sie ihren Bürgern brachte: gemeint waren damit im Grunde genommen alle dauerhaft ansässigen, männlichen Einwohner der Stadt, die nicht als jemandes Sklave gehalten wurden. Nach dieser Darstellung gab Rom seinen Bürgern Freiheit im Verhältnis zur Macht oder zum dominium privater Herren, insofern das Recht jedem einzelnen Bürger gleichen und hinreichenden Schutz gewährte. Und Rom gab den Bürgern Freiheit im Verhältnis zum Recht selbst – zur Staatsgewalt oder dem imperium am Ursprung des Rechts –, insofern es dafür sorgte, dass das Recht die von der Bürgerschaft geteilten Wünsche abbildete.
Da Roms republikanische Tradition auf einen gleichen Rechtsstatus für freie Bürger Wert legte, durften keinem Bürger gesetzlich größere Rechte eingeräumt werden als den anderen. Anders gesagt, sie war bestrebt, die Menschen in ihren horizontalen Beziehungen untereinander zu schützen.
Aber dieser gleiche Rechtsstatus verlangte außerdem eine Gleichstellung bei der Ausübung von Kontrolle über das Recht. Daher sollte es keinen Monarchen oder keine Elite geben, die das Recht auf ihren besonderen Willen oder Geschmack zuschneiden konnte. Eine solche Gleichheit würde die Menschen in ihren vertikalen Beziehungen zum Staat oder zur Regierung, die den Staat führt, schützen, weil sie sicherstellt, dass bei der Gestaltung des Rechts alle die gleiche Kontrolle ausüben können. Eine Republik ist, so wie sie konzeptualisiert wurde, nicht mehr und nicht weniger als eine Gemeinschaft, die ihre Organisation an diesen Ideen der Gleichheit vor dem Gesetz und über dem Gesetz ausrichtet.
Polybius äußerte sich besonders überschwänglich zur Kontrolle über die Ausgestaltung des Rechts, welche die römische Verfassung für die Bürgerschaft vorsah. Die Macht, römisches Recht zu gestalten, zu erlassen und zu vollziehen, lag in den Händen sich wechselseitig kontrollierender Gremien und Amtsträger, die das Volk repräsentierten. Diese Macht schlug sich in einer Regelung nieder, die Polybius eine gemischte Verfassung nannte. Die Regelung war insofern konstitutionell, als öffentliches, unparteiliches Recht über sie bestimmte; und sie war gemischt, insofern sie allen Segmenten der Gesellschaft Macht verlieh.
Gesetze wurden in Rom von Regierungsgremien gemacht, an denen alle Bürger teilnehmen konnten, wobei Vorschläge von Amtsträgern zugrunde lagen. Die Amtsinhaber, die solche Gesetze einbrachten, waren zwar Mitglieder einer Senatselite, mussten jedoch vom Volk in ihr Amt gewählt werden und waren einer Vielzahl von Überprüfungen unterworfen. Sie wurden normalerweise für gerade einmal ein Jahr ernannt. Auf jeder Ebene der Hierarchie wurden stets zwei oder mehr Amtsträger gewählt – an der Spitze der Regierung zum Beispiel zwei Konsuln. Bei allen Erlassen oder politischen Vorhaben konnte immer einer von zehn Tribunen sein Veto einlegen. Tribunen wiederum wurden gewählt, um die Interessen der Plebejer zu vertreten, die im Allgemeinen die ärmeren Klassen der Bürgerschaft waren.
Es erübrigt sich zu bemerken, dass das republikanische Rom dem Ideal einer Republik, in der die Bürger vor horizontaler oder privater Beherrschung und staatlicher oder vertikaler Beherrschung geschützt wären, nie gerecht wurde. Unterschiedlich gro