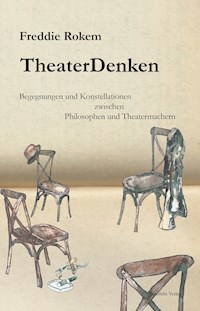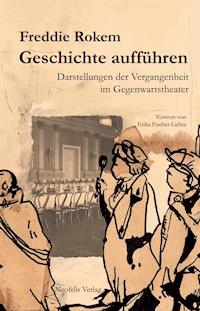
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neofelis
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Geschichte aufführen setzt sich Freddie Rokem sowohl aus theatertheoretischer Perspektive als auch in genauen Analysen mit dem Verhältnis von Theater und Vergangenheit auseinander. Er untersucht exemplarisch anhand ausgewählter israelischer, amerikanischer und europäischer Inszenierungen, wie Aspekte der Shoah und der Französischen Revolution, zweier für die Moderne prägender Ereignisse, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeführt wurden. Anhand dreier israelischer Inszenierungen – Joshua Sobols Ghetto, Arbeit macht frei vom Toitland Europa des Akko Theatre Centre und Hanoch Levins Der Junge träumt – befragt er die Möglichkeiten und Grenzen der Auseinandersetzung mit der Shoah im Theater. Die Französische Revolution gerät Rokem zum historischen Bezugspunkt für die Erzeugung gegenwärtiger sozialer und theatraler Energien in Peter Brooks Marat/Sade-Inzenierung, Ariane Mnouchkines 1789 und Ingmar Bergmans Madame de Sade-Inszenierung, ebenso wie in drei amerikanischen Inszenierungen von Georg Büchners Dantons Tod durch Orson Welles, Herbert Blau und Robert Wilson.
Aus den Analysen einzelner Inszenierungen entwickelt Rokem eine Aufmerksamkeit für die Figur des Zeugen, die Bedeutung historischer Zeugenschaft. Auf der Bühne werden ihm die Schauspieler*innen zu Zeugen des oft nur fragmentarisch, vermittelt und gebrochen bezeugbaren historischen Geschehens, dessen fortdauernde soziale Energien sie im Raum des Theaters gestalten. Er geht der Frage nach, wie sich Bilder der Shoah und der Französischen Revolution im theatralen Raum verändern, wie sich auf der Bühne Historisches mit der Gegenwart verknüpft. Die Theaterbühne zeigt sich als wichtiger Verhandlungsraum gesellschaftlicher Debatten über die Vergangenheit, wobei Rokem Geschichte als einen wesentlichen Fluchtpunkt für die Konstruktion kollektiver Identitäten betrachtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Freddie Rokem
Geschichte aufführen
Darstellungen der Vergangenheit im Gegenwartstheater
Freddie Rokem
Geschichte aufführen
Darstellungen der Vergangenheit im Gegenwartstheater
Vorwort von Erika Fischer-Lichte
Aus dem Englischen von Matthias Naumann
Neofelis Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die Originalausgabe Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre erschien 2000 bei University of Iowa Press
© 2000 University of Iowa Press, www.uiowapress.org
Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von University of Iowa Press
Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Matthias Naumann
© 2012 Neofelis Verlag UG (haftungsbeschränkt), Berlin
www.neofelis-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Marija Skara
E-Book-Format: epub, Version 2.0
ISBN: 978-3-943414-25-7
Für Naama & Ariel
und im Andenken an Amitai
Inhalt
VorwortvonErika Fischer-Lichte
Vorbemerkung – Geschichte(n) zitieren…
Einleitung – Begriffsaspekte des Aufführens von Geschichte
Dichtung und Geschichte
Zeitperspektiven
Refraktionen der Shoah auf israelischen Bühnen – Theater und Überleben
Die Theaterformen israelischer Shoah-Aufführungen
Joshua Sobol: Ghetto
Dudu Ma‘ayan: Arbeit macht frei vom Toitland Europa
Hanoch Levin: Der Junge träumt
Drei europäische Theaterarbeiten über die Französische Revolution
Peter Brook: Marat/Sade
Ariane Mnouchkine: 1789
Ingmar Bergman: Madame de Sade
Drei amerikanische Inszenierungen von Dantons Tod
Büchners Theaterstück und seine Betrachter
Die Beschaffenheit der Inszenierungen
Die individualisierte Menge
Die Hinrichtung
Theatrale Energien
Energien des Textes
Von den Energien des Textes zu denen der Aufführung
Energien der Aufführung
Der Lauscher und der Überlebende-Zeuge
Metaphysische Energien
Epilog – „Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin…“
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Weitere Titel im Neofelis Verlag
Vorwort
Erika Fischer-Lichte
Am 8. Mai 1995 jährte sich zum fünfzigsten Male der Tag, an dem der zweite Weltkrieg zu Ende ging. In allen vom Krieg betroffenen Ländern wurde dieser Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft feierlich begangen und ihrer Opfer gedacht. Für die Kulturwissenschaften, ganz besonders im wiedervereinigten Deutschland, stellte dieses Datum eine Herausforderung ebenso wie einen Anstoß dafür dar, erneut vertieft über den Umgang mit Geschichte und Geschichtlichkeit, mit individuellem und kollektivem Erinnern nachzudenken. Die an der Werner Reimers-Stiftung Bad Homburg 1990 gegründete Arbeitsgruppe „Theaterhistoriographie“ brachte gerade ihren ersten Band zum Theater der historischen Avantgardebewegungen heraus. Sie begriff den Gedenktag als die Aufforderung, mit dem nächsten Band nicht in der Geschichte zurückzugehen, sondern sich mit dem Theater nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem mit dem Theater seit den sechziger Jahren auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Frage nach neuen Zugängen, welche Theater zu Geschichte und Geschichtlichkeit zu eröffnen vermag. Dabei gingen wir von der Beobachtung aus, dass die lange Zeit als Leitmetapher fungierende Vorstellung von „Kultur als Text“ seit den ausgehenden fünfziger und insbesondere den sechziger Jahren zunehmend radikaler von der Leitmetapher „Kultur als Performance“ abgelöst wurde, welche die Prozesshaftigkeit von Kultur betont. Für das Theater bedeutet dies, dass eine Aufführung in erster Linie als ein Ereignis zu begreifen ist, das aus der leiblichen Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern hier und jetzt hervorgeht, und weniger als die „Realisierung“ oder „Umsetzung“ eines literarischen Textes. Sofern ein Text Verwendung findet, gilt er als Material und nicht als Kontrollinstanz des theatralen Prozesses.
Damit stellte sich die Frage nach den Konsequenzen, die sich für den Umgang des Theaters mit Geschichte ergeben, wenn der Schwerpunkt theatraler Inszenierung und Darstellung sich von der referentiellen, semiotischen zur performativen Funktion verlagert. Denn im Unterschied zu manchen Theoretikern der Postmoderne gingen wir nicht davon aus, dass eine Dominanz der performativen Funktion zum Verschwinden von Geschichte führen muss. Wir fragten vielmehr danach, welche neuen Modi des Erinnerns – und damit von Geschichtlichkeit – sie ermöglicht und generiert.
Wie bereits bei Erarbeitung und Diskussion des ersten Bandes gehörte Freddie Rokem auch bei der Vorbereitung des zweiten Bandes zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Sein Beitrag: „‚Performing history‘: Theater und Geschichte. Die Französische Revolution im Theater nach dem zweiten Weltkrieg“ stellt eine erste Version des zweiten Kapitels seines Buches Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre dar, das im Jahre 2000 in der von Thomas Postlewait herausgegebenen Reihe Studies in Theatre History & Culture erschien. Dies Buch, das in der Tat als ein Meilenstein im Hinblick auf die Problematik des Verhältnisses von Theater und Geschichte seit den 1960er Jahren gelten kann, liegt nun endlich in einer deutschen Übersetzung vor. Der deutsche Titel Geschichte aufführen weist zwar in seiner Semantik eine erhebliche Schnittmenge mit derjenigen des englischen Titels „Performing History“ auf. Gleichwohl kommen beide nicht vollständig zur Deckung. Denn „to perform“ bedeutet nicht nur „aufführen“, sondern auch „ausführen“. Der englische Originaltitel suggeriert entsprechend, dass die im Buch besprochenen Inszenierungen nicht nur die historischen Ereignisse, auf die sie sich beziehen, zur Darstellung bringen bzw. aufführen, sondern sie zugleich wieder „ausführen“, sie in gewisser Weise wiederholen und damit zugleich selbst als spezifische historische Ereignisse in Erscheinung treten. Diese Vieldeutigkeit von „performing history“ sollten die Leser/innen im Blick behalten, wenn sie Geschichte aufführen lesen.
Rokems Buch entwickelt in der Tat nicht nur plausible, sondern höchst überzeugende Lösungen für die Probleme, die sich uns seinerzeit stellten. Dabei treten zwei Fragen in den Vordergrund. Die erste betrifft das Paradox, das in der Formulierung „performing history“ gegeben ist. Denn wie kann das, was ‚dort‘ und ‚damals‘ geschah, im „Hier“ und „Jetzt“ der Theateraufführung in Erscheinung treten? Die zweite Frage geht von den destruktiven Energien aus, die das dargestellte historische Ereignis freisetzte. Sie richtet sich auf die Möglichkeit, erneuernde Energien zu schaffen, mit denen das unwiederbringlich Verlorene zumindest imaginativ und vielleicht sogar intellektuell und emotional wiederhergestellt werden kann.
Diese beiden Fragen figurieren als Leitfragen für die drei ersten Kapitel des Buches. Das erste ist drei israelischen Inszenierungen gewidmet, die sich auf die Shoah beziehen: Inszenierungen von Joshua Sobols Ghetto zwischen 1984 (Stadttheater Haifa, Regie: Gedalia Besser) und 1998 (im selben Theater durch den Autor); die Inszenierung des Theaterzentrums Akko Arbeit macht frei vom Toitland Europa unter der Leitung von Dudu Ma’ayan (1991, wieder aufgeführt bis 1996) und Hanoch Levins Der Junge träumt (1993 im Habima Nationaltheater in der Regie des Autors). Diese Inszenierungen wurden gewählt, weil sich an ihnen ablesen lässt, wie sich seit den 1980er Jahren in Israel Theaterformen entwickelt haben, in denen das Moment der Zeugenschaft sich allmählich mit Zügen des dokumentarischen Theaters auf der einen und eines phantastischen (im Sinne Todorovs) auf der anderen Seit verbindet. Der dadurch eingeführte selbstreflexive Modus ermöglicht neue Formen eines Metatheaters.
Das zweite Kapitel behandelt drei europäische Inszenierungen über die Französische Revolution: Peter Brooks Inszenierung von Peter Weiss’ Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade (London 1964); Ariane Mnouchkines 1789 (Paris 1970) und Ingmar Bergmans Inszenierung von Yukio Mishimas Madame de Sade (Stockholm 1989). Im Zentrum der Analyse steht zum einen das Problem der zeitlichen Differenz und zum anderen das Verhältnis von revolutionären und theatralen Energien.
Das dritte Kapitel setzt sich mit drei US-amerikanischen Inszenierungen von Georg Büchners Drama Dantons Tod auseinander: mit den Inszenierungen von Orson Welles (Mercury Theatre New York 1938), Herbert Blau (Beaumont Theatre at Lincoln Center New York 1965) und Robert Wilson (Alley Theatre in Houston 1992). Alle drei Inszenierungen waren Misserfolge – im Gegensatz zu Max Reinhardts Inszenierung des Stücks, die 1927 in den Vereinigten Staaten tourte und enthusiastisch gefeiert wurde. Die Analysen gehen der Frage nach, welche Faktoren jeweils für den Misserfolg ausschlaggebend waren.
In allen drei Kapiteln werden die Analysen und Diskussion unter Berücksichtigung der beiden Leitfragen vorgenommen. Das letzte Kapitel führt die in den drei ersten gewonnenen Resultate und Einsichten zusammen und mit Blick auf die Klärung der Leitfragen weiter. Dabei zeigt sich, dass der Gedanke eines „Aufführens von Geschichte“ / „performing history“ auf einer spezifischen Form der Wiederholung basiert, die ihrerseits wiederum in einem größeren Kontext von Aus- bzw. Aufführung (performance), von Wiederkehr und Wiederholung eingeordnet werden kann. Diese Art der Wiederholung basiert allerdings nicht auf einer mythischen Vorstellung von zyklischer Zeit, sondern ist Emergenzen in der historischen Zeit geschuldet. Diese Emergenzen werden vor allem durch die theatralen Energien freigesetzt. Auf sie ist es zurückzuführen, dass Geschichte tatsächlich in die Aufführung integriert wird und in diesem Sinn selbst zur Auf-/Ausführung kommt. Gleichzeitig lassen sich derartige Aufführungen auch als Geschichtsschreibung verstehen.
Dies ist nach Rokem möglich, weil zum einen in der Aufführung die verschiedenen, zum Teil diffusen Energien von Schauspielern und Zuschauern so aufeinander abgestimmt werden, dass sie zusammenfließen und ein neues Kollektiv zu schaffen vermögen. Zum anderen sind die Energien, welche der Schauspieler im Spiel freisetzt, als theatraler Modus zu begreifen, mit dem den heutigen Zuschauern die historischen Energien übermittelt werden – durch die Energie des Spiels werden sie für den Zuschauer spürbar heraufbeschworen. Indem der Schauspieler auf diese Weise das Ereignis darstellt, erscheint er selbst als bei diesem Ereignis gegenwärtig – als ein Hyper-Historiker, der Geschichte zugleich vollzieht und zur Aufführung bringt.
Rokems Thesen haben seit Erscheinen des Buches nichts an Aktualität eingebüßt. Vielmehr erscheinen sie mehr als zehn Jahre später in einem neuen Licht und fordern erneut zur Diskussion auf. Die Wende zum neuen Millenium wurde von vielen Theaterkünstlern als eine Herausforderung begriffen, ihrerseits neu über das Verhältnis von Theater und Geschichte nachzudenken. Ein Jahr nach Erscheinen von Performing History, am 17. Juni 2001, fand in South Yorkshire unter Leitung von Jeremy Deller die Battle of Orgreave statt, ein Reenactment des Bergarbeiterstreiks aus dem Jahre 1984. (Es wurde von Mike Figgis verfilmt und so – ebenso wie Brooks Inszenierung des Marat und Mnouchkines Inszenierung von 1789 – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.) Damit wurde auf eine theatrale Form des Aufführens von Geschichte zurückgegriffen, wie sie vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der britischen (seit 1905) und der amerikanischen (seit 1908) Pageantbewegung sowie in den Massenspektakeln der jungen Sowjetunion populär war. Ein geschichtliches Ereignis wurde hier am „Originalschauplatz“ und zum Teil mit den an dem Ereignis selbst beteiligten Personen aufgeführt – wie dies in Nikolai Evreinovs Inszenierung Die Erstürmung des Winterpalais zur Feier des Jahrestages der Oktoberrevolution am 7. November 1920 in Petrograd der Fall war. Der wichtigste Vorgänger von The Battle of Orgreave war zweifellos The Paterson Silk Strike, ein Reenactment des Streiks der Arbeiter von Seidenfabriken in Paterson, New Jersey, das am 7. Juni 1913 kurz nach dem Ereignis des Streiks stattfand, bei dem zwei Arbeiter erschossen und 1.500 Streikende und Sympathisanten festgenommen wurden.
Zwar gab es in England bereits vor der Battle of Orgreave wieder Reenactments – von mittelalterlichen Turnieren, der Schlacht von Hastings am Originalschauplatz u. a. – ebenso wie in den Vereinigten Staaten – vor allem als „Living History“ wie in Colonial Williamsburg oder Plimouth Plantation. Diese Reenactments galten bzw. gelten allerdings eher als Touristenattraktionen und Freizeitbeschäftigungen. Mit The Battle of Orgreave dagegen wurde das Reenactment als ein künstlerisches theatrales Genre wiederentdeckt, in bzw. mit dem eine Auseinandersetzung mit und eine Reflexion über ein historisches Ereignis geleistet wird. Geschichtsschreibung mit theatralen Mitteln wurde zunehmend populär.
Dies gilt auch für die Theaterhistoriographie. Aus Anlass der ersten Performance Art Biennale Performa 05, die im New Yorker Guggenheim Museum vom 6.–21. November 2005 stattfand, führte Marina Abramović Seven Easy Pieces auf. Dabei handelte es sich um Wiederaufführungen von sechs bereits „historischen“ künstlerischen Performances aus den Jahren 1965–1975 von Bruce Nauman, Vito Acconci, VALIE EXPORT, Gina Pane, Joseph Beuys und Abramović selbst. Mit diesen Wiederaufführungen reflektierte die Künstlerin auf unterschiedliche Möglichkeiten, die Geschichte von Aktions- und Performancekunst mit den Mitteln der Performancekunst zu schreiben. Dabei zeigte sich, dass jeder Versuch einer Wiederholung zur Kreation einer neuen Performance führt. Eine ‚Auferstehung‘ von Performances der Vergangenheit ist nur um diesen Preis zu haben. In ihrer ursprünglichen Gestalt bleiben sie – ebenso wie jedes andere historische Ereignis – den Nachgeborenen unzugänglich.
Die um die Wende zum neuen Millenium einsetzende ‚neue‘ Bewegung von Reenactments historischer – sowohl sozial-politischer als auch künstlerischer – Ereignisse ist als ein Versuch zu werten, mit theatralen Mitteln auf Geschichte zu reflektieren und zugleich Geschichtsschreibung zu vollziehen. Sie betreffend stellen sich ganz ähnliche Fragen und Probleme wie für die Aufführung von historischen Ereignissen auf einer Theaterbühne, wie Rokem sie skizziert hat. Ihre Untersuchung mit dem theoretischen Instrumentarium, das er in Performing History entwickelt, scheint daher vielversprechend. Die längst überfällige Übersetzung des Buches ins Deutsche kommt in diesem Sinne gerade zur rechten Zeit.
Vorbemerkung
Geschichte(n) zitieren…
Die Revolution ist die Maske des Todes.
Heiner Müller
Engel und Puppe: dann ist endlich Schauspiel.
Rainer Maria Rilke
Während der ersten Jahre meines Universitätsstudiums hatte ich die Fantasie, es sei das ultimative Ziel wissenschaftlicher Forschung, eine aus so perfekt montierten Zitaten bestehende Studie zu verfassen, dass niemand den Akt des Plagiats, um den es sich dabei handelte, bemerken würde. Erst später las ich Jorge Luis Borges und studierte Walter Benjamin, und ich erkannte, dass selbst diese Fantasie im Grunde intertextuell war, ein Zitat. Mein ‚Projekt‘ wurde von weniger bedeutenden Aufgaben unterbrochen, und auch von einigen weit wichtigeren. Wenn ich jetzt zu verstehen versuche, was ich in diesem Buch unternommen habe, scheint es mir, dass mich diese Fantasie noch immer in ihrem Griff hat. Deswegen beginne ich mit einer Reihe von Zitaten, die ich als Fragmente, ‚geborgen‘ aus unterschiedlichen Text-Vergangenheiten, mit mir gebracht habe, aus Vergangenheiten, mit denen auch das Theater bei seinen Versuchen, ‚Geschichte aufzuführen‘, zurechtkommen muss. Es handelt sich hierbei um eine mehr spekulative Form, sich meinem Thema zu nähern, noch nicht um die Einleitung des Buches.
Geschichte ist eine Organisation von Zeit: „Nach einer Stunde werden sechzig Minuten verflossen sein.“1, sagt Danton in Georg Büchners Dantons Tod. Die Frage ist: Wie wird diese ‚Einsicht‘ verstanden werden, nachdem die Stunde verflossen ist? Und wird es dann noch immer eine Einsicht sein? Oder nur die schmerzliche Bestätigung einer Routine, die immer wieder alle sechzig Minuten wiederholt werden muss?
In Shakespeares Wie es euch gefällt (II,7) bestärkt Jacques, als er auf die Weisheit über das Vergehen der Zeit zu sprechen kommt, die er einst von einem „schreck’gen Narrn“ hörte, den Eindruck, dass Zitaten eine ganz besondere Kraft eigen ist:
Dann zog er eine Sonnenuhr hervor,
Und wie er sie besah mit blödem Auge
Sagt’ er sehr weislich: „Zehn ist’s nach der Uhr.
Da sehn wir nun“, sagt’ er, „wie die Welt läuft:
’s ist nur ’ne Stunde her, da war es neun,
Und nach ’ner Stunde noch wird’s elfe sein;
Und so von Stund zu Stunde reifen wir,
Und so von Stund zu Stunde faulen wir,
Und daran hängt ein Märlein.[“]2
Abgesehen von der sexuellen Verausgabung, die als Subtext für die Auffassung dient, dass Zeit nicht nur unsere Leben, sondern auch die Geschichten darüber organisiert, werden die Stunden hier fortlaufend gezählt, während sich Danton, Zeit aufgrund seiner eigenen subjektiven Position messend, selbst immer, in jedem Augenblick, in eine qualvolle, unbekannte Gegenwart stellen wird.
Die Sicht des israelischen Dramatikers Hanoch Levin ist von einem Leiden an der Geschichte geprägt, dem er einen zynischen Ausdruck gibt. Die Mutter Tzesha sagt:
Wüsste ich nicht, dass wir [in der] Geschichte leben,
würde ich nicht durchhalten.3
Dies sind die allerletzten Worte in Levins groteskem Theaterstück Shitz(ץיש) von Mitte der 1970er Jahre. Sie werfen die Frage auf: Wann wird das Leben eines Einzelnen transzendiert, um in jene Form kontinuierlicher, linearer ‚Ewigkeit‘, die wir Geschichte nennen, Eingang zu finden? Und unter welchen Umständen wird sich der Einzelne in diesem Fluss dessen bewusst, dass dies der Fall ist? Und nicht zuletzt, spendet ein solches Bewusstsein Trost? Tzeshas stolze Erklärung, nachdem ihre Tochter ihren Ehemann in einem der Kriege verloren hat, ist eine Art invertierter (oder sogar ironischer?) ‚Drohung‘, die auf einer Konditionalstruktur (Wenn … dann) basiert: Da Tzesha weiß, dass sie „[in der] Geschichte“ lebt, ist das Leben wert, gelebt zu werden, was bedeutet, dass das Leben ohne diese ‚absurde‘ Sicherheit völlig bedeutungslos werden würde. Zu leben heißt, in der Geschichte zu leben. Und Geschichte, wie wir sie kennen, besteht aus einer Folge von Drohungen.
Die anonymen (letzten) Stunden von Dantons Leben, wie sie von Büchner in seinem Theaterstück festgehalten worden sind, standen immer an der Schwelle eines neuen Beginns für die nächste Stunde, und vermutlich flossen sie für Danton nicht einmal in die geordneteren Sphären der Geschichte ein. Paradoxerweise war er außerstande, die Art kausaler Kette aus Ereignissen und Folgen, die wir gewöhnlich Geschichte nennen, wahrzunehmen. Das war seine Tragödie. Doch zugleich brachte Dantons Tod durch Büchners Theaterstück den Rhythmus und die Bewegung hervor, die wir für solch ein Bewusstsein von Geschichte als notwendig erachten. Andernfalls, um Tzeshas triumphale Schlussfolgerung als Frage zu wiederholen, wie könnten wir imstande sein, das alles durchzuhalten?
„I’m not a historian.“4, sagt Estragon in Samuel Becketts Warten auf Godot. In einer Welt, in der Godot nicht (heut wiederum) erscheint und in der es keine Kontinuität und Kausalität gibt, ist es in der Tat unmöglich, ein Historiker zu sein. Einen Platz für Historiker gibt es nur in einer Welt, in der es möglich ist, Zusammenhänge zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herzustellen. Und Geschichte kann, in der Welt und auch auf der Bühne eines Theaters, aufgeführt werden, wenn unterschiedliche Zeitstrukturen (außer dem täglichen Wiederaufgehen der Sonne) differenziert werden können, die es nicht nur zu fragen ermöglichen, ob die Dinge, die wieder erscheinen, natürliche Phänomene sind, sondern, ob sie durch irgendeine Art von Handlungsmacht ausgelöst wurden, so dass ein Muster entsteht, nicht nur eine mechanische Wiederholung.
Das ist zweifellos der Grund dafür, dass Marcellus (in den Hamlet-Fassungen des First Folio und des First Quarto) bzw. Horatio (in der Fassung des Second Quarto) fragt: „Nun, ist das Ding heut wiederum erschienen?“5 Das ist, denke ich, „hier die Frage“, wenn man beginnt, unterschiedliche Theaterstücke und Aufführungen über spezifische historische Ereignisse zu untersuchen. Was bedeutet es, diese Ereignisse auf der Bühne wiederum zu zeigen? Was in Hamlet gesehen werden kann, ist, wie sich eine Last (irgendeine Art unerledigter Sache aus der Vergangenheit) darein verwandelt, dass ein Schauspieler „das Ding“ auf der Bühne ist und tut, dass er wiederum in der Aufführung von heute Nacht erscheint und unaufhörlich eine Wiederkehr des Verdrängten auf der Theaterbühne aufführt. Geschichte kann an sich nur wahrgenommen werden, wenn sie rekapituliert wird, wenn wir irgendeine Form von Diskurs, wie das Theater, schaffen, aufgrund dessen eine organisierte Wiederholung der Vergangenheit konstruiert wird, die die chaotischen, reißenden Ströme der Vergangenheit in einen ästhetischen Rahmen stellt. Dies gilt wahrscheinlich auch für die konventionelleren Formen von Geschichtsschreibung, wie sie in Geschichtsbüchern praktiziert wird.
Der Geist in Hamlet erscheint auf der Bühne als eine Störung der Anstrengungen, nach dem Tod des alten Königs Sinn und Ordnung zu schaffen, und zerbricht die Strukturen, die bereits, vielleicht zu früh, etabliert worden sind. Das Jenseits drängt sich auf, und dieses Eindringen eines neuen Geschehens verlangt umgehend nach Erklärung. Horatio, der ein Zeuge der Geistererscheinung gewesen ist (von der er Hamlet berichtet) und der gebeten wird, den König während der Aufführung der Mausefalle zu beobachten, ist es, welcher der Historiker in Shakespeares Hamlet wird.
Von einem ganz anderen Punkt seinen Ausgang nehmend schrieb Roland Barthes in Die helle Kammer:
So schließt das Leben eines Menschen, dessen Existenz der unseren um ein weniges vorausgegangen ist, in seiner Besonderheit gerade die Spannung der Geschichte, ihre Abspaltung mit ein. Die Geschichte ist hysterisch: sie nimmt erst Gestalt an, wenn man sie betrachtet – und um sie zu betrachten, muß man davon ausgeschlossen sein. Als lebendiges Wesen bin ich das genaue Gegenteil der Geschichte, ich bin das, was sie dementiert, was sie zugunsten meiner eigenen Geschichte zerstört (es ist mir unmöglich, an „Zeugen“ zu glauben; unmöglich zumindest, deren einer zu sein; […]).6
Durch das ‚Aufführen von Geschichte‘ ist es möglich, diesem Gefühl von Trennung und Ausschluss zu begegnen, indem es uns in die Lage versetzt, an die Zeugen zu glauben, die das gesehen haben, was auf irgendeine Weise wieder erzählt werden muss. Welche andere Möglichkeit bleibt, sofern wir nicht gewillt sind, uns einen Diskurs oder ein Theater ganz ohne Verweise gefallen zu lassen? Das ‚Geschichte aufführende‘ Theater strebt danach, sowohl die Trennung von als auch den Ausschluss aus der Vergangenheit zu überwinden, und ist darum bemüht, eine Gemeinschaft zu erschaffen, in der die Ereignisse aus dieser Vergangenheit wieder von Belang sind.
Indem es Theateraufführungen betrachtet, die Ereignisse der Französischen Revolution und des Zweiten Weltkriegs zeigen, legt dieses Buch dar, dass das Theater uns zu dem Glauben verführen kann, dass es dem Schauspieler möglich ist, zu einem Zeugen für die mittlerweile toten Zeugen zu werden. Dies bestreitet Paul Celans historiographisch nicht haltbare (aber emotional wohl einzig mögliche) ‚Position‘, die in seinem Gedicht Aschenglorie zum Ausdruck kommt. Er dachte in dem Gedicht über die Möglichkeit nach, Zeugnis von der Shoah nach dem ‚natürlichen‘ Tod der Überlebenden abzulegen:
Niemand
zeugt für den
Zeugen.7
Niemand kann für die Zeugen Zeugnis ablegen, sagt Celan. Niemand außer den Überlebenden selbst kann zu einem Zeugen dessen werden, was in der Shoah geschah. Der Versuch, Auschwitz mit ästhetischen Mitteln darzustellen, ist, wie Theodor Adorno geltend machte, eine der schwierigsten moralischen und ästhetischen Fragen unserer Zeit.
Primo Levi geht in Die Untergegangenen und die Geretteten einen Schritt weiter im Hinblick darauf, wer von der Vergangenheit Zeugnis ablegen kann. Er führt aus, dass sogar
[n]icht wir, die Überlebenden, […] die wirklichen Zeugen [sind]. [ …] Wir Überlebenden sind nicht nur eine verschwindend kleine, sondern auch eine anomale Minderheit: wir sind die, die aufgrund von Pflichtverletzung, aufgrund ihrer Geschicklichkeit oder ihres Glücks den tiefsten Punkt des Abgrunds nicht berührt haben. Wer ihn berührt, wer das Haupt der Medusa erblickt hat, konnte nicht mehr zurückkehren, um zu berichten, oder er ist stumm geworden. Vielmehr sind sie, die „Muselmänner“, die Untergegangenen, die eigentlichen Zeugen, jene, deren Aussage, eine allgemeine Bedeutung gehabt hätte.8
Es ist diese Stummheit der „eigentlichen Zeugen“, die das Theater, wenn es Geschichte aufführt, ständig zu retten versucht. Die vielschichtigen Paradoxien und Spannungsfelder, die von den Bemühungen erzeugt werden, die historische Vergangenheit und die Gegenwart des Theaters durch verschiedene Formen von Zeugenschaft zusammenzubringen, sind, wenn alles andere gesagt ist, das zentrale Thema dieses Buches.
Walter Benjamin dachte in seiner äußerst beeindruckenden Sammlung von Zitaten oder ‚gefundenen‘ Darstellungen, dem Passagen-Werk, darüber nach, was die Vergangenheit für uns weiterhin lesbar macht:
Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.9
Das Geschichte aufführende Theater kann, wie dieses Buch zeigt, zu solch einem Bild werden, indem es die Vergangenheit mit der Gegenwart durch die schöpferische Kraft des Theaters verbindet, andauernd aus der Vergangenheit ‚zitierend‘, aber die exakten Spuren tilgend, um volle Bedeutung in der Gegenwart zu erlangen.
Wenn ich auf die Entstehung dieses Buchs zurückblicke, gilt mein Dank zuerst all meinen Studierenden an den Universitäten von Tel Aviv und Helsinki für die Inspiration, die sie mir gaben, diesem Thema weiter nachzugehen; Pirkko Koski und meinen Kollegen am International Centre for Advanced Theatre Studies (ICATS) an der Universität Helsinki dafür, dass sie ihre Gedanken zu den hier behandelten Fragen mit mir geteilt haben; und Erika Fischer-Lichte für die Organisation des Symposiums, in dessen Folge der Band Theaterseit den 60er Jahren erschien, der eine frühere Version des Kapitels in diesem Buch, das sich mit europäischen Inszenierungen beschäftigt, enthält.10 Es gibt darüber hinaus noch viele weitere Freunde und Kollegen, denen ich danken möchte: Linda Ben-Zvi, Daniel Boyarin, Gabriele Brandstetter, Marvin Carlson, Sofia Gluchowitz, Stephen Greenblatt, Bruce McConachie, Jeanette Malkin, Janelle Reinelt, Eli Rozik, Stuart Schoffman, Claude Schumacher, Joshua Sobol, Dan Urian, Christel Weiler und Bill Worthen. Tom Postlewait schulde ich nicht nur meinen Dank für die redaktionelle Sorgfalt bei der Herausgabe der englischen Originalausgabe und für sein Vertrauen, sondern auch meine große Wertschätzung; Herbert Blau, wie auf den folgenden Seiten deutlich werden wird, meine Bewunderung; Yvonne Rock meine Dankbarkeit für ihre tiefe und andauernde Freundschaft; und Galit Hasan-Rokem so viel, wie ich geben kann. Dies Buch ist unseren drei Kindern gewidmet.
Anmerkungen
1 Georg Büchner: Dantons Tod. In: Ders.: Werke und Briefe, hrsg. v. Fritz Bergemann. Frankfurt am Main: Insel 1979, Bd. 1, S. 7–82, hier S. 12 (I,1).
2 William Shakespeare: Wie es euch gefällt, aus d. Engl. v. A. W. Schlegel. In: Ders.: Sämtliche Dramen. Bd. I: Komödien. München: Artemis & Winkler 1993, S. 671–749, hier S. 699 (II,7).
3 Hanoch Levin: ץיש [Shitz]. In: Ders.: 1 תוזחמ [Stücke 1]. Tel Aviv: HaKibbutz HaMe’uhad 2000, S. 291–368, hier S. 368.
4 „Ich bin kein Historiker.“ – Anm. des Übersetzers: Allerdings sagt Estragon dies nur in der von Samuel Beckett selbst aus dem französischen Original ins Englische übertragenen Fassung (vgl. Samuel Beckett: Dramatische Dichtungen in drei Sprachen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1963, Bd. 1, S. 421). Die gesamte Replik Estragons an dieser Stelle lautet im Englischen: „Don’t ask me. I’m not a historian.“, während es in der französischen Fassung „Ma foi, là tu m’en demandes trop.“ (ebd. S. 134) heißt. Die deutsche Übersetzung von Elmar Tophoven gibt dies mit „Jetzt verlangst du aber zuviel von mir.“ (ebd. S. 135) wieder.
5 William Shakespeare: Hamlet. Prinz von Dänemark, aus d. Engl. v. A. W. Schlegel. In: Ders.: Sämtliche Dramen. Bd. III: Tragödien. München: Artemis & Winkler 1993, S. 589–701, hier S. 592 (I,1).
6 Roland Barthes: Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie, aus d. Franz. v. Dietrich Leube. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 74–75.
7 Paul Celan: Atemwende. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1967, S. 68.
8 Primo Levi: Die Untergegangenen und die Geretteten, aus d. Ital. v. Moshe Kahn. München/Wien: Hanser 1990, S. 83–84.
9 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, hrsg. v. Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983, 1. Bd., [N 2 a, 3], S. 576.
10 Vgl. Freddie Rokem: „Performing History“: Theater und Geschichte. Die Französische Revolution im Theater nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Erika Fischer Lichte / Friedemann Kreuder / Isabel Pflug (Hrsg.): Theater seit den 60er Jahren. Grenzgänge der Neo-Avantgarde. Tübingen/Basel: Francke 1998, S. 316–374.
Einleitung
Begriffsaspekte des Aufführens von Geschichte
Dieses Buch untersucht, auf welche Art und Weise das Theater nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Aspekte der Französischen Revolution und der Shoah auf den Bühnen dargeboten hat.1 Diese Ereignisse, wie sie in Aufführungen dargestellt worden sind, auszuwählen, hat den Grund, dass sie unser heutiges Bewusstsein, insbesondere unsere Auffassung der historischen Vergangenheit als eine Folge von Ereignissen des tragischen Scheiterns grundlegender menschlicher Werte, geformt haben. Auch wenn die Französische Revolution zu Anfang solche universalen Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit beförderte, so verriet sie diese Werte auch unmittelbar in vielfältiger Weise; und die Shoah hat ihren furchteinflößenden Schatten auf beinahe jede mögliche Form menschlichen Handelns seit dem Zweiten Weltkrieg geworfen. Obwohl sich die Französische Revolution und die Shoah auf europäischem Boden zutrugen, haben beide zweifellos die ganze Welt zutiefst beeinflusst. Die vorliegende Studie setzt sich deshalb nicht nur damit auseinander, auf welche Art und Weise diese historischen Vergangenheiten auf der Bühne dargestellt worden sind, sondern untersucht auch die Signifikanz solcher Darstellungen in unterschiedlichen nationalen Kontexten: in den Vereinigten Staaten und in Europa an Aufführungen über die Französische Revolution und in Israel an Aufführungen über die Shoah.
Der spezifische Überblick über Geschichte aufführendes Theater, der hier vorgelegt wird, spiegelt in gewisser Weise meine persönliche ‚Geschichte‘ wider. Ich wurde in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, genauer gesagt, in Stockholm in Schweden, einem Land, das (nachdem es einige bedenkliche moralische Kompromisse eingegangen war) von Hitlers Verbrechen während des Krieges verschont blieb. Aber viele der positiven Ideale der Französischen Revolution haben schließlich recht tiefe Wurzeln in jenem nordeuropäischen Außenposten geschlagen. Die Frage, der ich in diesem Buch nachgehen möchte, ist, wie das Erbe der Französischen Revolution im (west)europäischen Theater nach dem Zweiten Weltkrieg wahrgenommen worden ist.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!